Düsseldorf, 31. März 2016
Franziska Leuthäußer: Sie wurden in der DDR als Privilegierter auf eine Propagandaschule geschickt. Wie wurden Sie dafür ausgewählt?
Günther Uecker: Es kam eine schwarze Limousine – dem Opel P4 ähnlich – mit drei Leuten. Einer blieb draußen – er war vielleicht nur ein Geheimdienstmann –, zwei Leute gingen zu meinen Eltern ins Haus. Wir wohnten damals in Groß Schwansee, von der Insel Wustrow sind wir mit Güterzügen dorthin gebracht worden, bis Klütz. Es kam also ein schwarzes Auto vor die Tür gefahren: Erst redete man mit meinen Eltern, und dann haben sie mich in der Küche befragt, was ich so denke und was ich so mache. Etwas später wurde ich nach Schwerin ins Schloss eingeladen, wo ich dann noch mal befragt wurde. Das war die Landesregierung Mecklenburg – damals noch nicht Vorpommern –, und es wurde dann entschieden, mir eine Ausbildung zu ermöglichen. Ich hatte ja nach 45 zwei Jahre lang gar keinen Schulunterricht und dadurch auch kein Abitur. Das war durch diesen Umzug von der Insel Wustrow auch nicht möglich. Es war gar kein Gymnasium in der Nähe. Und so hat man mich auf den zweiten Bildungsweg geschickt. Zuerst aber musste ich eine Lehre machen. Die habe ich in Grevesmühlen absolviert, eine Lehre als Anstreicher und Schreiner, also erst einmal etwas Handwerkliches, und dann habe ich für Agitation und Propaganda Schaufenster und Außenreklame gemacht. ![]() Günther Uecker absolvierte 1949 eine Lehre als Maler und Reklamegestalter. Bis zu seiner Flucht nach Westdeutschland im Jahr 1953 studierte er an der Fachschule für Angewandte Kunst in Wismar sowie an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Parallel war Günther Uecker als Sonderbeauftragter für die Ausgestaltung von Parteiaufzügen tätig. Vgl. Dieter Honisch, „Uecker“, Stuttgart 1983, S. 11 f. Damals war die DDR noch voller Bilder und Transparente, ich musste die Picasso-Taube – weiß auf rot-blauem Grund – malen und war auch 1951 in Berlin zu den ersten Weltjugendfestspielen
Günther Uecker absolvierte 1949 eine Lehre als Maler und Reklamegestalter. Bis zu seiner Flucht nach Westdeutschland im Jahr 1953 studierte er an der Fachschule für Angewandte Kunst in Wismar sowie an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Parallel war Günther Uecker als Sonderbeauftragter für die Ausgestaltung von Parteiaufzügen tätig. Vgl. Dieter Honisch, „Uecker“, Stuttgart 1983, S. 11 f. Damals war die DDR noch voller Bilder und Transparente, ich musste die Picasso-Taube – weiß auf rot-blauem Grund – malen und war auch 1951 in Berlin zu den ersten Weltjugendfestspielen ![]() Die Weltfestspiele der Jugend und Studenten waren ein internationales Jugendtreffen, das ab 1947 in unregelmäßigen Abständen vom Weltbund der demokratischen Jugend ausgerichtet wurde. Die vom 05. bis 19. August 1951 in Ost-Berlin veranstalteten Weltfestspiele zählten mehr als 26.000 Teilnehmer. Vgl. Andreas Ruhl, „Stalin-Kult und Rotes Woodstock – Die Weltjugendfestspiele 1951 und 1973 in Ost-Berlin“, Marburg 2009. in der DDR, dieser großen Veranstaltung, wofür vorher das Berliner Schloss gesprengt worden war. Das erlebte ich alles mit.
Die Weltfestspiele der Jugend und Studenten waren ein internationales Jugendtreffen, das ab 1947 in unregelmäßigen Abständen vom Weltbund der demokratischen Jugend ausgerichtet wurde. Die vom 05. bis 19. August 1951 in Ost-Berlin veranstalteten Weltfestspiele zählten mehr als 26.000 Teilnehmer. Vgl. Andreas Ruhl, „Stalin-Kult und Rotes Woodstock – Die Weltjugendfestspiele 1951 und 1973 in Ost-Berlin“, Marburg 2009. in der DDR, dieser großen Veranstaltung, wofür vorher das Berliner Schloss gesprengt worden war. Das erlebte ich alles mit.
Wahrscheinlich waren es Parteigenossen, die mich damals ausgewählt haben. Die kamen vom Kreiskomitee Kreis Grevesmühlen bei Klütz. Vom Zentralkomitee ausgewählte Leute, die durch die Landschaft zogen und begabte junge Leute suchten. Nachdem ich die Lehre gemacht hatte, bekam ich den sogenannten „Facharbeiterbrief“, und damit konnte ich dann auf dem zweiten Bildungsweg studieren. Ich war in Lübs in einer Art Kaderschule, wo wir von morgens bis abends unterrichtet wurden. Viele der Lehrer waren aus dem Ausland zurückgekommen, Antifaschisten, die vor dem Hitlerreich geflohen waren und nun wieder zurückkehrten, um das andere Deutschland zu begründen. Man dachte damals, man will den Bürgerstand nicht rekonstruieren und etablieren, sondern eine Bauern- und Arbeiterschaft zum Mittelpunkt eines anderen Deutschlands machen. Das lief bis 53 eigentlich auch sehr vielversprechend.
Noch einmal zurück zu diesen Männern in der Limousine. Nach welchen Kriterien wurden Sie ausgewählt?
Keine Ahnung. Sie fuhren über alle Dörfer und erkundigten sich. Ich war ja noch in der Schule, in der Zentralschule Groß Schwansee. Dort habe ich noch als Schüler mit 19 Jahren für einen Plakatentwurf meinen ersten Preis der DDR bekommen. Das wurde sogar in der Zeitung erwähnt. Also, ich hatte schon etwas Aufmerksamkeit auf mich gelenkt und meinen Vater überwunden.
Und mit ihren Fragen wollten die Männer Ihre Systemtauglichkeit prüfen?
Nein. Ich wusste ja nichts vom System. Was für ein System?
Was wurden Sie denn gefragt?
Was ich mir so vorstelle, und ob ich in der Landwirtschaft bleiben möchte, um den Vater zu unterstützen. Da waren wir ja noch freie Bauern.
Und bereits damals konnten Sie denen schon sagen, dass Sie eigentlich Kunst machen wollen?
Ja. Ich hatte ja auch schon viel gezeigt. Auch dadurch habe ich vielleicht Aufmerksamkeit auf mich gelenkt. Denn man wollte – das war ein Bildungsprogramm – aus der Bevölkerung eine neue Basis für das neue Deutschland bilden, so nannte man es. Über die Methoden und Kriterien wusste ich nichts. Für mich waren das einfach respektable, sehr freundliche Herren, die intelligent schienen. Mein Vater und meine Mutter sagten später: „Das hätten wir nie gedacht, dass du mit diesen Menschen so reden kannst.“ Da waren sie selbst erstaunt.
Sie wussten aber, diese Männer können mich dahin bringen, wohin ich will?
Überhaupt nicht, nein, ich wollte studieren. Ich war denen gegenüber erst sehr ablehnend. Die haben mich nicht besonders interessiert. Ich bin dann aber trotzdem nach Schwerin gefahren, auch, weil es an der Zentralschule Groß Schwansee einen Schulleiter gab, einen SED-Genossen, der das gefördert hat. Er war natürlich informiert. Ich war der Einzige in der ganzen Umgebung, der ausgewählt wurde, wie das eben so geht – Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, das betreibe ich ja bis heute.
Haben Sie sich innerhalb Ihrer Generation über diese Dinge ausgetauscht? Sie haben an anderer Stelle mehrfach gesagt, Sie sind nicht die Schuldigen. Aber Sie sind ein Schulderbe.
Ja, klar.
Ab wann haben Sie sich damit befasst und auseinandergesetzt? War das in der Schule ein Thema?
Es gab die Erinnerung einer Erneuerung nach der Weimarer Zeit innerhalb Deutschlands vor Hitler. Das heißt, es ging darum: Wie konnte es dazu kommen, dass der Nationalsozialismus so eine breite Zustimmung in der Bevölkerung fand, bis zu 70 Prozent? ![]() Bei der Reichstagswahl 1932 erhielt die NSDAP in mehreren ländlichen Wahlkreisen über 70 Prozent der Wählerstimmen. Vgl. Clemens Vollnhals, „Evangelische Kirche und Entnazifizierung 1945–1949: Die Last der nationalsozialistischen Vergangenheit“, München 1989, S. 124 f. Diese breite Bevölkerungszustimmung war für die Kommunisten ein Phänomen, und das haben wir in der Schule analysiert. Das war der einzige Politikunterricht. Das neue System gab es ja noch nicht. Es gab natürlich Lyssenko und Mitschurin, die großen Wissenschaftler, nach denen Stalin die Landwirtschaft in der ganzen Sowjetunion umgestalten wollte.
Bei der Reichstagswahl 1932 erhielt die NSDAP in mehreren ländlichen Wahlkreisen über 70 Prozent der Wählerstimmen. Vgl. Clemens Vollnhals, „Evangelische Kirche und Entnazifizierung 1945–1949: Die Last der nationalsozialistischen Vergangenheit“, München 1989, S. 124 f. Diese breite Bevölkerungszustimmung war für die Kommunisten ein Phänomen, und das haben wir in der Schule analysiert. Das war der einzige Politikunterricht. Das neue System gab es ja noch nicht. Es gab natürlich Lyssenko und Mitschurin, die großen Wissenschaftler, nach denen Stalin die Landwirtschaft in der ganzen Sowjetunion umgestalten wollte. ![]() Sowohl der durch den sowjetischen Biologen Trofim Denissowitsch Lyssenko (1898–1976) ausformulierte „Lyssenkoismus“ wie auch die durch den Botaniker Iwan Wladimirowitsch Mitschurin (1855–1935) begründete „mitschurinsche Wissenschaft“ bildeten wichtige theoretische Bezugspunkte für Stalins Landwirtschaftsreformen. Vgl. Wolfram Eggeling/Anneli Hartmann, „,Das zweitrangige Deutschland‘ – Folgen des sowjetischen Technik- und Wissenschaftsmonopols für die SBZ und die frühe DDR“, in: Wolfgang Emmerich/Carl Wege (Hg.), „Der Technikdiskurs in der Hitler-Stalin-Ära“, Stuttgart 1995, S. 189–202, hier S. 191 ff. Stalin hat ja in der Ukraine Hungerperioden eingeleitet, und das haben wir aufgrund der landwirtschaftlichen Entwicklung, besonders unserer eigenen, mit großer Skepsis gesehen. Wir waren keine Großbauern, aber die gab es eben auch, und die wurden enteignet und aus der DDR vertrieben. Auch viele Gutsbesitzer. Die Landbevölkerung wurde so lange gefördert, wie sie unter einer bestimmten Vermögensgrenze blieb. Das war die Arbeiter- und Bauernklasse, zu der ich zählte.
Sowohl der durch den sowjetischen Biologen Trofim Denissowitsch Lyssenko (1898–1976) ausformulierte „Lyssenkoismus“ wie auch die durch den Botaniker Iwan Wladimirowitsch Mitschurin (1855–1935) begründete „mitschurinsche Wissenschaft“ bildeten wichtige theoretische Bezugspunkte für Stalins Landwirtschaftsreformen. Vgl. Wolfram Eggeling/Anneli Hartmann, „,Das zweitrangige Deutschland‘ – Folgen des sowjetischen Technik- und Wissenschaftsmonopols für die SBZ und die frühe DDR“, in: Wolfgang Emmerich/Carl Wege (Hg.), „Der Technikdiskurs in der Hitler-Stalin-Ära“, Stuttgart 1995, S. 189–202, hier S. 191 ff. Stalin hat ja in der Ukraine Hungerperioden eingeleitet, und das haben wir aufgrund der landwirtschaftlichen Entwicklung, besonders unserer eigenen, mit großer Skepsis gesehen. Wir waren keine Großbauern, aber die gab es eben auch, und die wurden enteignet und aus der DDR vertrieben. Auch viele Gutsbesitzer. Die Landbevölkerung wurde so lange gefördert, wie sie unter einer bestimmten Vermögensgrenze blieb. Das war die Arbeiter- und Bauernklasse, zu der ich zählte.
Gab es in der Kunst – ich nenne es jetzt Kunst, auch wenn Sie sagen, Sie machen keine Kunst, aber wir müssen es ja irgendwie benennen – ein Vorbild?
Ja. Mit acht Jahren habe ich bei einem Freund ein Buch mit Abbildungen von Ernst Josephson ![]() Ernst Josephson (1851 Stockholm – 1906 Stockholm) war ein schwedischer Maler, der dem Symbolismus und der Neuromantik zugerechnet wird. gesehen. Das war „Die Königin aus Jaconda“, aus Indien. Ein Fantasiemärchen wahrscheinlich. Die Königin war mit Punkten gezeichnet. Das war das erste Kunstwerk, das ich gesehen habe, wie ich das heute bezeichnen möchte. Das war sehr prägend. Sonst hatten wir keine Bücher und keine Vorbilder. Ich kannte nichts. Kein Kunstbuch. Nichts.
Ernst Josephson (1851 Stockholm – 1906 Stockholm) war ein schwedischer Maler, der dem Symbolismus und der Neuromantik zugerechnet wird. gesehen. Das war „Die Königin aus Jaconda“, aus Indien. Ein Fantasiemärchen wahrscheinlich. Die Königin war mit Punkten gezeichnet. Das war das erste Kunstwerk, das ich gesehen habe, wie ich das heute bezeichnen möchte. Das war sehr prägend. Sonst hatten wir keine Bücher und keine Vorbilder. Ich kannte nichts. Kein Kunstbuch. Nichts.
Wie kommt man dann auf die Idee, Kunst machen zu wollen? Über das eigene Zeichnen?
Ja, das war mir ähnlich. Das war ein bisschen psychopathisch, und da fühlte ich: Aha, da finde ich einen Ausdruck, der mir eigen ist. Das ermutigte mich. Obwohl die Befremdung, die ich mit meinen Zeichnungen erzeugte, bestehen blieb. Es begann mir jedoch zu gefallen, dass ich überhaupt malte und dass Leute das mit Aufmerksamkeit betrachteten. Das ging in der Schule sogar so weit, dass ich von den Lehrern aufgefordert wurde, den Kunstunterricht zu übernehmen. Da war ich wohl 19.
Was haben Sie da gemacht?
Gezeichnet. Ich bin mit den Schülern rausgegangen, ans Meer in Schwansee, das war 49, und habe denen gesagt: „Schaut richtig! Der Horizont ist rund und gewölbt! Ihr seht ihn vielleicht anders, aber, wenn ihr im Gehirn umschaltet, seht ihr, dass es so ist!“ Es ging also eigentlich um das Eindringen in das Seherische, das dann aber das einfältige Sehen ist.
Wann haben Sie in der DDR das erste Mal andere Künstler getroffen?
Als ich aus der DDR wegging, war ich 23. Wir waren Studenten, und da habe ich keine Künstler getroffen, das heißt, ich kannte nur die Lehrer und die anderen Studenten. Ich kannte vielleicht noch Ernst Barlach von Abbildungen, und Käthe Kollwitz war natürlich so etwas wie Nationalgut der sozialistischen Welt. Dann natürlich Otto Pankok, ![]() Otto Pankok (1893 Mülheim an der Ruhr – 1966 Wesel) war ein deutscher Maler und Bildhauer, der ab 1919 der Düsseldorfer Künstlergruppe Junges Rheinland angehörte. Aufgrund seines ausdrucksstarken Stils und seiner sozialkritischen Bildinhalte belegten ihn die Nationalsozialisten 1936 mit einem Arbeitsverbot und zeigten ein Jahr später mehrere seiner Werke in der Propagandaausstellung „Entartete Kunst“. Nach Jahren der inneren Emigration erstellte Pankok 1950 den Holzschnitt „Christus zerbricht das Gewehr“, der als Motiv der Friedensbewegung Bekanntheit erlangte. Die Arbeit befindet sich heute im Pankok Museum Haus Esselt in Hünxe-Drevenack.
Otto Pankok (1893 Mülheim an der Ruhr – 1966 Wesel) war ein deutscher Maler und Bildhauer, der ab 1919 der Düsseldorfer Künstlergruppe Junges Rheinland angehörte. Aufgrund seines ausdrucksstarken Stils und seiner sozialkritischen Bildinhalte belegten ihn die Nationalsozialisten 1936 mit einem Arbeitsverbot und zeigten ein Jahr später mehrere seiner Werke in der Propagandaausstellung „Entartete Kunst“. Nach Jahren der inneren Emigration erstellte Pankok 1950 den Holzschnitt „Christus zerbricht das Gewehr“, der als Motiv der Friedensbewegung Bekanntheit erlangte. Die Arbeit befindet sich heute im Pankok Museum Haus Esselt in Hünxe-Drevenack. 
Wo haben Sie die Werke von Pankok gesehen? In Büchern?
Ja, alles nur in Büchern. Und damals habe ich gedacht: Wenn ich hier abhaue, gehe ich zu ihm. Zu ihm fühlte ich mich hingezogen.
Das heißt, in der DDR gab es niemanden, mit dem Sie über Kunst gesprochen haben?
Nein, weil Kunst kein Thema war. Es gab nur Agitation und Propaganda. Wir haben die Kunst abgeschafft sowie das Bürgertum und die Bildungsbürger, die Prägungen wurden als negativ denunziert. Schüler wurden zum Abitur oft nicht zugelassen, wenn sie von bürgerlicher Herkunft waren. Das war sehr streng. Wir waren irgendwie Ausnahmen und haben eigentlich gar nicht richtig begriffen, wieso solche Maßnahmen gegenüber anderen erfolgten. Wir dachten immer, das sind alte Nazis. Es waren ja auch fast 70, 80 Prozent Nazis und Mörder, mit denen man zu tun hatte.
Dennoch sagen Sie, bis 53 – oder bis zum 17. Juni ![]() Am 17. Juni 1953 kam es in der DDR aufgrund der politischen und ökonomischen Entwicklungen zu zahlreichen Streiks und Demonstrationen, die gewaltvoll durch Soldaten der Sowjetarmee beendet wurden. Der Aufstand des 17. Juni gilt rückblickend als erster Ausgangspunkt der späteren antistalinistischen Bewegungen. Vgl. Hubertus Knabe, „17. Juni 1953. Ein deutscher Aufstand“, München 2003. – war es in der DDR „vielversprechend“?
Am 17. Juni 1953 kam es in der DDR aufgrund der politischen und ökonomischen Entwicklungen zu zahlreichen Streiks und Demonstrationen, die gewaltvoll durch Soldaten der Sowjetarmee beendet wurden. Der Aufstand des 17. Juni gilt rückblickend als erster Ausgangspunkt der späteren antistalinistischen Bewegungen. Vgl. Hubertus Knabe, „17. Juni 1953. Ein deutscher Aufstand“, München 2003. – war es in der DDR „vielversprechend“?
Es gab eine Aufklärung. Das war das Schönste, was ich überhaupt erlebt habe. Am Aufbruch innerhalb eines Staatswesens beteiligt zu sein. Ernst Bloch war zu der Zeit dort, Peter Huchel, Hans Mayer – es waren sehr kompetente Lehrer im Osten. ![]() Insbesondere während der Aufbauphase siedelten viele dem Sozialismus nahestehende, westliche Intellektuelle vorübergehend in die DDR über. So lehrte der Philosoph Ernst Bloch (1885–1977) von 1948 bis 1956 an der Universität Leipzig, wo von 1956 bis 1963 auch der Literaturwissenschaftler Hans Mayer (1907–2001) tätig war. Der Journalist und Lyriker Peter Huchel (1903–1981) leitete von 1949 bis 1962 zunächst als Chefredakteur die Literaturzeitschrift „Sinn und Form“ und lebte anschließend bis zu seiner Flucht 1971 als freier Autor in Ost-Berlin.
Insbesondere während der Aufbauphase siedelten viele dem Sozialismus nahestehende, westliche Intellektuelle vorübergehend in die DDR über. So lehrte der Philosoph Ernst Bloch (1885–1977) von 1948 bis 1956 an der Universität Leipzig, wo von 1956 bis 1963 auch der Literaturwissenschaftler Hans Mayer (1907–2001) tätig war. Der Journalist und Lyriker Peter Huchel (1903–1981) leitete von 1949 bis 1962 zunächst als Chefredakteur die Literaturzeitschrift „Sinn und Form“ und lebte anschließend bis zu seiner Flucht 1971 als freier Autor in Ost-Berlin.
In Berlin?
Auch an anderen Orten. Es waren nicht meine Lehrer. Ich weiß nur, dass sie im Osten waren, wie auch Bertold Brecht in den Osten, in das antifaschistische Deutschland gegangen ist. Das war wirklich etwas, wozu man sich bekennen konnte, die Menschen, die in der nationalsozialistischen Zeit in den 30er-Jahren freiwillig in die Immigration nach Russland, Japan, Amerika oder Belgien – und die meisten nach Südfrankreich – gegangen waren und dann als Deutsche in die DDR zurückkehrten. Es waren wenige Juden, aber doch einige, die ich auch kannte und die mir Freunde wurden. Das war Aufbruch, und wir waren die Auserwählten. Man war total begeistert.
Wie kann man sich so einen Tag eines „Auserwählten“ damals in der DDR vorstellen?
Um halb sieben aufstehen, um acht frühstücken. Betten brauchten wir nicht zu machen.
Wo haben Sie gewohnt?
In Lübs in einem Internat. Bis ich 22 war, war ich im Internat. Wir konnten mit den Mädchen nicht kopulieren, aber wir durften küssen. Bis zehn. Und spielen durften wir draußen noch bis zur Abenddämmerung. Wir bekamen aber immer etwas ins Essen.
Was bedeutet das: etwas ins Essen?
Chemikalien. Wir haben uns dann heimlich in einer Apotheke Hirschbrunftpulver gekauft und haben das gegessen. Wir waren ein Drittel Jungs und zwei Drittel Mädchen, weil der Intelligenzquotient bei den Mädchen immer höher war. Wahrscheinlich bis zu einem gewissen Alter. Im Internat waren wir weniger als 100 Lehrlinge. Das war ein ehemaliges Kurhaus, das mitten im Wald stand. Abends wurde es abgeschlossen. Manchmal haben wir uns heimlich nach draußen abgeseilt. Ab acht Uhr morgens war strenger Unterricht bei sehr interessanten Lehrerinnen und Lehrern. Dann Mittagessen und anschließend bis fünf Uhr wieder Unterricht. Jeden Tag.
Unterricht in welchen Fächern?
In allem. Psychologie und Agrarwissenschaft, da kam ich ja her, wurden wissenschaftlich noch vertieft. Daher meine Kenntnisse über die Faszination von Stalin, der von den Wissenschaftlern so betört war und meinte, er könne damit die Welt verändern. Er hat damit ein furchtbares Elend in der Landwirtschaft herbeigeführt. Und dann hatten wir ökonomische Lehren, also die Analyse des Kapitalismus. Soziologie und natürlich Mathematik, Schreiben, Lesen …
Und Sie haben den Unterricht aufmerksam verfolgt?
Na klar!
Und zwischendurch haben Sie gezeichnet?
Ja, aber nicht viel. Weil wir doch ziemlich ausgelastet waren. Wir mussten auch viele Schularbeiten machen. Das war sehr streng. Eine richtige Kaderschmiede. Ich bin etwa so alt wie Egon Krenz, ![]() Egon Krenz (* 1937 Kolberg, Pommern, heute Polen) war ein Politiker und Parteimitglied der SED. Nach dem Rücktritt Erich Honeckers im Oktober 1989 hatte er für wenige Wochen das Amt des Staatsvorsitzenden der DDR inne. 1997 wurde Krenz im Zuge der „Mauerschützenprozesse“ zu sechs Jahren Haft verurteilt. der war auch in so einer Schule. Deshalb war ich dann auch FDJler und Funktionär. Und ich habe 1951 eine Theatergruppe gegründet. Wir haben für die Bauern und die Landarbeiter in einem ehemaligen Eiskeller in Groß Schwansee, den ich umgebaut habe, Theater gespielt.
Egon Krenz (* 1937 Kolberg, Pommern, heute Polen) war ein Politiker und Parteimitglied der SED. Nach dem Rücktritt Erich Honeckers im Oktober 1989 hatte er für wenige Wochen das Amt des Staatsvorsitzenden der DDR inne. 1997 wurde Krenz im Zuge der „Mauerschützenprozesse“ zu sechs Jahren Haft verurteilt. der war auch in so einer Schule. Deshalb war ich dann auch FDJler und Funktionär. Und ich habe 1951 eine Theatergruppe gegründet. Wir haben für die Bauern und die Landarbeiter in einem ehemaligen Eiskeller in Groß Schwansee, den ich umgebaut habe, Theater gespielt.
Mit Ihren Klassenkameraden?
Mit Leuten aus dem Dorf und einigen, die ich mitbrachte. Da kamen natürlich viele Russen. Das wurde auch sehr unterstützt, sicher von diesem Kreiskomitee in Schwerin oder dem Land, sodass wir sogar „Panzerkreuzer Potemkin“ von Sergej Eisenstein und all diese wunderbaren Filme in einer Scheune zeigen konnten. Das war schon toll. Natürlich haben wir auch die KZ-Filme gezeigt. Diese Leichenberge, die mit Grubenbaggern geschoben wurden. So wie es die Amerikaner dann auch vorgefunden haben.
Das war erlaubt?
Das wurde immer gezeigt, ja.
Wie waren die Reaktionen der Dorfbewohner?
Das waren zum Teil auch Leute aus Ost-Westpreußen und Ostpreußen und Pommern, die geflüchtet waren. So wie wir auch. Wir sind ja von unserer Insel nur etwas weiter nach Westen gekommen. Das war also schon eine durchmischte Bevölkerung.
Sie waren damals wahrscheinlich eine große Ausnahme? Wer sonst hätte eine Theatergruppe gegründet und Filmvorführungen in einer Scheune organisiert?
Darauf habe ich nicht geachtet. Für uns war genau das erstrebenswert. Ich war in Berlin zu den Weltjugendfestspielen, weil die Kunst für uns damit überwunden war. Kunst ist ein bildungsbürgerliches Attribut zur Selbstglorifizierung. Jörg Immendorff hat sich ja später damit auch im Westen beschäftigt. Das waren ja Glorioren wie nach der Französischen Revolution. Das waren mythologische Manien.
Sie sind im Spätsommer 1953 durch das Brandenburger Tor in den Westen gegangen und haben sich den Alliierten gestellt. Wann und wie ist diese Entscheidung „Jetzt ist der Tag, an dem ich durch das Brandenburger Tor gehe und mich den Alliierten stelle“ gefallen?
Wir sagten immer: „Wir lassen uns hier gut ausbilden, und dann hauen wir ab.“ Das haben wir allerdings eher als Witz gesagt, das wurde nicht so ernst genommen. Wir hörten damals unter der Bettdecke „Voice of America“, ![]() „Voice of America“ ist der offizielle Radioauslandssender der USA, der sein Programm seit 1942 in 43 Sprachen sendet. ließen uns von den Mädchen die Haare abschneiden – ich hatte immer eine Glatze und hieß auch Professor Igel, weil ich so viel redete wie jetzt – und haben dann beschlossen: Wir wollen lieber zu denen gehören, die im Lager vernichtet wurden, als zu den Überlebenden, die Mörder sind. Den Schulderben. Das war später auch Thema in dem Manifest, das ich geschrieben habe.
„Voice of America“ ist der offizielle Radioauslandssender der USA, der sein Programm seit 1942 in 43 Sprachen sendet. ließen uns von den Mädchen die Haare abschneiden – ich hatte immer eine Glatze und hieß auch Professor Igel, weil ich so viel redete wie jetzt – und haben dann beschlossen: Wir wollen lieber zu denen gehören, die im Lager vernichtet wurden, als zu den Überlebenden, die Mörder sind. Den Schulderben. Das war später auch Thema in dem Manifest, das ich geschrieben habe. ![]() Günther Uecker und Hannah Weitemeier, „Günther Uecker“, in: „Schwarz“, hg. von Hannah Weitemeier, Ausst.-Kat. Kunsthalle Düsseldorf, Berlin 1981, S. 15. Es war nicht auszuhalten in der Zeit des Erwachens, des geistigen Erwecktwerdens durch Informationen, Psychoanalysen und Geschichtsbetrachtung. Das hat uns tief erschüttert, diese ganze Entwicklung des Nationalsozialismus und dessen Praktiken. Erfahren haben wir es von Menschen, die betroffen waren, die in den Lagern gewesen waren, Wissenschaftler oder Pädagogen, die dann ins Ausland gegangen sind. Diejenigen, die zurückkehrten, haben uns das vermittelt. Das war bis 53 ein sehr bemerkenswerter Prozess innerhalb des geteilten Deutschlands: Die Ostzone war damals in höchstem Maße auf diesem antifaschistischen Trip, und das hat uns begeistert.
Günther Uecker und Hannah Weitemeier, „Günther Uecker“, in: „Schwarz“, hg. von Hannah Weitemeier, Ausst.-Kat. Kunsthalle Düsseldorf, Berlin 1981, S. 15. Es war nicht auszuhalten in der Zeit des Erwachens, des geistigen Erwecktwerdens durch Informationen, Psychoanalysen und Geschichtsbetrachtung. Das hat uns tief erschüttert, diese ganze Entwicklung des Nationalsozialismus und dessen Praktiken. Erfahren haben wir es von Menschen, die betroffen waren, die in den Lagern gewesen waren, Wissenschaftler oder Pädagogen, die dann ins Ausland gegangen sind. Diejenigen, die zurückkehrten, haben uns das vermittelt. Das war bis 53 ein sehr bemerkenswerter Prozess innerhalb des geteilten Deutschlands: Die Ostzone war damals in höchstem Maße auf diesem antifaschistischen Trip, und das hat uns begeistert.
Wurden Sie mit dem Schulderbe von außen konfrontiert, oder war das eine moralische Übernahme? Gab es ein Gegenüber, das Ihnen diese Schuld tatsächlich auflud, oder luden Sie sich die Schuld selbst auf?
Das Schulderbe rührt bestimmt nicht daher, dass ich und zwei andere Jungen mit 15 Jahren 75 Leichen verscharrt haben, die sechs Wochen lang bei uns auf der Insel lagen und bei Westwind so viel Gestank verbreiteten, dass die russischen Soldaten es nicht mehr aushielten. Es gab ja keine Männer mehr, die waren alle in Gefangenenlagern oder sonst wo. Es gab Mütter und Kinder und alte Männer, die von den Soldaten immer ganz blau geschlagen waren. Damals habe ich zum ersten Mal Verwesung gesehen. Das verweste Wesen, das sich voller Maden bewegte und mumifiziert war. Wie auf Mallorca die Touristen lagen sie in der Sonne am Strand, dicht an dicht. Und dann hoben wir dort Löcher aus, nicht tief, aber so, dass der Gestank doch unter der Erde verschwand. Das war eine sehr prägende Erfahrung für mich. Ich hatte es mit den großen Fernrohren vorher beobachtet. Auf unserer Insel war eine Versuchsbasis für Luftabwehr, und da gab es diese riesigen Fernrohre. Dicke Okulare, durch die man hindurchgucken konnte. Ich sah am Horizont Schwärme von Schiffen wie Ameisen über das Wasser laufen und sah, wie die Flugzeuge dort hineinflogen und alles bombardierten.
Sie haben die Angriffe – ich glaube, es waren die Opfer der „Cap Arcona“, ![]() Die Cap Arcona war ein deutscher Luxusdampfer, der ab 1927 die Hamburg-Südamerika-Linie bediente. Am 03. Mai 1945 wurde das Schiff mit 7.000 KZ-Häftlingen an Bord von der englischen Luftwaffe in der Lübecker Bucht versenkt. Vgl. Wilhelm Lange, „Neueste Erkenntnisse zur Bombardierung der KZ Schiffe in der Neustädter Bucht am 3. Mai 1945: Vorgeschichte, Verlauf und Verantwortlichkeiten“, in: Detlef Garbe (Hg.), „Häftlinge zwischen Vernichtung und Befreiung. Die Auflösung des KZ Neuengamme und seiner Außenlager durch die SS im Frühjahr 1945“, Bremen 2005, S. 217–232. die bei Ihnen auf der Insel gestrandet sind – wirklich durch das Fernrohr beobachtet?
Die Cap Arcona war ein deutscher Luxusdampfer, der ab 1927 die Hamburg-Südamerika-Linie bediente. Am 03. Mai 1945 wurde das Schiff mit 7.000 KZ-Häftlingen an Bord von der englischen Luftwaffe in der Lübecker Bucht versenkt. Vgl. Wilhelm Lange, „Neueste Erkenntnisse zur Bombardierung der KZ Schiffe in der Neustädter Bucht am 3. Mai 1945: Vorgeschichte, Verlauf und Verantwortlichkeiten“, in: Detlef Garbe (Hg.), „Häftlinge zwischen Vernichtung und Befreiung. Die Auflösung des KZ Neuengamme und seiner Außenlager durch die SS im Frühjahr 1945“, Bremen 2005, S. 217–232. die bei Ihnen auf der Insel gestrandet sind – wirklich durch das Fernrohr beobachtet?
Ja, sehr nah. Ich habe richtig Panik bekommen. Es hat mich so tief erschüttert, dass ich zu meiner Mutter rannte und mich an sie geworfen habe. Ich habe es ihr aber nicht richtig erzählen können. Und immer wieder habe ich in der Badewanne gebadet, um diesen Gestank von Verwesung loszuwerden. Der war so richtig eingedrungen.
Das Schulderbe hat aber mit diesem Ereignis speziell nichts zu tun?
Nein. Das war in der Reflexion darauf. Ich habe das Manifest ja auch erst 1980 geschrieben, damals mit Hannah Weitemeier zu der Ausstellung „Schwarz“ in der Kunsthalle Düsseldorf. ![]() Günther Uecker und Hannah Weitemeier, „Günther Uecker“, in: „Schwarz“, hg. von Hannah Weitemeier, Ausst.-Kat. Kunsthalle Düsseldorf, Berlin 1981, S. 15.
Günther Uecker und Hannah Weitemeier, „Günther Uecker“, in: „Schwarz“, hg. von Hannah Weitemeier, Ausst.-Kat. Kunsthalle Düsseldorf, Berlin 1981, S. 15.
Zurück zu Ihrem Übergang in den Westen …
Zu dieser Sehnsucht und der Verführbarkeit des Privilegierten gehörte übrigens auch, dass wir die Besondere-Intelligenz-Lebensmittelkarten bekamen, womit wir uns eineinhalb Kilo Fleisch in der Woche holen konnten. Wir waren eine richtige Oberschicht. Wir hatten Freikarten für alle Züge und einen Chauffeur mit Auto, wenn wir wollten. Wir sind durch das Land gebraust und haben die Transparente, die über die Straßen gespannt waren sowie Bilder von Stalin kontrolliert. In Grevesmühlen habe ich eins gemalt, das war 20 Meter hoch. Die Pupille dick, mit einem dicken Quast. Immer auf dem Gerüst, Quadratmeter für Quadratmeter. Das haben wir mit großer Begeisterung gemacht. Ich konnte mit dem Modler, einem breiten Pinsel, die Schrift frei schreiben, das war auf dem roten Stoff auch noch lesbar, wenn es weit oben an den Häusern befestigt über der Straße hing. Wir haben sozusagen die ganze DDR zu einem Theater gemacht, um die Ruinen zu verdecken.
Trotzdem sagen Sie, der Gedanke, in den Westen zu gehen, war immer präsent.
Nein, das ist zu simpel gedacht. Es ging darum, frei zu bleiben, sich klarzumachen: „Du kannst immer abhauen.“ Das hatte ja auch einen Sog, wenn man „Voice of America“ hörte. Die Musik war faszinierend. „Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, Freie Deutsche Jugend, bau auf! Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf.“ So etwas haben wir gesungen.
Wann haben Sie entschieden: Heute ist der Tag, an dem ich gehe?
Das kann man so nicht sagen. Ich habe es immer mit mir rumgetragen. Und dann bin ich zu meinen Eltern gefahren und habe Abschied genommen. Sie wussten allerdings nicht, dass ich Abschied nehme. Ich durfte es ihnen ja nicht sagen, denn damit wären sie in eine Art Sippenhaft gekommen. In Klütz bin ich in den Zug gestiegen und in Grevesmühlen wieder raus. Dann über den Zaun, und da habe ich übernachtet. Am nächsten Tag bin ich in einen anderen Zug gestiegen. Ich bin kreuz und quer gefahren, um nach Berlin zu kommen. Man wurde immer kontrolliert. Normalerweise musste man, wenn man in einen anderen Landkreis fuhr, eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Da ich aber einen Privilegiertenausweis hatte, konnte ich mich in der DDR frei bewegen. Das war ein Vorteil. So fuhr ich also nach Ost-Berlin, nach Weißensee. Dort habe ich dann überlegt, wie ich in den Westen gehe. Vorher hatte ich schon einmal mit einer Studentin über Sassnitz mit der Fähre einen Fluchtversuch gemacht. Damals sind wir inhaftiert worden, weil wir aber Studenten einer Schule waren, kamen wir am nächsten Tag wieder frei.
Obwohl die wussten, dass Sie einen Fluchtversuch gewagt hatten, hat man Sie wieder freigelassen?
Ja. Sie müssen sich vorstellen, wir waren junge Menschen, die einfach alles machten. So ähnlich habe ich das in Irkutsk erlebt. Junge Studenten, Russen, die zum Theater nach St. Petersburg, damals Leningrad, flogen, bekamen die Flugtickets fast umsonst. Auch die Komsomolzen, die in der Sowjetunion, besonders in Sibirien lebten. Die lebten so frei wie es in einem anderen Land kaum denkbar war. Im Westen habe ich die erste Zeit häufig draußen geschlafen und war in Sandbostel in einem alten KZ-Lager, dem Moorlager bei Bremen, wo ich – wer weiß, wie oft – von den verschiedenen Alliierten verhört wurde. ![]() Ab September 1939 nutzte die Wehrmacht das zwischen Bremen und Hamburg gelegene Lager Sandbostel zur Internierung von Kriegsgefangenen. Von 1952 bis 1960 diente es als Notaufnahmelager für männliche Flüchtlinge aus der DDR. Die dachten, ich sei eingeschleust worden, weil ich in der DDR ein Funktionär war. Das hat man ja noch bis zum KPD-Verbot 56 betrieben, mit Gefängnis.
Ab September 1939 nutzte die Wehrmacht das zwischen Bremen und Hamburg gelegene Lager Sandbostel zur Internierung von Kriegsgefangenen. Von 1952 bis 1960 diente es als Notaufnahmelager für männliche Flüchtlinge aus der DDR. Die dachten, ich sei eingeschleust worden, weil ich in der DDR ein Funktionär war. Das hat man ja noch bis zum KPD-Verbot 56 betrieben, mit Gefängnis.
Können Sie den Schritt an der Grenze noch einmal genauer beschreiben?
Der war simpel. Ich habe immer geguckt, wann die Leute von der Arbeit nach Hause gehen. Es gab ja an den Grenzübergängen noch keinen Stacheldraht, nur abschnittsweise, zum Beispiel am Potsdamer Platz, sonst waren weiße Linien gezogen. Da standen die Schupos mit Lackhelmen und auf der anderen Seite die Volksarmee. Ab fünf Uhr gingen die Arbeiter aus West-Berlin, die in Ost-Berlin arbeiteten, nach Hause. Und umgekehrt gingen die Leute aus Ost-Berlin, die in West-Berlin arbeiteten, nach Hause. Die gingen an bestimmten Grenzübergängen durch. Auch am Brandenburger Tor, wo ich der Symbolhaftigkeit wegen auch rübergehen wollte. Dort wurde der Schlagbaum runtergelassen, bis sich eine größere Menschenmenge versammelt hatte, und dann wurden Stichproben gemacht: Mal die Aktentasche aufmachen. Ich hatte in meiner Aktentasche nur eine Unterhose und meine ganzen Papiere. Die Geburtsurkunde hatte ich dabei und den Facharbeiterbrief. Das war wichtig. Damit, habe ich gedacht, kannst du dann überall arbeiten. Und dann bin ich einfach mit den anderen durchgegangen.
Sie wurden nicht kontrolliert?
Nein. Später bin ich auch einmal aus Versehen mit der S-Bahn rübergefahren. Da bin ich schlicht nicht rechtzeitig aus der S-Bahn ausgestiegen und war plötzlich wieder in Ost-Berlin.
Sie sind noch ein weiteres Mal zurückgegangen, nämlich 1955, um Ihre Schwester Rotraut zu holen. Wo sind Sie das zweite Mal rübergegangen?
In Lübeck. Da konnte man über Land gehen. Ich hatte meine Eltern drei Jahre lang nicht gesehen und habe auch erst ganz spät geschrieben, wo ich bin. Sie konnten es aber ahnen, denke ich. Ich habe sie wahrscheinlich furchtbar malträtiert. Und plötzlich stand ich da wieder in ihrer Küche und sagte zu meiner Mutter: „Wo ist denn der Vater? Und wo ist Rotraut?“ – „In der Schule“, sagte sie. Meine Schwester war damals 17 Jahre alt. Ich habe meinen Vater dann gebeten, er möchte sie holen. Meine Eltern waren wie gelähmt, als ich da plötzlich vor ihnen stand. Sie sahen mich an, als wäre ich ein Geist. Aber mein Vater marschierte dann in die Schule – nie zuvor war er mir so hörig gewesen – und kam mit Rotraut zurück. Wir haben uns so geliebt! Es war eine große Freude für uns beide. Ich sagte meinen Eltern: „Ich nehme Rotraut mit.“ Und dann sind wir gegangen. In Klütz sind wir in den Zug gestiegen, ich habe Rotraut ins Klo gesperrt und habe geguckt, wo die Leute gehen. Irgendwie hatte ich einen guten Engel, als wir uns da wieder rübergeschmuggelt haben. In der Zeit gab es schon überall Stacheldraht.
Wie lange waren Sie in Berlin, bevor Sie nach Düsseldorf gegangen sind?
Wenn überhaupt, ein halbes Jahr.
Ich meine in West-Berlin? Sie sind doch das erste Mal in Berlin über die Grenze gegangen. Sie wurden verhört und sind nach Bremen ausgeflogen worden. Sind Sie anschließend nach Berlin zurückgegangen?
Nein. Ich bin nach Bremen in dieses Lager in Sandbostel gekommen. Ich glaube, es waren drei Monate, bis ich entlassen wurde. Alle Verhöre wurden von den drei Besatzungsmitgliedern, natürlich ohne die Russen, gemeinsam geführt. Nachdem ich entlassen war, bin ich per Autostopp ins Rheinland gefahren und habe versucht, jemanden zu treffen. Meine Eltern hatten mir irgendwann einmal eine Adresse von Verwandten im Westen gegeben, aber als ich dort in meinem amerikanischen Double Coat und – da ich draußen geschlafen hatte – speckig, voller Läuse und Flöhe vor der Tür stand, haben sie mir nicht aufgemacht. Ich konnte sie hinter der verschlossenen Tür reden hören und habe mich dann zu erkennen gegeben. Irgendwann öffnete dann die Tochter und sagte: „Wir gehen nach draußen auf die Straße.“ Wie einem Penner, der ich ja war, wollte sie mir etwas Geld geben. Ich habe es nicht genommen und bin weitergezogen. Das war der einzige Kontakt, diese entfernten Verwandten. Sonst gab es niemanden.
Sie kannten im Westen keinen einzigen Menschen?
Nein, keinen einzigen. Nur Pankok. In Düsseldorf habe ich in Ruinen geschlafen. Die Innenstadt war stark bombardiert worden. 90 Prozent waren zerstört, wie in Köln auch. Man konnte aber unten, Parterre oder in den Kellern, wo die Leute lebten, irgendwo in einer Ecke auf der Zeitung liegen. Das ging ganz gut. Das war eigentlich auch normal, nicht so wie heute: „Da liegen die Penner auf der Straße.“
Sie sagten vorhin, die Kunst war für Sie schon überwunden, warum wollten Sie dann doch an eine Akademie? Oder ging es Ihnen tatsächlich primär um Pankok?
Es war Pankok, der mir mit seinem künstlerischen Ausdruck vermittelte, dass Kunst auch im Sinne von Agitation verstanden werden kann. Später habe ich das natürlich mit Eindrücken von Wladimir Tatlin ![]() Wladimir Jewgrafowitsch Tatlin (1885 Moskau – 1953 Moskau) war unter anderem Maler, Bildhauer, Bühnenbildner und Tänzer. Er zählt zu den zentralen Figuren der russischen Avantgarde. und dem ganzen revolutionären Programm, das er mit Kleidern entwickelt hat – das waren so graue Kleider –, erfahren – Beuys hat das ja alles übernommen. Tatlin ist mit Zügen durch Russland gefahren, Propagandazüge mit Ausstellungen in den Waggons. Und dann natürlich Majakowski: „Die Poesie wird mit dem Hammer gemacht.“
Wladimir Jewgrafowitsch Tatlin (1885 Moskau – 1953 Moskau) war unter anderem Maler, Bildhauer, Bühnenbildner und Tänzer. Er zählt zu den zentralen Figuren der russischen Avantgarde. und dem ganzen revolutionären Programm, das er mit Kleidern entwickelt hat – das waren so graue Kleider –, erfahren – Beuys hat das ja alles übernommen. Tatlin ist mit Zügen durch Russland gefahren, Propagandazüge mit Ausstellungen in den Waggons. Und dann natürlich Majakowski: „Die Poesie wird mit dem Hammer gemacht.“ ![]() Wladimir Wladimirowitsch Majakowski (1893 Bagdadi, Russisches Kaiserreich, heute Georgien – 1930 Moskau) war ein Dichter und führender Vertreter des russischen Futurismus. In seiner Arbeit bezog er sich unter anderem auf die Gedanken Leo Trotzkis, der in seinen Schriften anmerkte, dass „die Kunst kein Spiegel sei, den man der Wirklichkeit vorhält, sondern ein Hammer, mit dem man sie schmiedet“. Vgl. Leo Trotzki, „Literatur und Revolution“, Essen 1994, S. 141. Das hat mich alles sehr geprägt. Pankok war Antifaschist. Er hatte Malverbot. Das war eigentlich schon ein Zertifikat. Er war der einzige Nichtnazi – bis auf Ewald Mataré,
Wladimir Wladimirowitsch Majakowski (1893 Bagdadi, Russisches Kaiserreich, heute Georgien – 1930 Moskau) war ein Dichter und führender Vertreter des russischen Futurismus. In seiner Arbeit bezog er sich unter anderem auf die Gedanken Leo Trotzkis, der in seinen Schriften anmerkte, dass „die Kunst kein Spiegel sei, den man der Wirklichkeit vorhält, sondern ein Hammer, mit dem man sie schmiedet“. Vgl. Leo Trotzki, „Literatur und Revolution“, Essen 1994, S. 141. Das hat mich alles sehr geprägt. Pankok war Antifaschist. Er hatte Malverbot. Das war eigentlich schon ein Zertifikat. Er war der einzige Nichtnazi – bis auf Ewald Mataré, ![]() Ewald Mataré (1887 Aachen-Burtscheid – 1965 Büderich) war Bildhauer und Grafiker. Er wurde in den 1920er-Jahren vor allem durch seine Tierplastiken bekannt. Auf Empfehlung von Paul Klee kam Mataré 1932 als Professor an die Kunstakademie Düsseldorf und wurde nur ein Jahr später, auf Forderung der Nationalsozialisten hin, seines Amts enthoben, und seine öffentlich ausgestellten Plastiken wurden vernichtet. Nach Kriegsende rief man ihn zurück an die Akademie. Besonderen Einfluss übte Mataré auf seinen Schüler und Assistenten Joseph Beuys aus, der ihn auch bei der Fertigstellung seines bekanntesten Werks, der Gestaltung der Kölner Domtüren, unterstützte. glaube ich –, alle anderen, die an der Akademie lehrten, waren Nazis. In der DDR waren alle Lehrer entlassen worden, weil sie Nazis waren. Deshalb hatten wir zwei Jahre lang keine Schule. Auch die Juristen wurden entlassen, allerdings mit Ausnahmen, wie man später festgestellt hat. Das war in der DDR anders als in Westdeutschland.
Ewald Mataré (1887 Aachen-Burtscheid – 1965 Büderich) war Bildhauer und Grafiker. Er wurde in den 1920er-Jahren vor allem durch seine Tierplastiken bekannt. Auf Empfehlung von Paul Klee kam Mataré 1932 als Professor an die Kunstakademie Düsseldorf und wurde nur ein Jahr später, auf Forderung der Nationalsozialisten hin, seines Amts enthoben, und seine öffentlich ausgestellten Plastiken wurden vernichtet. Nach Kriegsende rief man ihn zurück an die Akademie. Besonderen Einfluss übte Mataré auf seinen Schüler und Assistenten Joseph Beuys aus, der ihn auch bei der Fertigstellung seines bekanntesten Werks, der Gestaltung der Kölner Domtüren, unterstützte. glaube ich –, alle anderen, die an der Akademie lehrten, waren Nazis. In der DDR waren alle Lehrer entlassen worden, weil sie Nazis waren. Deshalb hatten wir zwei Jahre lang keine Schule. Auch die Juristen wurden entlassen, allerdings mit Ausnahmen, wie man später festgestellt hat. Das war in der DDR anders als in Westdeutschland.
Was genau haben Sie an der Akademie gesucht?
Ganz einfach gesagt: eine Art Bestätigung. Vielleicht war es auch zum Teil der dumme Gedanke, einen akademischen Beweis erlangen zu wollen. So wie man einen Schulabschluss macht. Das war ein Drang. Aufgrund der ländlichen Herkunft war ich doch mit vielen Komplexen behaftet. Ich hätte auch in der DDR ein Studium abschließen können. Dort wäre ich aber in einen Sog geraten, die Kunst mit einem postkünstlerischen Ausdruck des 19. Jahrhunderts zu verquicken – wie es dann in der Bundesrepublik nach 1968 einsetzte. In der DDR aber gab es das schon nach 53.
Können Sie die Stimmung, auf die Sie im Westen getroffen sind, beschreiben? Sie haben sich anfangs vor allen Dingen auch mit anderen Künstlern aus dem ehemaligen Osten zusammengetan.
Ja, das wohl. Ich lernte hier als Student Gotthard Graubner aus Sachsen, Raimund Girke und Sigmar Polke aus Schlesien und Gerhard Richter aus Dresden kennen. Richter kam ja 61, kurz bevor die Mauer gebaut wurde. Es gab außerdem viele Zurückgekehrte oder durch die Kulturbesatzung Hinzugezogene. John Anthony Thwaites ![]() John Anthony Thwaites (1909 Kensington, Großbritannien – 1981 Leienkaul) war ein Kunstkritiker und Publizist. 1949 gründete er gemeinsam mit dem Maler Rupprecht Geiger die Künstlergruppe ZEN 49 in München. 1955 verlagerte sich sein Lebensmittelpunkt nach Düsseldorf, wo er insbesondere die Künstler der Gruppe 53 sowie die Entwicklung des ZERO-Umfelds begleitete. Seine journalistische Arbeit trug wesentlich zur öffentlichen Wahrnehmung der deutschen Nachkriegskunst bei. zum Beispiel machte hier ein Kulturprogramm für die Engländer. Düsseldorf war ja englische Zone. Mit Thwaites war ich sehr befreundet. Er offenbarte auch vieles, was die westliche Entwicklung bedeutete und wie er Deutschland aus seiner Soldatenzeit als Kulturreporter erlebt hatte. Wie er Deutschland von außen sah. Er war ganz wichtig. Ich könnte viele aufzählen, die für mich eine Rolle spielten. Robert Lewandowski (Monsieur Le Vent) zum Beispiel, ein jüdischer Freund, der mir sein Haus in Südfrankreich zur Verfügung stellte, wo ich viel Zeit verbrachte, per Autostopp hinfuhr, und schließlich auch Pablo Picasso und Jean Cocteau kennenlernte.
John Anthony Thwaites (1909 Kensington, Großbritannien – 1981 Leienkaul) war ein Kunstkritiker und Publizist. 1949 gründete er gemeinsam mit dem Maler Rupprecht Geiger die Künstlergruppe ZEN 49 in München. 1955 verlagerte sich sein Lebensmittelpunkt nach Düsseldorf, wo er insbesondere die Künstler der Gruppe 53 sowie die Entwicklung des ZERO-Umfelds begleitete. Seine journalistische Arbeit trug wesentlich zur öffentlichen Wahrnehmung der deutschen Nachkriegskunst bei. zum Beispiel machte hier ein Kulturprogramm für die Engländer. Düsseldorf war ja englische Zone. Mit Thwaites war ich sehr befreundet. Er offenbarte auch vieles, was die westliche Entwicklung bedeutete und wie er Deutschland aus seiner Soldatenzeit als Kulturreporter erlebt hatte. Wie er Deutschland von außen sah. Er war ganz wichtig. Ich könnte viele aufzählen, die für mich eine Rolle spielten. Robert Lewandowski (Monsieur Le Vent) zum Beispiel, ein jüdischer Freund, der mir sein Haus in Südfrankreich zur Verfügung stellte, wo ich viel Zeit verbrachte, per Autostopp hinfuhr, und schließlich auch Pablo Picasso und Jean Cocteau kennenlernte.
Wie sind Ihnen die Westdeutschen begegnet? Wurden Sie als Immigrant behandelt?
Nein. Ich habe auch keinen Flüchtlingsausweis beantragt und auch keinen Ausgleich bekommen, wie Richter und die anderen es gemacht haben. Ich dachte: „Wenn ich gehe, gehe ich auf eigenes Risiko und will dafür vom Staat nicht honoriert werden.“ Ich habe auch nie einen Preis angenommen. Anfangs habe ich sogar gesagt: „In München, in der Stadt der Bewegung, wirst du nie ausstellen.“ Das waren alles Vorurteile, die man hatte. In Düsseldorf haben wir dann die Freitagsgesellschaft mitbegründet. Mit Bernhard Pfau, ![]() Bernhard Pfau (1902 Wolfach – 1989 Düsseldorf) war ein deutscher Architekt und Architekturtheoretiker, dem als Mitglied des Düsseldorfer Architektenrings eine wesentliche Rolle im Düsseldorfer Architektenstreit zukam. Anfang der 1950er-Jahre entbrannte dieser hinsichtlich des Wiederaufbaus der kriegszerstörten Stadt zwischen liberalen Architekten und ehemals im Nationalsozialismus tätigen Bauleitern. einem guten Architekten, der aus Paris emigriert war und unter anderem das Düsseldorfer Schauspielhaus gebaut hat, und Jean-Pierre Wilhelm,
Bernhard Pfau (1902 Wolfach – 1989 Düsseldorf) war ein deutscher Architekt und Architekturtheoretiker, dem als Mitglied des Düsseldorfer Architektenrings eine wesentliche Rolle im Düsseldorfer Architektenstreit zukam. Anfang der 1950er-Jahre entbrannte dieser hinsichtlich des Wiederaufbaus der kriegszerstörten Stadt zwischen liberalen Architekten und ehemals im Nationalsozialismus tätigen Bauleitern. einem guten Architekten, der aus Paris emigriert war und unter anderem das Düsseldorfer Schauspielhaus gebaut hat, und Jean-Pierre Wilhelm, ![]() Jean-Pierre Wilhelm (1912 Düsseldorf – 1968 Düsseldorf) war ein deutscher Galerist, Kunstkritiker und Übersetzer. Gemeinsam mit Manfred de la Motte gründete er 1957 in der Kaiserstraße 22 in Düsseldorf-Pempelfort die Galerie 22, die bald zu einem wichtigen Schauplatz der rheinischen Avantgarde avancierte. der auch aus Paris kam. Das waren wichtige Vermittler in dieser Zeit. Wilhelm hat schon ab 1958 John Cage und etwas später Cy Twombly ausgestellt.
Jean-Pierre Wilhelm (1912 Düsseldorf – 1968 Düsseldorf) war ein deutscher Galerist, Kunstkritiker und Übersetzer. Gemeinsam mit Manfred de la Motte gründete er 1957 in der Kaiserstraße 22 in Düsseldorf-Pempelfort die Galerie 22, die bald zu einem wichtigen Schauplatz der rheinischen Avantgarde avancierte. der auch aus Paris kam. Das waren wichtige Vermittler in dieser Zeit. Wilhelm hat schon ab 1958 John Cage und etwas später Cy Twombly ausgestellt. ![]() „Music Walk“, Galerie 22, Düsseldorf, 14. Oktober 1958, mit John Cage, Cornelius Cardew und David Tudor; „Rauschenberg, Twombly. Zwei amerikanische Maler“, Galerie 22, Düsseldorf, 22. April – 30. Mai 1960. Dann gab es Mary Bauermeister
„Music Walk“, Galerie 22, Düsseldorf, 14. Oktober 1958, mit John Cage, Cornelius Cardew und David Tudor; „Rauschenberg, Twombly. Zwei amerikanische Maler“, Galerie 22, Düsseldorf, 22. April – 30. Mai 1960. Dann gab es Mary Bauermeister ![]() Mary Bauermeister (* 1934 Frankfurt am Main) studierte ab 1954 bei Max Bill und Helene Nonné-Schmidt an der Hochschule für Gestaltung Ulm, bevor sie nach Saarbrücken zu Otto Steinert wechselte. Von 1960 bis 1962 organisierte Bauermeister Konzerte und Ausstellungen in ihrem Atelier in der Lintgasse 28 in Köln. Neben Nam June Paik und John Cage beteiligten sich unter anderen auch George Brecht, Benjamin Patterson, David Tudor und La Monte Young an den Aktionen. Die Veranstaltungen gelten als wegbereitend für die Entstehung der Fluxus-Bewegung. Ab 1963 lebte Bauermeister für mehrere Jahre in New York und zeigte dort 1964 ihre erste Einzelausstellung in der Galeria Bonino. 1957 lernte Bauermeister den Komponisten Karlheinz Stockhausen kennen, mit dem sie von 1967 bis 1973 verheiratet war. und dadurch dann auch die Verbindung nach Ulm zur Hochschule, wo ich meine Freunde fand.
Mary Bauermeister (* 1934 Frankfurt am Main) studierte ab 1954 bei Max Bill und Helene Nonné-Schmidt an der Hochschule für Gestaltung Ulm, bevor sie nach Saarbrücken zu Otto Steinert wechselte. Von 1960 bis 1962 organisierte Bauermeister Konzerte und Ausstellungen in ihrem Atelier in der Lintgasse 28 in Köln. Neben Nam June Paik und John Cage beteiligten sich unter anderen auch George Brecht, Benjamin Patterson, David Tudor und La Monte Young an den Aktionen. Die Veranstaltungen gelten als wegbereitend für die Entstehung der Fluxus-Bewegung. Ab 1963 lebte Bauermeister für mehrere Jahre in New York und zeigte dort 1964 ihre erste Einzelausstellung in der Galeria Bonino. 1957 lernte Bauermeister den Komponisten Karlheinz Stockhausen kennen, mit dem sie von 1967 bis 1973 verheiratet war. und dadurch dann auch die Verbindung nach Ulm zur Hochschule, wo ich meine Freunde fand.
In Ulm war damals Max Bill.
Max Bill hatte zwei Studenten, Rolf Schroeter und Almir Mavignier. Das waren seine ersten Studenten, und sie sind dann meine Freunde geworden. In Düsseldorf hatte ich eigentlich nicht so enge Kontakte. Da war es eher auf die Akademie bezogen, die auf viele junge Leute eine große Anziehungskraft hatte. Man fand dort die Krieger wie Joseph Beuys, Norbert Kricke und Erich Reusch. Es reichte ja ein Altersunterschied von zehn Jahren – die Älteren waren alle im Krieg, Soldaten der deutschen Wehrmacht.
Wann haben Sie Beuys und Kricke kennengelernt?
Mit Beuys war ich ab Ende der 50er-Jahre befreundet. Wir haben auch Arbeiten getauscht, er hat mir einige Zeichnungen gegeben und wollte von mir im Gegenzug ein weißes Feld haben. Das hat er später an die Sammlerin Marita Richter übergeben, weil er keine Sammlung besitzen wollte.
Ihre Zeitgenossen sprechen viel über Beuys. Wie haben Sie ihn erlebt?
Er war mir als Assistent von Mataré bekannt. Beuys hat an der Tür für die Lambertuskirche in Düsseldorf gearbeitet und wahrscheinlich auch für die Tore am Dom in Köln. ![]() Ewald Mataré gestaltete von 1948 bis 1954 das Südportal des Kölner Doms. Von 1958 bis 1960 arbeitete er für das Bronzeportal der Basilika St. Lambertus in der Düsseldorfer Altstadt. Vgl. Sabine Maja Schilling, „Ewald Mataré“, Köln 1989. Er trug immer eine schwarze Jacke mit weißem Kragen. Eigentlich sah er aus wie ein Pastor, mit einem flachen Hut oder einer Baskenmütze. Er war in seinen Kreisen, die ihn verehrten, sehr theologisch eingebunden. Mir blieb das fremd. Sein Turm in Meerbusch
Ewald Mataré gestaltete von 1948 bis 1954 das Südportal des Kölner Doms. Von 1958 bis 1960 arbeitete er für das Bronzeportal der Basilika St. Lambertus in der Düsseldorfer Altstadt. Vgl. Sabine Maja Schilling, „Ewald Mataré“, Köln 1989. Er trug immer eine schwarze Jacke mit weißem Kragen. Eigentlich sah er aus wie ein Pastor, mit einem flachen Hut oder einer Baskenmütze. Er war in seinen Kreisen, die ihn verehrten, sehr theologisch eingebunden. Mir blieb das fremd. Sein Turm in Meerbusch ![]() 1958 gestaltete Joseph Beuys das Mahnmal im alten Kirchturm von Meerbusch-Büderich und installierte dort im Kircheninnenraum ein drei Meter hohes freischwebendes Eichenkruzifix. Vgl. Götz Adriani/Winfried Konnertz/Karin Thomas, „Joseph Beuys – Leben und Werk“, Köln 1986 (3. Auflage), S. 69 f. hat mich dann aber doch überzeugt. Das fand ich sehr gut. Wir begegneten uns außerdem in den Ausstellungen bei Alfred Schmela,
1958 gestaltete Joseph Beuys das Mahnmal im alten Kirchturm von Meerbusch-Büderich und installierte dort im Kircheninnenraum ein drei Meter hohes freischwebendes Eichenkruzifix. Vgl. Götz Adriani/Winfried Konnertz/Karin Thomas, „Joseph Beuys – Leben und Werk“, Köln 1986 (3. Auflage), S. 69 f. hat mich dann aber doch überzeugt. Das fand ich sehr gut. Wir begegneten uns außerdem in den Ausstellungen bei Alfred Schmela, ![]() Alfred Schmela (1918 Dinslaken – 1980 Düsseldorf) eröffnete 1957 in der Hunsrückenstraße 16–18 in Düsseldorf eine Galerie. Sein Programm umfasste wesentliche Positionen der deutschen Nachkriegskunst, darunter Joseph Beuys, Gerhard Richter sowie Künstler aus dem Umfeld der ZERO-Bewegung. Am 26. November 1965 wurde dort mit der Aktion „Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt“ unter dem Titel „Joseph Beuys … irgendein Strang …“ die erste Einzelausstellung von Joseph Beuys eröffnet. und ich folgte den Einladungen zu ihm nach Hause.
Alfred Schmela (1918 Dinslaken – 1980 Düsseldorf) eröffnete 1957 in der Hunsrückenstraße 16–18 in Düsseldorf eine Galerie. Sein Programm umfasste wesentliche Positionen der deutschen Nachkriegskunst, darunter Joseph Beuys, Gerhard Richter sowie Künstler aus dem Umfeld der ZERO-Bewegung. Am 26. November 1965 wurde dort mit der Aktion „Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt“ unter dem Titel „Joseph Beuys … irgendein Strang …“ die erste Einzelausstellung von Joseph Beuys eröffnet. und ich folgte den Einladungen zu ihm nach Hause.
Als ich an der Akademie anfing, hat ein junges Mädchen mich sofort geduzt. Ich dachte: „Mein Gott, hier sagen die Leute Du zueinander.“ Das gab es in der DDR nicht. „Genosse“ war da schon viel. Eva war die erste Studentin, die ich in der Akademie, in der Mensa kennenlernte. Dass man sich einfach hinsetzte und angesprochen wird, dieses freie Leben, dass man das, was man spürte, in Sprache überführte und dem Gegenüber mitteilte, das kannte ich überhaupt nicht. Hier wurde immer gesagt, was gedacht wurde. In der DDR hingegen sagten wir die letzten Parteitagsbeschlüsse auf, die wir alle auswendig kannten. Das ratterten wir runter. Dann gab es eine private Sprache und noch eine extra Sprache für die Eltern. Man lebte semantisch eigentlich in drei Sprachdefinitionen. Das war in der DDR normal, anders kannte ich es gar nicht.
Und im Westen war das anders?
Wenn ich redete, merkte ich, dass ich doch manchmal sehr fremd für die anderen war. Meine Formulierungen, die noch sehr vom dialektischen Denken geprägt waren. Über den Empiriokritizismus ![]() Vgl. Wladimir Iljitsch Lenin, „Materialismus und Empiriokritizismus – Kritische Bemerkungen über eine reaktionäre Philosophie“, Berlin 1952. von Lenin hatte kein Mensch gelesen.
Vgl. Wladimir Iljitsch Lenin, „Materialismus und Empiriokritizismus – Kritische Bemerkungen über eine reaktionäre Philosophie“, Berlin 1952. von Lenin hatte kein Mensch gelesen.
Ich stelle mir die Kunstszene in Düsseldorf damals sehr überschaubar vor. Wie stark waren Sie dort involviert?
Es gab immer Ablehnungen, auch von anderen Klassen. Die meisten Lehrer waren naziverdächtig, bei manchen wussten wir auch genau, dass sie Nazis waren. Wir haben das auch untersucht und den Leuten nachweisen können, dass sie Unterschlagungen gemacht haben und alles Mögliche. Wenn ich das vertiefen würde, könnte ich darüber sehr viel sagen. Jedenfalls hatten viele dieser Professoren eine nationalsozialistische Vergangenheit, und die hatten sie auch noch nicht ganz abgelegt.
Die Pankok-Klasse wurde immer als Genieort bezeichnet. Wenn ich in die Klasse kam, habe ich einen Balken unter die Türklinke gerammt, sodass keiner reinkam. Dann habe ich eine Mulde mit Lehm gemacht, den man sonst zum Modellieren benutzt, und da haben wir Wasser reingegossen, damit hatten wir einen See. Die Aktmodelle habe ich mit Lehm beschmiert. Und dann habe ich einen Schrank auf die Staffelei gestellt und auf die Rückseite des Schranks habe ich mit Kohle große Akte, die wie Lavamassen aus der Erde kamen – aus dem Vulkan des kleinen Sees – gezeichnet. Das waren die ersten Arbeiten, die ich gemacht habe.
Und Pankok fand das gut, was Sie gemacht haben?
Der hat sich dazu nicht geäußert. Als ich das erste Mal an die Akademie kam, bin ich gleich zu ihm hin. Er fragte mich: „Woher kommst du denn?“ Er sagte „du“. Sagte ich: „Aus der DDR vom Land.“ Er hat sich alles angehört, und dann hat er mich angeguckt und gesagt: „Am besten gehst du wieder zurück. Hier wirst du nur verdorben.“
Ihm gefiel Ihre Haltung?
Das weiß ich nicht. Ich habe einen solchen Weinkrampf bekommen. Es hat mich fast zerrissen vor Schmerz. Wie die weinenden Frauen von Picasso. Ich bin richtiggehend zusammengebrochen. Daraufhin bekam Pankok solche Angst, dass er aus der Tür lief. Ich saß fassungslos da. Als er zurückkam, hatte er einen Zettel in der Hand und sagte: „Ich habe dich jetzt eingeschrieben. Wo schläfst du denn?“ – „Auf der Kö [Königsallee], in der Ruine.“ Er sagte: „Wir können hier eine Matratze hinlegen, das ist für die Aktmodelle. Dann kannst du hier schlafen.“ So bin ich in Düsseldorf aufgenommen worden. Später hatte ich ein Meisteratelier, im Raum 110. Sehr groß, mit eigenen Aktmodell. Dort konnte ich alles abschließen, und es durfte kein anderer Student rein.
So sehr hat es sich verändert! Es muss einem die letzte Hoffnung nehmen, wenn man ohne Haus und ohne Mittel sein Vorbild trifft, und das einem rät: „Geh zurück.“
Ja, er hat das auch erklärt, er sagte: „Picasso kann dir kein Vorbild sein.“ Vielleicht hatte er in dem Fall ja recht, dass es sehr verführerisch ist, dass aber diese aus der Kunstgeschichte abgewandelte Figuration, die Picasso im Louvre studiert und in seine Malerei übertragen hatte, nicht die Quelle der Kunst sein konnte. Wohl für Picasso, Pankok hat das auch nicht abgelehnt, aber er war der Meinung, für einen Studierenden könne diese Methode nicht beispielhaft sein. Es komme ja doch nur Akademismus dabei heraus. Mit destruktiven, amorphen Erscheinungsbildern von Mensch und Natur – von denen es ja durchaus Beispiele in der Malerei gibt.
Pankok, Ihr Professor, hat sich aber zu Ihren Werken nicht geäußert?
Nein, er hat dagesessen und beobachtet. Wenn ich anfing zu reden, entwickelte er auch eine Scheu. Denn er konnte ja nicht in demselben Jargon reden, dem DDR-Jargon, dem Bildungsjargon von Funktionären. Das habe ich deutlich gespürt. Da war er peinlich berührt, wenn ich aus der Prägung und Gehirnwäsche der DDR heraus anfing zu quatschen. Auch ich habe es meinerseits mit Scheu wahrgenommen. Irgendwann aber ging die Verständigung besser, und ich habe mich auch gewandelt. Die Empathie Pankoks habe ich doch gespürt und auch ein bisschen Vaterschaft. Das ist für ein künstlerisches Handeln tragend, das sehe ich bis heute so. Wenn man das, was man empfindet, bildhaft formulieren kann und der Rezipient die tiefen Empfindungen desjenigen, der es gemalt hat, wahrnehmen kann, dann ist es, glaube ich, ein gelungenes Werk. In der Wechselbeziehung zwischen Betrachter und Schöpfer von Bildern. Einmal hat Pankok mich eingeladen: „Sonntag kommst du doch mal zu uns zum Kaffee.“ Er wohnte in Oberkassel, was dann auch meine Heimat geworden ist. Hulda, seine Frau, war die Schwester von Heinrich Droste, dem Verleger. ![]() Hulda Pankok (geb. Hulda Droste; 1895 Bochum – 1985 Drevenack) war eine deutsche Journalistin und Gründerin des Drei-Eulen-Verlags. Sie war die Schwester von Heinrich Droste (1880–1958), dem Wirtschaftsjournalisten und Gründer des Droste-Verlags. Jedenfalls kam ich zu Besuch, und sie hatten mir einen Gugelhupf oder einen marmorierten Topfkuchen mit einem Loch in der Mitte gebacken. Wir haben gegessen und erzählt. Hulda war eine sehr innige Frau. Sie lebten in ihrem eigenen Universum und verkörperten, was mich besonders berührte, die Zeit der 20er-Jahre. Das war für mich insofern wichtig, als ich aus Stralsund das erste Haus kannte, das Leonhard Tietz
Hulda Pankok (geb. Hulda Droste; 1895 Bochum – 1985 Drevenack) war eine deutsche Journalistin und Gründerin des Drei-Eulen-Verlags. Sie war die Schwester von Heinrich Droste (1880–1958), dem Wirtschaftsjournalisten und Gründer des Droste-Verlags. Jedenfalls kam ich zu Besuch, und sie hatten mir einen Gugelhupf oder einen marmorierten Topfkuchen mit einem Loch in der Mitte gebacken. Wir haben gegessen und erzählt. Hulda war eine sehr innige Frau. Sie lebten in ihrem eigenen Universum und verkörperten, was mich besonders berührte, die Zeit der 20er-Jahre. Das war für mich insofern wichtig, als ich aus Stralsund das erste Haus kannte, das Leonhard Tietz ![]() Leonhard Tietz (1849 Brinbaum, Posen, heute Polen – 1914 Köln) war ein deutscher Kaufmann und Begründer der Warenhauskette Tietz Kaufhaus. Aufgrund ihres jüdischen Glaubens wurde die Kaufmannsfamilie Tietz 1933 durch die Nationalsozialisten enteignet. Die 43 Tietz-Kaufhäuser gingen anschließend in die Westdeutsche Kaufhof AG über. Vgl. Nils Busch-Petersen, „Leonhard Tietz: Fuhrmannssohn und Warenhauskönig. Von der Warthe an den Rhein“, Jüdische Miniaturen Bd. 92, Berlin 2010. gebaut hatte. In Düsseldorf gab es ein Haus, das Peter Behrens wiederum für Tietz gebaut hat. Durch die Enteignung 1936 wurde es dann der Kaufhof, und dort war die erste Surrealistenausstellung mit Pankok und Gert Heinrich Wollheim.
Leonhard Tietz (1849 Brinbaum, Posen, heute Polen – 1914 Köln) war ein deutscher Kaufmann und Begründer der Warenhauskette Tietz Kaufhaus. Aufgrund ihres jüdischen Glaubens wurde die Kaufmannsfamilie Tietz 1933 durch die Nationalsozialisten enteignet. Die 43 Tietz-Kaufhäuser gingen anschließend in die Westdeutsche Kaufhof AG über. Vgl. Nils Busch-Petersen, „Leonhard Tietz: Fuhrmannssohn und Warenhauskönig. Von der Warthe an den Rhein“, Jüdische Miniaturen Bd. 92, Berlin 2010. gebaut hatte. In Düsseldorf gab es ein Haus, das Peter Behrens wiederum für Tietz gebaut hat. Durch die Enteignung 1936 wurde es dann der Kaufhof, und dort war die erste Surrealistenausstellung mit Pankok und Gert Heinrich Wollheim. ![]() Gert Heinrich Wollheim (1894 Loschwitz – 1974 New York) war ein deutscher Vertreter des Expressionismus und Mitinitiator des 1922 in Düsseldorf ausgerichteten „1. Kongress der Union fortschrittlicher internationaler Künstler“. Unter den Nationalsozialisten wurde Wollheim als „entarteter Künstler“ verfolgt und emigrierte daraufhin über Frankreich nach New York. Wollheim schätze ich auch sehr. Das war die Brücke für mich, um in das Kontinuum der 20er-Jahre, in heimatliche und städtische, kleinbürgerliche Bezüge einzutauchen, um mir eine Beteiligung zu verschaffen, damit ich auch im Westen die historischen Wurzeln wahrnehmen konnte. Aus diesem Grund haben wir die Freitagsgesellschaft gegründet, die jeden Freitag zusammenkam. Die wurde dann mit dem Kulturbund verbunden und 1958 verboten, weil die kommunistische Partei verboten wurde.
Gert Heinrich Wollheim (1894 Loschwitz – 1974 New York) war ein deutscher Vertreter des Expressionismus und Mitinitiator des 1922 in Düsseldorf ausgerichteten „1. Kongress der Union fortschrittlicher internationaler Künstler“. Unter den Nationalsozialisten wurde Wollheim als „entarteter Künstler“ verfolgt und emigrierte daraufhin über Frankreich nach New York. Wollheim schätze ich auch sehr. Das war die Brücke für mich, um in das Kontinuum der 20er-Jahre, in heimatliche und städtische, kleinbürgerliche Bezüge einzutauchen, um mir eine Beteiligung zu verschaffen, damit ich auch im Westen die historischen Wurzeln wahrnehmen konnte. Aus diesem Grund haben wir die Freitagsgesellschaft gegründet, die jeden Freitag zusammenkam. Die wurde dann mit dem Kulturbund verbunden und 1958 verboten, weil die kommunistische Partei verboten wurde. ![]() Der Kulturbund wurde im Juni 1945 zur demokratischen Neustrukturierung der intellektuellen und künstlerischen Szenen von der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) gegründet. Ab 1958 unterlag dieser in den westlichen Besatzungszonen einem Verbot. Vgl. Teresa Brinkel, „Volkskundliche Wissensproduktion in der DDR. Zur Geschichte eines Faches und seiner Abwicklung“, Münster 2012, S. 162 f. Ich arbeitete damals noch für den „Deutschen Michel“,
Der Kulturbund wurde im Juni 1945 zur demokratischen Neustrukturierung der intellektuellen und künstlerischen Szenen von der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) gegründet. Ab 1958 unterlag dieser in den westlichen Besatzungszonen einem Verbot. Vgl. Teresa Brinkel, „Volkskundliche Wissensproduktion in der DDR. Zur Geschichte eines Faches und seiner Abwicklung“, Münster 2012, S. 162 f. Ich arbeitete damals noch für den „Deutschen Michel“, ![]() „Der Deutsche Michel“ war eine linksgerichtete Satirezeitschrift, die von 1954 bis 1957 von Johann Fladung in Düsseldorf verlegt wurde. der war so ähnlich wie „Krokodil“ in Moskau, eine Satirezeitung. Da habe ich sogar einmal ein Titelbild gemacht, und im Innenteil habe ich Witze aus meiner DDR-Zeit veröffentlicht. Das sind Geschichtsereignisse, die kaum jemand wahrgenommen hat. Ich aber doch besonders, weil ich eben aus der DDR kam. Als ich meine erste Ausstellung in Istanbul hatte,
„Der Deutsche Michel“ war eine linksgerichtete Satirezeitschrift, die von 1954 bis 1957 von Johann Fladung in Düsseldorf verlegt wurde. der war so ähnlich wie „Krokodil“ in Moskau, eine Satirezeitung. Da habe ich sogar einmal ein Titelbild gemacht, und im Innenteil habe ich Witze aus meiner DDR-Zeit veröffentlicht. Das sind Geschichtsereignisse, die kaum jemand wahrgenommen hat. Ich aber doch besonders, weil ich eben aus der DDR kam. Als ich meine erste Ausstellung in Istanbul hatte, ![]() „Günther Uecker. Bibliophile Werke“, Deutsches Kulturinstitut/Türkisch-Deutscher Kulturbeirat, Ankara/Istanbul, 1985. nahm mich die Übersetzerin an die Hand und sagte: „Gehen wir mal vor die Tür.“ Wir setzten uns draußen auf die Stufen, und dann sagte sie: „Ein Mann fällt vom Dach. Leute laufen zusammen und sagen: ‚Ein Arzt muss her, ein Arzt muss her, ein Doktor.‘ Dann sagt der Mann, der vom Dach gefallen ist: ‚Nein, ich will keinen Doktor! Ich brauche jemanden, der auch vom Dach gefallen ist.‘“ Sie fuhr fort: „Wir waren alle mindestens zwei Jahre im Gefängnis. Das ist unser Zertifikat.“ Das konnte man nicht verstehen, wenn man aus Deutschland kam. Aber da ich ja vom Osten schon geprägt war, war mir das nicht fremd.
„Günther Uecker. Bibliophile Werke“, Deutsches Kulturinstitut/Türkisch-Deutscher Kulturbeirat, Ankara/Istanbul, 1985. nahm mich die Übersetzerin an die Hand und sagte: „Gehen wir mal vor die Tür.“ Wir setzten uns draußen auf die Stufen, und dann sagte sie: „Ein Mann fällt vom Dach. Leute laufen zusammen und sagen: ‚Ein Arzt muss her, ein Arzt muss her, ein Doktor.‘ Dann sagt der Mann, der vom Dach gefallen ist: ‚Nein, ich will keinen Doktor! Ich brauche jemanden, der auch vom Dach gefallen ist.‘“ Sie fuhr fort: „Wir waren alle mindestens zwei Jahre im Gefängnis. Das ist unser Zertifikat.“ Das konnte man nicht verstehen, wenn man aus Deutschland kam. Aber da ich ja vom Osten schon geprägt war, war mir das nicht fremd.
Sie haben Graubner, Polke und Richter erwähnt. Sind Sie der Meinung, dass diese Künstler eine ähnlich starke Verbindung zur DDR hatten?
Das weiß ich nicht. Sie sind andere Wege gegangen. Sie haben nach 1953 ihre Kunstausbildung begonnen. Richter hat auch Bühnen- und Wandbilder gemacht. ![]() Gerhard Richter studierte von 1953 bis 1956 bei Heinz Lohmar an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden Wandmalerei und schloss das Studium mit einer Wandarbeit im Deutschen Hygienemuseum ab. Vgl. Dietmar Elger, „Gerhard Richter. Maler“, Köln 2002, S. 20 ff. Gotthard Graubner war in Berlin und in Dresden.
Gerhard Richter studierte von 1953 bis 1956 bei Heinz Lohmar an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden Wandmalerei und schloss das Studium mit einer Wandarbeit im Deutschen Hygienemuseum ab. Vgl. Dietmar Elger, „Gerhard Richter. Maler“, Köln 2002, S. 20 ff. Gotthard Graubner war in Berlin und in Dresden. ![]() Gotthard Graubner studierte von 1947 bis 1948 an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin. Anschließend wechselte er an die Hochschule für Bildende Künste in Dresden, wo er – mit einigen Unterbrechungen – sein Studium bis zur Übersiedlung nach Düsseldorf im Jahr 1954 fortsetzte. Sie waren alle in der künstlerischen Ausbildung viel weiter, ich hatte ja eher die wissenschaftlich-theoretische Ausbildung des dialektischen Materialismus als Agitation/Propaganda, um die Vorstellung des Bürgerlichen zu überwinden, die aber nach Stalins Tod 1953 überall eine Revision erfahren hat.
Gotthard Graubner studierte von 1947 bis 1948 an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin. Anschließend wechselte er an die Hochschule für Bildende Künste in Dresden, wo er – mit einigen Unterbrechungen – sein Studium bis zur Übersiedlung nach Düsseldorf im Jahr 1954 fortsetzte. Sie waren alle in der künstlerischen Ausbildung viel weiter, ich hatte ja eher die wissenschaftlich-theoretische Ausbildung des dialektischen Materialismus als Agitation/Propaganda, um die Vorstellung des Bürgerlichen zu überwinden, die aber nach Stalins Tod 1953 überall eine Revision erfahren hat.
Das heißt, Sie haben mit diesen Künstlern auch später nicht über Ihre gemeinsame Herkunft gesprochen?
Nein, gar nicht. K.O. Götz ![]() K.O. Götz (eigtl. Karl Otto Götz; 1914 Aachen – 2017 Niederbreitbach) zählt zu den Hauptvertretern des deutschen Informel. Ab 1952 gehörte er gemeinsam mit Otto Greis, Heinz Kreutz und Bernard Schultze zur Gruppe Quadriga, zu der sich die deutschen informellen Maler zusammengeschlossen hatten. Er nahm an der „documenta 2“ (1959) sowie an den Biennalen von Venedig in den Jahren 1958 und 1968 teil. Von 1959 bis 1979 war Götz Professor an der Kunstakademie Düsseldorf. Unter anderen gehörten auch Sigmar Polke, Gerhard Richter und Franz Erhard Walther zu seinen Schülern. spielte natürlich eine große Rolle. Bei ihm in der Klasse waren Richter, Polke und auch Raimund Girke. Das war wohl die einzige Klasse, in der sich eine Gruppe von Malern gebildet hat. Bei Bruno Goller,
K.O. Götz (eigtl. Karl Otto Götz; 1914 Aachen – 2017 Niederbreitbach) zählt zu den Hauptvertretern des deutschen Informel. Ab 1952 gehörte er gemeinsam mit Otto Greis, Heinz Kreutz und Bernard Schultze zur Gruppe Quadriga, zu der sich die deutschen informellen Maler zusammengeschlossen hatten. Er nahm an der „documenta 2“ (1959) sowie an den Biennalen von Venedig in den Jahren 1958 und 1968 teil. Von 1959 bis 1979 war Götz Professor an der Kunstakademie Düsseldorf. Unter anderen gehörten auch Sigmar Polke, Gerhard Richter und Franz Erhard Walther zu seinen Schülern. spielte natürlich eine große Rolle. Bei ihm in der Klasse waren Richter, Polke und auch Raimund Girke. Das war wohl die einzige Klasse, in der sich eine Gruppe von Malern gebildet hat. Bei Bruno Goller, ![]() Bruno Goller (1901 Gummersbach – 1998 Düsseldorf) war ein deutscher Maler, der ab 1927 der Düsseldorfer Künstlergruppe Das Junge Rheinland angehörte. Von 1953 bis 1964 lehrte er als Professor für Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf. bei dem Konrad Klapheck in der Klasse war, natürlich auch. Bei Pankok waren mehr Existenzialisten, wie man sie damals nannte, oder wie Heinz Mack es auch zum Ausdruck gebracht hat, das war die „Geniehöhle“. Das waren alles Einzelgänger. Mehr Zigeuner. Pankok hat auch Zigeuner in die Klasse geholt, und wir haben sie gezeichnet und gemalt. Er hatte ein ganz anderes Programm. Ihm ging es um die Vermenschlichung, darum, die Begabung nicht zu vergeuden und sie für die menschliche Annäherung zu verwenden. Da herrschte ein sehr intimes Sozialgefühl, das habe ich sehr geschätzt.
Bruno Goller (1901 Gummersbach – 1998 Düsseldorf) war ein deutscher Maler, der ab 1927 der Düsseldorfer Künstlergruppe Das Junge Rheinland angehörte. Von 1953 bis 1964 lehrte er als Professor für Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf. bei dem Konrad Klapheck in der Klasse war, natürlich auch. Bei Pankok waren mehr Existenzialisten, wie man sie damals nannte, oder wie Heinz Mack es auch zum Ausdruck gebracht hat, das war die „Geniehöhle“. Das waren alles Einzelgänger. Mehr Zigeuner. Pankok hat auch Zigeuner in die Klasse geholt, und wir haben sie gezeichnet und gemalt. Er hatte ein ganz anderes Programm. Ihm ging es um die Vermenschlichung, darum, die Begabung nicht zu vergeuden und sie für die menschliche Annäherung zu verwenden. Da herrschte ein sehr intimes Sozialgefühl, das habe ich sehr geschätzt.
Mit wem aus Ihrer Klasse oder überhaupt an der Akademie haben Sie sich in der Zeit über die Kunst ausgetauscht?
Genau das hat mir gefehlt und war der Grund, dass ich nach Südfrankreich – in der Regel – getrampt bin.
Weil Sie hier niemanden gefunden haben?
Nicht so richtig. In Antwerpen war ich mit Jef Verheyen, in Amsterdam mit Willem Sandberg ![]() Willem Sandberg (1897 Amersfoort – 1984 Amsterdam) war ein niederländischer Grafiker und Kurator, der von 1945 bis 1962 Direktor des Stedelijk Museum in Amsterdam war. sehr gut befreundet. Er erklärte mir vieles. Er hatte auch die erste Kiste mit Malewitsch-Werken, die irgendwo im Schwäbischen versteckt waren, geöffnet.
Willem Sandberg (1897 Amersfoort – 1984 Amsterdam) war ein niederländischer Grafiker und Kurator, der von 1945 bis 1962 Direktor des Stedelijk Museum in Amsterdam war. sehr gut befreundet. Er erklärte mir vieles. Er hatte auch die erste Kiste mit Malewitsch-Werken, die irgendwo im Schwäbischen versteckt waren, geöffnet. ![]() 1958 erwarb das Stedelijk Museum unter der Federführung von Willem Sandberg 86 Werke von Kasimir Malewitsch, die der Architekt Hugo Häring 1943 im schwäbischen Biberach vor den Nationalsozialisten versteckt hatte. Vgl. Carsten von Holm/Jörg Schmitt, „Beutekunst – Das Fell der Bären“, in: „Der Spiegel“, Nr. 17, 19.04.2004, S. 62–68, hier S. 68. Die Werke sollten ursprünglich für eine Ausstellung nach Paris gehen, und haben dann den Krieg in Oberschwaben überdauert. Sandberg hat mir von Briefen zwischen Władysław Strzemiński
1958 erwarb das Stedelijk Museum unter der Federführung von Willem Sandberg 86 Werke von Kasimir Malewitsch, die der Architekt Hugo Häring 1943 im schwäbischen Biberach vor den Nationalsozialisten versteckt hatte. Vgl. Carsten von Holm/Jörg Schmitt, „Beutekunst – Das Fell der Bären“, in: „Der Spiegel“, Nr. 17, 19.04.2004, S. 62–68, hier S. 68. Die Werke sollten ursprünglich für eine Ausstellung nach Paris gehen, und haben dann den Krieg in Oberschwaben überdauert. Sandberg hat mir von Briefen zwischen Władysław Strzemiński ![]() Władysław Strzemiński (1893 Minsk – 1952 Łódź) war ein Maler und Kunsttheoretiker, der den Konstruktivisten und Suprematisten nahestand. und Malewitsch erzählt, in denen Strzemiński Malewitsch vorwirft, dass er noch ein sehr stark symbolistisch befangener Maler sei, aber doch mit seinen strukturellen Reibungen und seiner Nicht-Dominanz eines herausragenden Gegenstands im Bild die Egalität der Wahrnehmung herbeiführe. Das ist jetzt nur interpretiert, nicht zitiert. Strzemiński hat mich dann sehr beschäftigt und auch geprägt.
Władysław Strzemiński (1893 Minsk – 1952 Łódź) war ein Maler und Kunsttheoretiker, der den Konstruktivisten und Suprematisten nahestand. und Malewitsch erzählt, in denen Strzemiński Malewitsch vorwirft, dass er noch ein sehr stark symbolistisch befangener Maler sei, aber doch mit seinen strukturellen Reibungen und seiner Nicht-Dominanz eines herausragenden Gegenstands im Bild die Egalität der Wahrnehmung herbeiführe. Das ist jetzt nur interpretiert, nicht zitiert. Strzemiński hat mich dann sehr beschäftigt und auch geprägt.
1957 haben Sie Heinz Mack, Otto Piene und Yves Klein kennengelernt?
Yves Klein kannte ich schon seit 56 aus Südfrankreich, weil ich mit Arman befreundet war, der wiederum mit Lewandowski, der während der Vichy-Zeit mit einem Maschinengewehr in einer Höhle lebte und abwartete, ob die Deutschen noch weiter vordringen, befreundet war. Lewandowski hat auch bewirkt, dass Picasso sich in Vallauris bei Madoura in dieser Töpferei ansiedelte. Ich habe noch sehen können, wie Picasso dort gearbeitet hat. Fernand Léger kam nach Biot, das war in der Nähe. Lewandowski war der Vermittler, der mich mit Menschen aus meiner Generation zusammengebracht hat: mit Arman und Martial Raysse. Das waren die engsten Freunde von Yves. Daher kenne ich sie gut.1957 war dann bei Schmela die erste Ausstellung von Yves. ![]() „Yves Propositions monochromes“, Galerie Schmela, Düsseldorf, April 1957. Zuvor hatte ich meiner Schwester schon erzählt, dass es einen großen, von mir verehrten Künstler gibt. Ich habe Arman angerufen, ob er nicht helfen könne, denn meine Schwester sprach ja kein Französisch und konnte auch nicht so gut mit Messer und Gabel umgehen – wir waren Landleute, sie ritt auf einem schwarzen Pferd über die Koppel am Strand, mit langen schwarzen Haaren. Wir waren in dem Sinne richtige Zigeunerkinder. Verwildert. Das war vielleicht auch das Faszinierende für Pankok und der Grund, dass er mich aufgenommen hat. Ich habe also Arman gebeten, Rotraut als Betreuerin für seine Kinder aufzunehmen, damit sie Französisch lernen konnte. Der Einfluss aus New York, der sich damals verbreitete, war lokal authentisch, die Boheme-Szene spielte ja eine wichtige Rolle für die Stimmung. Die Künstler, die zu mir ins Atelier kamen – ich hatte eine alte Scheune in Oberkassel, wunderbar groß –, haben meine Schwester natürlich begeistert.
„Yves Propositions monochromes“, Galerie Schmela, Düsseldorf, April 1957. Zuvor hatte ich meiner Schwester schon erzählt, dass es einen großen, von mir verehrten Künstler gibt. Ich habe Arman angerufen, ob er nicht helfen könne, denn meine Schwester sprach ja kein Französisch und konnte auch nicht so gut mit Messer und Gabel umgehen – wir waren Landleute, sie ritt auf einem schwarzen Pferd über die Koppel am Strand, mit langen schwarzen Haaren. Wir waren in dem Sinne richtige Zigeunerkinder. Verwildert. Das war vielleicht auch das Faszinierende für Pankok und der Grund, dass er mich aufgenommen hat. Ich habe also Arman gebeten, Rotraut als Betreuerin für seine Kinder aufzunehmen, damit sie Französisch lernen konnte. Der Einfluss aus New York, der sich damals verbreitete, war lokal authentisch, die Boheme-Szene spielte ja eine wichtige Rolle für die Stimmung. Die Künstler, die zu mir ins Atelier kamen – ich hatte eine alte Scheune in Oberkassel, wunderbar groß –, haben meine Schwester natürlich begeistert.
Ab wann hatten Sie diese Scheune?
55/56. Die Scheune habe ich von Marianne Jovy-Nakatenus, einer Bildhauerin, übernommen. 2.000 D-Mark Abstand musste ich zahlen. Ich habe nicht lange überlegt, obwohl ich überhaupt kein Geld hatte! Aber ich habe ja auch nicht gefragt, ob ich in den Westen gehen darf.
Wie haben Sie die Scheune finanziert?
Ich habe eine Party gemacht. Da waren Pierre Restany, Iris Clert und alle möglichen Leute aus Paris, Brüssel, Antwerpen und Amsterdam. Wir waren 200 Leute mit Musikkapelle, und Reiner Ruthenbeck hat das alles fotografiert. Ich habe 5 Mark Eintritt genommen, und mit den Einnahmen habe ich die Scheune abbezahlt. Ich habe die Scheune zwischendurch auch vermietet, wenn ich in Südfrankreich in dem Haus von Lewandowski war. Wolfgang Döring, der damals in Karlsruhe Architektur bei Egon Eiermann studierte, hat in der Scheune auch seine Hochzeit gefeiert. Und als ich 1960 an der Ausstellung „Konkrete Kunst“ im Helmhaus Zürich beteiligt war, ![]() „Konkrete Kunst“, Helmhaus, Zürich, 08. Juni – 14. August 1960. hat Döring mir die Fahrkarte bezahlt, da ich nicht per Autostopp zur Eröffnung fahren wollte. Die Ausstellung hatte Max Bill gemacht. Für die Fahrkarte habe ich Döring das silberne große Bild, eine Spirale, gegeben.
„Konkrete Kunst“, Helmhaus, Zürich, 08. Juni – 14. August 1960. hat Döring mir die Fahrkarte bezahlt, da ich nicht per Autostopp zur Eröffnung fahren wollte. Die Ausstellung hatte Max Bill gemacht. Für die Fahrkarte habe ich Döring das silberne große Bild, eine Spirale, gegeben. ![]() Günther Uecker, „Silberspirale (II)“, 1957. Die hat seine geschiedene Frau heute noch.
Günther Uecker, „Silberspirale (II)“, 1957. Die hat seine geschiedene Frau heute noch.
Sie konnten sich also relativ früh über Ihre Kunst finanzieren?
Ich war ja durch die Landwirtschaft bäuerlich geprägt und habe gesagt: „Die Eier sind da, also gleich die Löcher reinmachen. Trinken kann dir keiner wegnehmen.“
Ein bisschen Bargeld brauchten Sie doch aber sicher auch?
Dafür hatte ich Gotthard. Der kam aus dem Vogtland, in der Nähe von Plauen, und hat einen Papierverkauf für Studenten eingerichtet. Ich habe dann eine Bank aufgemacht und habe mir – das war das dialektische Denken meiner sozialen Prägung – ganz ökonomisch gedacht: Ich leihe mir von jedem eine Mark – ich hatte die Taschen immer voller Geld. Ich habe also gefragt: „Kannst du mir eine Mark leihen? Bekommst du morgen wieder.“ – „Aber klar.“ Ich habe mir genau gemerkt, von wem ich was geliehen habe. Ich habe nie etwas ausgegeben und es immer am nächsten Tag zurückgegeben. Das Geld vermehrte sich enorm, und dann wollte ich es mal mit einem größeren Coup versuchen und habe Gotthard gebeten: „Ich brauche alles, was du jetzt in deiner Kasse hast, ich muss etwas kaufen.“ – „Nein, das kann ich nicht machen.“ Woraufhin ich sagte: „Dann bist du nicht mein Freund. Das Risiko gehst du doch bei der Kunst auch ein. Wie willst du gute Bilder machen, wenn du auf das Risiko verzichtest?“ Gotthard hat es dann wirklich gemacht, und ich habe ihm alles wieder zurückgegeben, weil ich das Geld gar nicht gebraucht habe, aber es war ein toller Versuch, wie es funktionieren kann. Wie in der Landwirtschaft, da machten wir auch Kompensationsgeschäfte und Einverschreibungen. Das kannte ich aus der Uckermark, das waren Leute mit Glatze und Monokel. Mein Großvater und die Brüder meines Vaters. Da saßen dann nach dem Verkauf ihrer landwirtschaftlichen Produkte aus der Uckermark in Berlin die nackten Mädchen auf ihrem Schoß. Dadurch sind sie reich geworden. George Grosz hat es doch gemalt und gezeichnet.
Die Geschichte mit der Kasse von Graubners Papierverkauf verstehe ich nicht. Sie haben das ganze Geld mitgenommen?
Ja. Ich wusste aber gar nicht, was ich damit machen sollte.
Sie wollten einfach nur wissen, ob er es macht?
Ich musste wissen, wie ein Banksystem funktioniert. Vertrauen ist die Basis.
Für Ihre Scheune aber zahlten Sie Miete?
Ja. 50 Mark im Monat.
Und woher kamen die 50 Mark?
Wie ich gerade sagte, Wolfgang Döring hat dort seine Hochzeit gefeiert, ich habe die Scheune vermietet und ein großes Fest veranstaltet. Zuletzt habe ich die Scheune abgebrannt, davon gibt es noch ein Foto. Die Stadt wollte, dass ich da rausfliege, und dann habe ich sie eben abgebrannt. Ich war immer von dieser radikalen Art, was man mir nie glaubte. So bin ich eigentlich hoffentlich heute noch.
In Frankreich und in Belgien hatten Sie mehrere Leute, mit denen Sie sich verbunden fühlten. Haben Sie nie überlegt, Deutschland zu verlassen?
Das lag an der Sprache. In der DDR erlernte ich eine ideologisch-artifizielle Sprache, das klingt manchmal noch nach. Erst hier habe ich auch gelernt, Empfindungen unüberlegt Ausdruck zu geben. Früher konnte ich nur stumm dasitzen, oder ich dachte lange darüber nach, wenn jemand etwas sagte, und kam erst sehr viel später mit einer Antwort. Wie die Leute bei uns auf der Insel, die Fischer, die nebeneinander sitzen und aufs Wasser gucken: „Siehst du dat auk?“ – „Ja, ick sei dat auk.“ Aber wenn er dann anfängt zu interpretieren, was der andere sieht, heißt es, der spinnt, der ist nicht ganz gesund. „Der sei dat nick so, wie ick dat sei.“ Und weil er es nicht so sehen kann, wie ich das sehe, ist er ein Irrer. Das hat die Leute wahnsinnig entzweit, sodass sie immer stumm voreinander sitzen oder besoffen sind. Hier konnte man einfach reden. Ich wurde hier wirklich sprachmächtig. Auch leichtsinnig, leichtfertig im Parlieren. Mein Stammeln hat dann die Sprache hervorgebracht. Ich sprach am Anfang wie ein Kind. Im Norden ist es heute noch so, dass man seine Gefühle selbst in der Liebe kaum mitteilen kann. Ich habe hier vieles gelernt. Das hat mich mit der Mentalität der Menschen hier sehr verbunden. Es ist ein Ort des Aufenthalts und der Wiederkehr geworden.
Mit wem fühlten Sie sich hier besonders verbunden?
Mit allen, überall, in jeder Kneipe. Mit den Künstlern, die hier waren. Für eine Ballettaufführung im Museum Folkwang durch Merce Cunningham (Tanz) und Robert Rauschenberg (Bühnenkonstruktion), beschaffte ich mit Ilse Dwinger das Material und stellte für die Proben mein Atelier in der Hüttenstraße zur Verfügung. Christo Jawaschew kam damals gerade aus Bulgarien und hat bei mir gearbeitet, um seine Werke für eine Ausstellung bei Schmela herzustellen. ![]() „Christo: Store Fronts“, Galerie Schmela, Düsseldorf, 05. Dezember 1964 – 05. Januar 1965. Ebenso Arman. Das waren dann die Bindungen. Die waren nicht lokal. Kricke, der internationale Kontakte zu pflegen vermochte, spielte damals eine große Rolle. Er hatte auch die Verbindung nach New York, als es zum Beispiel später um die Berufung von Nam June Paik ging. Davor waren es eigentlich Ulm, Köln, Zürich, Düsseldorf. Dort die Studenten meiner Generation, und dann gehörten einige der Älteren wie Jean-Pierre Wilhelm und Alfred Schmela dazu. Schmela hatte bei André Lhote in Paris studiert und war ein ausgebildeter, für mich kenntnisreicher Bildsinnträger. Dadurch hatten wir eine enge Bindung.
„Christo: Store Fronts“, Galerie Schmela, Düsseldorf, 05. Dezember 1964 – 05. Januar 1965. Ebenso Arman. Das waren dann die Bindungen. Die waren nicht lokal. Kricke, der internationale Kontakte zu pflegen vermochte, spielte damals eine große Rolle. Er hatte auch die Verbindung nach New York, als es zum Beispiel später um die Berufung von Nam June Paik ging. Davor waren es eigentlich Ulm, Köln, Zürich, Düsseldorf. Dort die Studenten meiner Generation, und dann gehörten einige der Älteren wie Jean-Pierre Wilhelm und Alfred Schmela dazu. Schmela hatte bei André Lhote in Paris studiert und war ein ausgebildeter, für mich kenntnisreicher Bildsinnträger. Dadurch hatten wir eine enge Bindung.
Als Mack und Piene ZERO „gründeten“, kannten Sie die beiden schon?
Gegründet wurde es ja nicht, es war einfach eine Benennung der Abendausstellungen. Die Ausstellung „Das rote Bild“, die im April 1958 stattfand, war die erste, die wirklich einen thematischen Charakter hatte, den man mit ZERO in Verbindung bringen könnte. Da waren unter anderen auch Georges Mathieu, Yves Klein, Jean Tinguely und ich dabei. ![]() Die erste der von Heinz Mack und Otto Piene organisierten „Abendausstellungen“ fand am 11. April 1957 statt, die achte und letzte am 02. Oktober 1958. Anlässlich der „7. Abendausstellung“, die am 24. April 1958 unter dem Titel „Das rote Bild“ im Atelier von Heinz Mack und Otto Piene in der Gladbacher Straße 69 in Düsseldorf eröffnet wurde, war erstmals auch Günther Uecker vertreten. Daneben umfasste die Ausstellung Arbeiten von 43 weiteren Künstlern, darunter Werke von Hermann Bartels, Yves Klein, Heinz Mack, Georges Mathieu und Hans Salentin. Vgl. Thekla Zell, „Editionen, Expositionen, Demonstrationen 1957–1966“, in: Dirk Pörschmann und Mattijs Visser (Hg.), „ZERO 4 3 2 1“, Düsseldorf 2012, S. 443–468, hier S. 444. Mack hatte meine Arbeiten gesehen und mich daraufhin zu dieser Abendausstellung eingeladen. Auf den Namen ZERO waren sie vorher schon mit Hans Salentin während eines Kneipenbesuchs gekommen. Max Bense hat die Ausstellung damals eröffnet und von der stochastischen Welt der Texte gesprochen. Das hat mich sehr beeindruckt: Die semantischen und die stochastischen Texte. Eine Art wissenschaftliches DADA. Buchstaben nebeneinander oder Wörter gleicher Art nebeneinander ergeben einen anderen Sinnzusammenhang.
Die erste der von Heinz Mack und Otto Piene organisierten „Abendausstellungen“ fand am 11. April 1957 statt, die achte und letzte am 02. Oktober 1958. Anlässlich der „7. Abendausstellung“, die am 24. April 1958 unter dem Titel „Das rote Bild“ im Atelier von Heinz Mack und Otto Piene in der Gladbacher Straße 69 in Düsseldorf eröffnet wurde, war erstmals auch Günther Uecker vertreten. Daneben umfasste die Ausstellung Arbeiten von 43 weiteren Künstlern, darunter Werke von Hermann Bartels, Yves Klein, Heinz Mack, Georges Mathieu und Hans Salentin. Vgl. Thekla Zell, „Editionen, Expositionen, Demonstrationen 1957–1966“, in: Dirk Pörschmann und Mattijs Visser (Hg.), „ZERO 4 3 2 1“, Düsseldorf 2012, S. 443–468, hier S. 444. Mack hatte meine Arbeiten gesehen und mich daraufhin zu dieser Abendausstellung eingeladen. Auf den Namen ZERO waren sie vorher schon mit Hans Salentin während eines Kneipenbesuchs gekommen. Max Bense hat die Ausstellung damals eröffnet und von der stochastischen Welt der Texte gesprochen. Das hat mich sehr beeindruckt: Die semantischen und die stochastischen Texte. Eine Art wissenschaftliches DADA. Buchstaben nebeneinander oder Wörter gleicher Art nebeneinander ergeben einen anderen Sinnzusammenhang.
Obwohl ZERO sehr häufig als Gruppe dargestellt wird, war es offenbar eher eine Gruppe von gemeinsam ausstellenden Künstlern als eine Künstlergruppe?
Es war nie eine Gruppe. Es war ein pragmatischer Zusammenhalt von Künstlern, die es vermocht haben, in der Welt Aufsehen zu erregen und Ausstellungen zu präsentieren, um die ich mich in der Regel gekümmert habe, da Mack und Piene Lehrer waren und schon morgens ins Gymnasium oder in die Modeschule mussten. Das heißt, sie konnten nur nachts arbeiten. Und ich habe dann die Transporte begleitet und die Ausstellungen im Ausland aufgebaut. Es war meine Aufgabe, die Sache zu dynamisieren, da die anderen beiden durch die Ausübung ihres Berufs verhindert waren.
Warum heißt es immer, dass Sie ab 1961 zu ZERO dazugehörten? Woran wird das festgemacht?
Ich habe damals vor der Galerie Schmela die Straße weiß gestrichen, ![]() Günther Uecker, „Straße weiß gestrichen“, Aktion anlässlich der Ausstellung „ZERO. Edition. Exposition. Demonstration“, Galerie Schmela, Düsseldorf, 05. Juli 1961. außerdem hatte ich anlässlich der Ausstellung einen Heißluftballon steigen lassen und eine große Zinkwanne mit weißer Farbe aufgestellt, die Beuys mir dann umgeworfen hat, weil er irgendwie aufgeregt war.
Günther Uecker, „Straße weiß gestrichen“, Aktion anlässlich der Ausstellung „ZERO. Edition. Exposition. Demonstration“, Galerie Schmela, Düsseldorf, 05. Juli 1961. außerdem hatte ich anlässlich der Ausstellung einen Heißluftballon steigen lassen und eine große Zinkwanne mit weißer Farbe aufgestellt, die Beuys mir dann umgeworfen hat, weil er irgendwie aufgeregt war.
Hat er sie absichtlich umgeworfen?
Er hat sie einfach umgeworfen. Es stört mich bis heute, dass er das gemacht hat. Wie sehr er sich da eingemischt hat! Das war die erste Performance oder wie man es nennt – wir haben es „Aktion“ genannt. Das war einfach unerklärbar. Dabei hat er seine Seifenblasen gepustet und sich da gefeixt. In dieser Zeit war er noch stärker theologisch orientiert.
Beuys wurde ja selbst in seinen Aktionen häufig „gestört“, zum Beispiel in Aachen während seines Auftritts beim „Festival der Neuen Kunst“ ![]() Joseph Beuys nahm am 20. Juli 1964 am „Festival der Neuen Kunst“ im Audimax der Technischen Hochschule Aachen teil. Nach „tumultuarischen Szenen“ des Publikums, die im Faustangriff eines Studenten auf Beuys kulminierten, wurde das Festival vorzeitig abgebrochen. Vgl. Götz Adriani/Winfried Konnertz/Karin Thomas, „Joseph Beuys – Leben und Werk“, Köln 1986 (3. Auflage), S. 125–134 sowie Heiner Stachelhaus, „Joseph Beuys“, Düsseldorf 1988, S. 165–168. oder in Berlin bei dem Konzert mit Henning Christiansen.
Joseph Beuys nahm am 20. Juli 1964 am „Festival der Neuen Kunst“ im Audimax der Technischen Hochschule Aachen teil. Nach „tumultuarischen Szenen“ des Publikums, die im Faustangriff eines Studenten auf Beuys kulminierten, wurde das Festival vorzeitig abgebrochen. Vgl. Götz Adriani/Winfried Konnertz/Karin Thomas, „Joseph Beuys – Leben und Werk“, Köln 1986 (3. Auflage), S. 125–134 sowie Heiner Stachelhaus, „Joseph Beuys“, Düsseldorf 1988, S. 165–168. oder in Berlin bei dem Konzert mit Henning Christiansen. ![]() Zur Eröffnung der Ausstellung „Blockade 69“ der Galerie René Block sollte am 27. Februar 1969 das Konzert „Ich versuche dich freizulassen (machen)“ von Joseph Beuys und Henning Christiansen in der Akademie der Künste in Berlin stattfinden. Die Aktion wurde von randalierenden Studenten gestört und musste abgebrochen werden. Vgl. Jürgen Geisenberger, „Joseph Beuys und die Musik“, Marburg 1999, S. 109 f. In dieser Zeit war es für die Rezipienten vielleicht zum Teil wirklich schwierig zu unterscheiden, wann eine Partizipation erwünscht war und wann nicht.
Zur Eröffnung der Ausstellung „Blockade 69“ der Galerie René Block sollte am 27. Februar 1969 das Konzert „Ich versuche dich freizulassen (machen)“ von Joseph Beuys und Henning Christiansen in der Akademie der Künste in Berlin stattfinden. Die Aktion wurde von randalierenden Studenten gestört und musste abgebrochen werden. Vgl. Jürgen Geisenberger, „Joseph Beuys und die Musik“, Marburg 1999, S. 109 f. In dieser Zeit war es für die Rezipienten vielleicht zum Teil wirklich schwierig zu unterscheiden, wann eine Partizipation erwünscht war und wann nicht.
Es waren damals mehrere Künstler von Klaus Staeck in Heidelberg eingeladen. Bei den Türmen, in denen die Studenten wohnten, habe ich eine Ausstellung gemacht: „Fallgruben als neue plastische Ästhetik“. ![]() Günther Uecker, „Fallgrube“, anlässlich der „intermedia ’69“, Heidelberg, 23.–25. Mai 1969. Nach den Erfahrungen, die ich 1973 in Laos gemacht hatte, wo die amerikanischen Soldaten in Fallgruben auf Bambusspitzen gefallen sind, habe ich Negativräume gemacht: mit dem Bagger ausgehoben und Pfähle mit den Spitzen nach oben hineingestellt. Damals haben die Studenten aus dem Wohnheim heraus mit Feuerlöschern auf mich gezielt. Was genau dahinterstand, weiß ich nicht. Später habe ich einmal mit meinen Studenten in Bonn beschlossen, dass wir unsere Arbeiten im Gang der juristischen Fakultät auf dem Weg zur Mensa aufstellen. Daraufhin wurden meine Studenten richtiggehend verhauen. Die Jurastudenten waren so erregt, dass sie zugeschlagen haben. Das kann ich mir bis heute nicht erklären.
Günther Uecker, „Fallgrube“, anlässlich der „intermedia ’69“, Heidelberg, 23.–25. Mai 1969. Nach den Erfahrungen, die ich 1973 in Laos gemacht hatte, wo die amerikanischen Soldaten in Fallgruben auf Bambusspitzen gefallen sind, habe ich Negativräume gemacht: mit dem Bagger ausgehoben und Pfähle mit den Spitzen nach oben hineingestellt. Damals haben die Studenten aus dem Wohnheim heraus mit Feuerlöschern auf mich gezielt. Was genau dahinterstand, weiß ich nicht. Später habe ich einmal mit meinen Studenten in Bonn beschlossen, dass wir unsere Arbeiten im Gang der juristischen Fakultät auf dem Weg zur Mensa aufstellen. Daraufhin wurden meine Studenten richtiggehend verhauen. Die Jurastudenten waren so erregt, dass sie zugeschlagen haben. Das kann ich mir bis heute nicht erklären.
Sie sagen, die erste Auseinandersetzung gab es 1959 in Antwerpen in der Ausstellung im Hessenhuis. ![]() „Motion in Vision – Vision in Motion“, Hessenhuis, Antwerpen, 21. März –03. Mai 1959.
„Motion in Vision – Vision in Motion“, Hessenhuis, Antwerpen, 21. März –03. Mai 1959.
Damals gab es eine Schlägerei zwischen Jean Tinguely und Paul Van Hoeydonck. Die beiden hatten eine Auseinandersetzung, weil Jef Verheyen die Ausstellung ursprünglich mitkonzipiert hatte und dann ausgeschlossen wurde, woran Van Hoeydonck beteiligt war. Er gehörte der lokalen Künstlergruppierung an, wie es sie in jeder Stadt gibt und die dann häufig sozusagen „nach vorne randalieren“. Wie die Schlägerei zwischen Van Hoeydonck und Tinguely genau entstand, ist nicht klar, aber die Situation damals war sehr angespannt. Vor allem auch, weil man in die Ausstellung kam und bemerkte: „Die Werke könnten alle von einem einzigen Künstler sein.“ Als hätten alle in den Ateliers bei den anderen abgeschaut.
So war es aber nicht?
Wie könnte es denn so gewesen sein? Wie denn?
Wer was zuerst gemacht hat und wer wen kopiert hat, war damals offenbar ein großes Thema.
Das geht ja bis heute. Ondulierungen gibt es überall. Friseurgehabe. Bei einigen Künstlern konnte man das benennen, aber es kann auch lächelnd darüber hinweggegangen werden.
Dennoch ist es ein großes Thema. Schon bei Piero Manzoni …
… der mich auch oft in meiner Scheune besuchte und über den Schmela sagte, das wäre ihm doch zu dünn, das würde er nicht ausstellen. Ich insistierte: „Alfred, das musst du ausstellen!“ Ich konnte mich aber nicht durchsetzen, er hat es nicht gewollt. Warum, weiß ich nicht.
War Konkurrenz für Sie ein Thema?
Ja, weil es inspirierend war, was andere Künstler machten. Da waren ja hervorragende Dinge entstanden. Mit Tinguely, Yves Klein und später auch mit Daniel Spoerri, der damals noch Tänzer in Bern war, haben wir manchmal bis morgens geredet. Auch Eva Hesse kam zu meinen Ausstellungen. Da war ich vielleicht für sie sehr inspirierend. Außerdem war ich mit Hans Haacke, der damals noch in Köln war, befreundet.
Für Sie war es also keine Konkurrenz, sondern Inspiration?
Ja, gegenseitige Inspiration. Dass es in der Körperschaft einzelner begabter Hervorbringer, die das ins Bild setzen, so etwas wie eine immaterielle geistige Wirklichkeit gibt, in der Gleichzeitigkeiten der Erfindung und Findung vorkommen. Das finden wir schon bei der Dampfmaschine und der Glühbirne. Das finden wir überall. Das ist so etwas wie eine sensible Inspiration. Das gab es auch bei den Kubisten: Zwischen Pablo Picasso, Georges Braque und André Derain herrschte ein ewiger Disput. In der betreffenden Zeit wird es vielleicht als Nachahmung betrachtet, das ist aber meiner Meinung nach eine zu simple Erklärung. Tatsächlich war es eine immaterielle Wahrnehmung, die sich in produktiver bildnerischer Arbeit gegenseitig telepathisch inspirierte. So wie heute mit dem iPhone. Da passiert es ja auch fast gleichzeitig. Ich habe gerade meine Bilder fotografiert und versendet. Nach einer Minute bekam ich schon Antwort, da war es schon in Teheran, und der Drucker konnte es schon drucken. Das ist doch unglaublich. Heute geht das ja durch die Luft. Das Telepathische finden wir auch schon bei den Indianern, bei alten Kulturen, das ist die Inspiration geistiger Anstrengung in der Welt. In Tibet beispielsweise habe ich Himmelsbestattungen erlebt. Wenn man diese Menschen beten sieht, fragt man sich, was passiert, wenn die mal nicht mehr beten. Die bewahren die Menschen, die leben. Diese Intensität des Betens ist von solch einer Kraft und ist – wenn auch nicht immer monotheistisch orientiert – ein Versuch einer Gottesannäherung. Wenn das nicht wäre, würden wir alle verloren sein. Da bin ich ganz sicher.
Durch die gemeinsamen Ausstellungen in Amsterdam, Antwerpen oder Brüssel entstand bereits Ende der 50er-Jahre ein europäisches Netzwerk. 1964 stellten Sie das erste Mal in New York aus. ![]() „On the Move. Kinetic Sculptures“, Howard Wise Gallery, New York, 09. Januar – 01. Februar 1964; „Mack. Piene. Uecker. ZERO“, Howard Wise Gallery, New York, 12. November – 05. Dezember 1964. Wie haben Sie diesen Schritt nach New York vollzogen?
„On the Move. Kinetic Sculptures“, Howard Wise Gallery, New York, 09. Januar – 01. Februar 1964; „Mack. Piene. Uecker. ZERO“, Howard Wise Gallery, New York, 12. November – 05. Dezember 1964. Wie haben Sie diesen Schritt nach New York vollzogen?
Ich habe damals einen Preis ![]() Günther Uecker erhielt 1964 den Förderpreis für Bildende Kunst des Landes Nordrhein-Westfalen. bekommen und dann gleich das Ticket nach New York gekauft – ganz einfach. Wenn man Geld hat, kann man auch fliegen.
Günther Uecker erhielt 1964 den Förderpreis für Bildende Kunst des Landes Nordrhein-Westfalen. bekommen und dann gleich das Ticket nach New York gekauft – ganz einfach. Wenn man Geld hat, kann man auch fliegen.
War New York für Sie ein Sehnsuchtsort?
Ich verehrte die Künstler dort. Dass man nach New York geht, war sowieso klar. Nur, dass es dann so plötzlich ging, war unvorhergesehen. Das war so, als würde ich Sie jetzt fragen: „Gehen wir nach New York?“ Würden Sie da gleich Ja sagen? Wir sind damals noch in einer Propellermaschine über Island geflogen, mit Zwischenlandung. New York war einem damals schon sehr nah. David Galloway, ![]() David Galloway (* 1937 Memphis) ist ein Schriftsteller, Journalist und Kurator und war von 1972 bis 2002 an der Ruhr-Universität Bochum im Institut für Amerikastudien Professor für Visuelle Kultur. William Rubin
David Galloway (* 1937 Memphis) ist ein Schriftsteller, Journalist und Kurator und war von 1972 bis 2002 an der Ruhr-Universität Bochum im Institut für Amerikastudien Professor für Visuelle Kultur. William Rubin ![]() William Stanley Rubin (1927 New York – 2006 Pound Ridge, New York) war ab 1967 am Museum of Modern Art in New York für den Bereich der Malerei sowie ab 1973 für die dortige Skulpturensammlung zuständig. und einige andere waren viel hier in Düsseldorf. Das waren Freunde. New York war einfach nur eine andere Stadt. Vorher waren wir schon in Philadelphia, wo wir in der Universität eine große Ausstellung hatten.
William Stanley Rubin (1927 New York – 2006 Pound Ridge, New York) war ab 1967 am Museum of Modern Art in New York für den Bereich der Malerei sowie ab 1973 für die dortige Skulpturensammlung zuständig. und einige andere waren viel hier in Düsseldorf. Das waren Freunde. New York war einfach nur eine andere Stadt. Vorher waren wir schon in Philadelphia, wo wir in der Universität eine große Ausstellung hatten. ![]() „Group Zero“, University of Philadelphia, 30. Oktober – 11. Dezember 1964. Die kulturelle Verbindung in die USA wurde durch die Emigranten und rückkehrenden Auswanderer wiederbelebt und half uns, die Gründung von der neuen Vorstellung einer Kunst des 20. Jahrhunderts in ihrem Aufbruch wiederzuentdecken.
„Group Zero“, University of Philadelphia, 30. Oktober – 11. Dezember 1964. Die kulturelle Verbindung in die USA wurde durch die Emigranten und rückkehrenden Auswanderer wiederbelebt und half uns, die Gründung von der neuen Vorstellung einer Kunst des 20. Jahrhunderts in ihrem Aufbruch wiederzuentdecken.
Und Sie hatten damals bereits so viele Kontakte in die USA, dass sich die Ausstellungsbeteiligungen ganz selbstverständlich ergaben?
Das ging über London und Antwerpen. Da war fast jede Woche eine Ausstellung, an der ich beteiligt war.
Da waren Sie in Deutschland eine Ausnahme. Ein Großteil der deutschen Künstler stellte erst in den 80er-Jahren in New York aus, viele davon ohne besonderen Erfolg.
Das hing mit der Generation zusammen. Emil Schumacher ![]() Emil Schumacher (1912 Hagen – 1999 San José, Ibiza) war ein Künstler und Vertreter des deutschen Informel. Von 1932 bis 1935 wurde er an der Kunstgewerbeschule Dortmund ausgebildet. Während des Zweiten Weltkriegs war er als technischer Zeichner in einem Rüstungsbetrieb verpflichtet. 1947 gründete er zusammen mit Thomas Grochowiak, Ernst Hermanns, Heinrich Siepmann und Hans Werdehausen die Künstlergruppe junger westen. 1957 war Schumacher in der Eröffnungsausstellung der Galerie 22 in Düsseldorf vertreten. 1958 wurde er in New York mit dem Guggenheim Award ausgezeichnet. Er war auf der documenta 2 (1959), 3 (1964) und 6 (1977) vertreten und stellte bei der „29. Biennale von Venedig“ unter anderen zusammen mit Rolf Cavael, K.O. Götz und K.R.H. Sonderborg im Deutschen Pavillon aus. Schumacher lehrte von 1958 bis 1960 als Professor an der Hochschule für bildende Künste Hamburg und von 1966 bis 1977 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. , der in New York von der Samuel M. Kootz Gallery vertreten wurde, hat mir einmal erzählt, dass eine geplante Ausstellung Ende der 50er-Jahre abgesagt wurde, nachdem in der Zeitung ein Bericht erschienen war, in dem aufgrund seines Alters geschlussfolgert wurde, dass er während des Zweiten Weltkriegs zu den Soldaten gehörte, die gemordet haben. Schumacher hat darunter bis zu seinem Tod gelitten, weil er aufgrund seiner Geschichte auch nie wieder den Anschluss fand. Da wir aber, bis auf Piene,
Emil Schumacher (1912 Hagen – 1999 San José, Ibiza) war ein Künstler und Vertreter des deutschen Informel. Von 1932 bis 1935 wurde er an der Kunstgewerbeschule Dortmund ausgebildet. Während des Zweiten Weltkriegs war er als technischer Zeichner in einem Rüstungsbetrieb verpflichtet. 1947 gründete er zusammen mit Thomas Grochowiak, Ernst Hermanns, Heinrich Siepmann und Hans Werdehausen die Künstlergruppe junger westen. 1957 war Schumacher in der Eröffnungsausstellung der Galerie 22 in Düsseldorf vertreten. 1958 wurde er in New York mit dem Guggenheim Award ausgezeichnet. Er war auf der documenta 2 (1959), 3 (1964) und 6 (1977) vertreten und stellte bei der „29. Biennale von Venedig“ unter anderen zusammen mit Rolf Cavael, K.O. Götz und K.R.H. Sonderborg im Deutschen Pavillon aus. Schumacher lehrte von 1958 bis 1960 als Professor an der Hochschule für bildende Künste Hamburg und von 1966 bis 1977 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. , der in New York von der Samuel M. Kootz Gallery vertreten wurde, hat mir einmal erzählt, dass eine geplante Ausstellung Ende der 50er-Jahre abgesagt wurde, nachdem in der Zeitung ein Bericht erschienen war, in dem aufgrund seines Alters geschlussfolgert wurde, dass er während des Zweiten Weltkriegs zu den Soldaten gehörte, die gemordet haben. Schumacher hat darunter bis zu seinem Tod gelitten, weil er aufgrund seiner Geschichte auch nie wieder den Anschluss fand. Da wir aber, bis auf Piene, ![]() Otto Piene (1928 Laasphe – 2014 Berlin) war von 1943 bis 1945 Flakhelfer der deutschen Wehrmacht. Vgl. Heinz-Norbert Jocks/Otto Piene, „Otto Piene. Das Gold namens Licht“, in: Heinz-Norbert Jocks (Hg.), „Das Ohr am Tatort: Heinz-Norbert Jocks im Gespräch mit Gotthard Graubner, Heinz Mack, Roman Opałka, Otto Piene, Günther Uecker“, Ostfildern 2009, S. 91–116, hier S. 92. keine Krieger waren, war es für uns leichter. Es gibt einen Artikel, ich glaube, von Grace Glueck, der in der New York Times erschienen ist, in dem sie schreibt: „Uecker scheint wie vom Himmel gefallen. Als hätte es die Nazis nicht gegeben.“ Das muss man auch realisieren. Man kann nicht sagen: „Der Krieg ist jetzt sieben oder fünfzehn Jahre vorbei und damit sind die Gräueltaten vergangen und alles ist vergessen.“ Das geht doch gar nicht. Und in New York war ein hoher Anteil der im Kulturbetrieb Tätigen Immigranten.
Otto Piene (1928 Laasphe – 2014 Berlin) war von 1943 bis 1945 Flakhelfer der deutschen Wehrmacht. Vgl. Heinz-Norbert Jocks/Otto Piene, „Otto Piene. Das Gold namens Licht“, in: Heinz-Norbert Jocks (Hg.), „Das Ohr am Tatort: Heinz-Norbert Jocks im Gespräch mit Gotthard Graubner, Heinz Mack, Roman Opałka, Otto Piene, Günther Uecker“, Ostfildern 2009, S. 91–116, hier S. 92. keine Krieger waren, war es für uns leichter. Es gibt einen Artikel, ich glaube, von Grace Glueck, der in der New York Times erschienen ist, in dem sie schreibt: „Uecker scheint wie vom Himmel gefallen. Als hätte es die Nazis nicht gegeben.“ Das muss man auch realisieren. Man kann nicht sagen: „Der Krieg ist jetzt sieben oder fünfzehn Jahre vorbei und damit sind die Gräueltaten vergangen und alles ist vergessen.“ Das geht doch gar nicht. Und in New York war ein hoher Anteil der im Kulturbetrieb Tätigen Immigranten.
Der Aufbruch der Kunst des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel Kandinsky, das „Geistige in der Kunst“ ![]() Wassily Kandinsky, „Über das Geistige in der Kunst: insbesondere in der Malerei. Mit acht Tafeln und zehn Originalholzschnitten“, München 1912. 1912, Kasimir Malewitsch und Alexander Rodtschenko, das war ein Kontinuum, das bei mir als Hintergrund meines künstlerischen Ausdrucks erkennbar blieb. Das war mein Bestreben. Die Bücher, die wir alle nicht zu Hause hatten, die ich aber bei anderen Studenten, besonders bei den bürgerlichen, fand, habe ich mit Gier verschlungen und mit Bense und Bill diskutiert. Bill war lange Zeit mein Mentor. Das spielte schon eine Rolle. Wir kannten viele Leute. 1965 waren wir bei McRobert & Tunnard in der Curzon Street in London, da kam Bill aus New York, wo er im Museum of Modern Art zu einer Ausstellungseröffnung war, noch sein weißes Dinnerjacket mit Fliege an – er kam direkt aus dem Flugzeug –, und sagte: „Komm, jetzt gehen wir nach SoHo. Jetzt wollen wir mal schauen, wie die Hausfrauen tanzen.“ Das war früher so. Da kamen die Frauen mit einem kleinen Plattenspieler auf eine Holzbühne und haben Striptease gemacht. Anschließend gingen sie für ihre Kinder einkaufen. New York war genauso vor der Tür wie London.
Wassily Kandinsky, „Über das Geistige in der Kunst: insbesondere in der Malerei. Mit acht Tafeln und zehn Originalholzschnitten“, München 1912. 1912, Kasimir Malewitsch und Alexander Rodtschenko, das war ein Kontinuum, das bei mir als Hintergrund meines künstlerischen Ausdrucks erkennbar blieb. Das war mein Bestreben. Die Bücher, die wir alle nicht zu Hause hatten, die ich aber bei anderen Studenten, besonders bei den bürgerlichen, fand, habe ich mit Gier verschlungen und mit Bense und Bill diskutiert. Bill war lange Zeit mein Mentor. Das spielte schon eine Rolle. Wir kannten viele Leute. 1965 waren wir bei McRobert & Tunnard in der Curzon Street in London, da kam Bill aus New York, wo er im Museum of Modern Art zu einer Ausstellungseröffnung war, noch sein weißes Dinnerjacket mit Fliege an – er kam direkt aus dem Flugzeug –, und sagte: „Komm, jetzt gehen wir nach SoHo. Jetzt wollen wir mal schauen, wie die Hausfrauen tanzen.“ Das war früher so. Da kamen die Frauen mit einem kleinen Plattenspieler auf eine Holzbühne und haben Striptease gemacht. Anschließend gingen sie für ihre Kinder einkaufen. New York war genauso vor der Tür wie London.
1964 gingen Sie nach New York. In einem Interview mit Hans Strelow konstatieren Sie bereits 1965, dass Ihre Werke dort gut verkauft werden. ![]() Vgl. Hans Strelow, „Interview mit Uecker 1965“, in: „Günther Uecker“, Ausst.-Kat. Kestnergesellschaft Hannover, Hannover 1972, S. 47–49, hier S. 49.
Vgl. Hans Strelow, „Interview mit Uecker 1965“, in: „Günther Uecker“, Ausst.-Kat. Kestnergesellschaft Hannover, Hannover 1972, S. 47–49, hier S. 49.
Ja. Circa 35 Werke sind im Museumsbesitz und im Privatbesitz. Viele haben damals dagegen gewettert. Beuys hat gesagt, ich würde das kapitalistische System verherrlichen, weil ich in Amerika so hohe Preise für meine Werke bekam. „Affirmativ“, haben sie gesagt.
Wie hoch waren die Preise?
Bestätigend. Etwa einige Tausend Dollar. Also gegenwärtige Verhältnisse bestätigend. Es haben sich damals ganze Gruppen gegen mich gebildet. 1965 und 1971 habe ich auf Einladung von Pontus Hultén ![]() Pontus Hultén (1924 Stockholm – 2006 Stockholm) war ein Kunsthistoriker und Kunstsammler, der unter anderem von 1957 bis 1973 als Gründungsdirektor das Moderna Museet in Stockholm leitete. in Stockholm ausgestellt.
Pontus Hultén (1924 Stockholm – 2006 Stockholm) war ein Kunsthistoriker und Kunstsammler, der unter anderem von 1957 bis 1973 als Gründungsdirektor das Moderna Museet in Stockholm leitete. in Stockholm ausgestellt. ![]() „Den inre och den yttre rymden“, Moderna Museet, Stockholm, 26. Dezember 1965 – 13. Februar 1966; „Günther Uecker – Bildobjekte 1957–1970“, Moderna Museet, Stockholm, 16. Januar – 28. Februar 1971. Im gleichen Zeitraum zeigte das Moderna Museet 1971 auch eine Ausstellung von Joseph Beuys. 1971 war auch Joseph Beuys eingeladen. Als ich zum Aufbau hinfuhr, sagte die Kuratorin, Karin Lindegren, ganz aufgeregt: „Beuys hat darauf bestanden, den Katalog zu vernichten.“ Er wollte nicht in einem Katalog mit mir erscheinen. Das Plakat ist dann auch nicht aufgehängt worden, aber gedruckt war es, ich habe noch eins. Franz Dahlem und Heiner Friedrich haben damals nächtelang Terror gegen Frau Lindegren gemacht, um zu bewerkstelligen, dass ich nicht zusammen mit Beuys ausstelle. Können Sie sich das erklären?
„Den inre och den yttre rymden“, Moderna Museet, Stockholm, 26. Dezember 1965 – 13. Februar 1966; „Günther Uecker – Bildobjekte 1957–1970“, Moderna Museet, Stockholm, 16. Januar – 28. Februar 1971. Im gleichen Zeitraum zeigte das Moderna Museet 1971 auch eine Ausstellung von Joseph Beuys. 1971 war auch Joseph Beuys eingeladen. Als ich zum Aufbau hinfuhr, sagte die Kuratorin, Karin Lindegren, ganz aufgeregt: „Beuys hat darauf bestanden, den Katalog zu vernichten.“ Er wollte nicht in einem Katalog mit mir erscheinen. Das Plakat ist dann auch nicht aufgehängt worden, aber gedruckt war es, ich habe noch eins. Franz Dahlem und Heiner Friedrich haben damals nächtelang Terror gegen Frau Lindegren gemacht, um zu bewerkstelligen, dass ich nicht zusammen mit Beuys ausstelle. Können Sie sich das erklären?
Von Franz Erhard Walther habe ich ähnliche Geschichten gehört. Beuys hat wohl auch versucht, ihm Hindernisse in den Weg zu stellen. ![]() Vgl. hierzu Franz Erhard Walther.
Vgl. hierzu Franz Erhard Walther.
Beuys war immer freundlich zu mir. Diese Dinge gingen vermeintlich von Franz Dahlem aus. Oder waren Folgen seiner Absprachen mit ihm. Beuys hatte 1965 seine erste Einzelausstellung bei Schmela. ![]() Am 26. November 1965 wurde in der Galerie Schmela mit der Aktion „Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt“ unter dem Titel „Joseph Beuys … irgendein Strang …“ die erste Einzelausstellung von Joseph Beuys eröffnet. Davor hatte er nichts. Unsere ZERO-Ausstellungen fanden ja fast ein Jahrzehnt früher statt. Die Ausstellung in Stockholm war großartig. Und wir waren wirklich Freunde. Das waren äußere Einflüsse, denen er wohl nicht widersprochen hat. Auf jeden Fall hieß es: „Ein gemeinsamer Katalog – auf keinen Fall!“ Den mussten sie einstampfen und einen neuen drucken.
Am 26. November 1965 wurde in der Galerie Schmela mit der Aktion „Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt“ unter dem Titel „Joseph Beuys … irgendein Strang …“ die erste Einzelausstellung von Joseph Beuys eröffnet. Davor hatte er nichts. Unsere ZERO-Ausstellungen fanden ja fast ein Jahrzehnt früher statt. Die Ausstellung in Stockholm war großartig. Und wir waren wirklich Freunde. Das waren äußere Einflüsse, denen er wohl nicht widersprochen hat. Auf jeden Fall hieß es: „Ein gemeinsamer Katalog – auf keinen Fall!“ Den mussten sie einstampfen und einen neuen drucken.
Sie haben die Preise für Ihre Werke eben schon angesprochen. Was kosteten Ihre Arbeiten in den 1960er-Jahren?
Etwa ab 400 D-Mark, später zwischen 10.000 und 30.000 US-Dollar. Zu Beginn war der Wechselkurs eins zu vier.
Das ist für deutsche Verhältnisse dann schon sehr teuer gewesen.
Ja. Wobei der Durchschnittspreis für kleinere Werke bei 3.000 Dollar lag. Die ganz großen kosteten etwas mehr.
Ab wann konnten Sie Ihre Werke verkaufen?
David Rockefeller hat gleich vier Stück gekauft und dann noch ein fünftes für die Chase Manhattan Bank.
1964?
Ja. Er hat es Philip Johnson als Stiftung an das Museum of Modern Art übergeben. Es musste auch ab und zu mal weggehängt werden, vermutlich weil Mathias Goeritz kam. Goeritz hatte die Kathedrale in Mexico-City mit Fenstern ausgestattet. Dafür hat er gelbes Flaschenglas verwendet, und bei der Kreuzigungsszene ![]() Mathias Goeritz, „Message Number 7B, Ecclesiastes VII: 6“, 1959. hat er von hinten spitze Nägel durch Blattgold geschlagen. Das war immer die Konkurrenz. Er war Jude, kam aus Marokko, war während des Kriegs emigriert und war auch in der Legion.
Mathias Goeritz, „Message Number 7B, Ecclesiastes VII: 6“, 1959. hat er von hinten spitze Nägel durch Blattgold geschlagen. Das war immer die Konkurrenz. Er war Jude, kam aus Marokko, war während des Kriegs emigriert und war auch in der Legion. ![]() Die politischen und militärischen Aktivitäten von Mathias Goeritz (1915 Danzig, Pommern, heute Polen – 1990 Mexiko-Stadt) während des Zweiten Weltkriegs sind bis heute ungeklärt und äußerst umstritten. Vgl. Javier Arnaldo, „Mathias Goeritz: Ein ungewöhnlicher Mittler zwischen kulturellen Positionen im Nachkriegsspanien“, in: „Kritische Berichte – Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften“, (1994), Bd. 22/Nr. 3, S. 73–87, hier S. 74 f. In den 50er-Jahren, als die ersten Emigranten nach Europa zurückkamen, kam er zu mir in die Scheune. Er war sehr oft mit mir zusammen. Und irgendwann wurde seine Arbeit vom Museum of Modern Art erworben und von da an immer kontrovers zu mir gezeigt. Die meisten wissen gar nicht, dass er bei mir im Atelier war. Das können andere aber bestätigen.
Die politischen und militärischen Aktivitäten von Mathias Goeritz (1915 Danzig, Pommern, heute Polen – 1990 Mexiko-Stadt) während des Zweiten Weltkriegs sind bis heute ungeklärt und äußerst umstritten. Vgl. Javier Arnaldo, „Mathias Goeritz: Ein ungewöhnlicher Mittler zwischen kulturellen Positionen im Nachkriegsspanien“, in: „Kritische Berichte – Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften“, (1994), Bd. 22/Nr. 3, S. 73–87, hier S. 74 f. In den 50er-Jahren, als die ersten Emigranten nach Europa zurückkamen, kam er zu mir in die Scheune. Er war sehr oft mit mir zusammen. Und irgendwann wurde seine Arbeit vom Museum of Modern Art erworben und von da an immer kontrovers zu mir gezeigt. Die meisten wissen gar nicht, dass er bei mir im Atelier war. Das können andere aber bestätigen.
Hatten Sie in den USA einen Markt, bevor Sie in Deutschland einen hatten?
Nein, der erste Markt war in Belgien. Dann wurde auch hier ab und an etwas gekauft, vor allem von Museen. Gekauft haben Udo Kultermann, Paul Wember, Werner Haftmann und 63 auch Werner Schmalenbach. ![]() Udo Kultermann (1927–2013; 1959–1964 Direktor des Städtischen Museums Leverkusen Schloss Morsbroich); Paul Wember (1913–1987; 1947–1975 Direktor des Kaiser Wilhelm Museums, Krefeld); Werner Haftmann (1912–1999; 1967–1974 Direktor der Neuen Nationalgalerie in Berlin); Werner Schmalenbach (1920–2010; 1962–1990 Gründungsdirektor der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf).
Udo Kultermann (1927–2013; 1959–1964 Direktor des Städtischen Museums Leverkusen Schloss Morsbroich); Paul Wember (1913–1987; 1947–1975 Direktor des Kaiser Wilhelm Museums, Krefeld); Werner Haftmann (1912–1999; 1967–1974 Direktor der Neuen Nationalgalerie in Berlin); Werner Schmalenbach (1920–2010; 1962–1990 Gründungsdirektor der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf).
Wann ging das los?
1962. Eigentlich durch die Ausstellungen bei Schmela ab 61. Bis dahin hatte ich zeitweise noch in einer Fabrik gearbeitet. In der Gerresheimer Glashütte am Fließband für 400 D-Mark, weil ich ja zwei Kinder hatte.
In den 60er-Jahren entwickelte sich im Rheinland, spätestens mit dem Kölner Kunstmarkt, ![]() Auf Bestreben der Galeristen Hein Stünke und Rudolf Zwirner fand der erste Kölner Kunstmarkt unter Beteiligung von 18 Galerien vom 13. bis 17. September 1967 in den Räumen der historischen Festhalle Gürzenich statt. tatsächlich ein Markt für die Kunst. Bis auf den Kontakt mit Schmela hatten sie jedoch keinen Galeristen und auch nie einen Vertrag.
Auf Bestreben der Galeristen Hein Stünke und Rudolf Zwirner fand der erste Kölner Kunstmarkt unter Beteiligung von 18 Galerien vom 13. bis 17. September 1967 in den Räumen der historischen Festhalle Gürzenich statt. tatsächlich ein Markt für die Kunst. Bis auf den Kontakt mit Schmela hatten sie jedoch keinen Galeristen und auch nie einen Vertrag.
Nein, bis heute nicht. Ich hätte mir das schon gewünscht. Wir haben übrigens den ersten Kunstmarkt mit Gerd Winkler in Büdingen gemacht. ![]() Bruno Großkopf, Werner Schreib und Gerd Winkler organisierten am 20. und 21. August 1966 im oberhessischen Büdingen ein Kunstfest. 25 Künstler, darunter Konrad Lueg, Otto Piene, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Tomas Schmit und Günther Uecker waren eingeladen, teilzunehmen und ihre Werke dort zu präsentieren. Siehe auch Jürgen Claus, „Das Büdinger Happening – Kultur ist eben ein schweres Geschäft“, in: „Die Zeit“, 26.08.1966, Nr. 35, S. 11. Das unterschlagen alle. Da haben wir, Konrad Lueg, später Fischer, Richter, Polke, ich und noch einige andere, auf dem Markt in Büdingen Holzbuden aufstellen lassen. Ich habe große Nägel signiert, Konrad Lueg hat gemusterte Lätzchentücher bemalt und verkauft. Das war der erste Kunstmarkt. Es hieß auch Büdinger Kunstmarkt. Und dann kam Hans-Jürgen Müller aus Stuttgart und brachte das nach Köln.
Bruno Großkopf, Werner Schreib und Gerd Winkler organisierten am 20. und 21. August 1966 im oberhessischen Büdingen ein Kunstfest. 25 Künstler, darunter Konrad Lueg, Otto Piene, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Tomas Schmit und Günther Uecker waren eingeladen, teilzunehmen und ihre Werke dort zu präsentieren. Siehe auch Jürgen Claus, „Das Büdinger Happening – Kultur ist eben ein schweres Geschäft“, in: „Die Zeit“, 26.08.1966, Nr. 35, S. 11. Das unterschlagen alle. Da haben wir, Konrad Lueg, später Fischer, Richter, Polke, ich und noch einige andere, auf dem Markt in Büdingen Holzbuden aufstellen lassen. Ich habe große Nägel signiert, Konrad Lueg hat gemusterte Lätzchentücher bemalt und verkauft. Das war der erste Kunstmarkt. Es hieß auch Büdinger Kunstmarkt. Und dann kam Hans-Jürgen Müller aus Stuttgart und brachte das nach Köln.
Wie war Ihre Beziehung zu Polke und Richter?
Sehr herzlich. Wir haben manchmal sehr kuriose Dinge gemacht. Ich hatte mein erstes Tonbandgerät, und wir wollten das Atmen des Friedhofs aufnehmen und sind dann hier in Düsseldorf in der Nacht um zwei Uhr auf einen Friedhof gegangen. Ich habe gesagt: „Ich lege mich auf ein Grab und versuche mich mit dem Toten zu identifizieren.“ Mit einem Mal bekam das – psychologisch betrachtet vielleicht – eine solche Nähe, dass ich wie ein gestochenes Tier aufsprang und nur noch gelaufen bin. Ich spürte, wie es zusammenklappte, wie ein Kuss. Es war ungeheuer stark.
Oder dann haben wir in Rolandseck mal eine Badewanne verwendet, um durch die Etage zu rudern. Wir saßen alle zusammen in der Badewanne, bis die Wasserrohre abgebrochen sind, das war furchtbar. Dann haben wir einen Flügel von der oberen Etage auf den Vorplatz stürzen lassen, damit wir Musik hatten, und einen großen Kutschenwagen mit Zeug beladen, den wir in der Nacht über einen Hang die Straße hinunter in den Rhein haben fahren lassen – vorher haben wir ihn noch angezündet. Das war auch stark! Wir haben vieles zusammen gemacht. Einmal haben wir auch mit einem Mädchen einen Tisch kaputtgetanzt – das war ebenfalls in Rolandseck.
Das hört sich nach jugendlicher Freiheit und spritziger Energie an.
Etwas anderes war es auch nicht. Rosalta, eine Polin, ist damals durchgedreht, ihr ging das zu weit. Sie sagte, sie bringe sich um, und hat dann ihre ganzen Tabletten gegessen, die sie in einem kleinen Schrank hatte. Der Höhepunkt war dann, dass der Rettungswagen sie mit Blaulicht abholte. Damit fand die Oper in dieser Nacht ein Ende.
Aus welcher Stimmung heraus ist das entstanden?
Denken und Handeln ist immer eins. Also nicht vordenken und nicht nachdenken. Man muss schneller handeln, als man denken kann. Dadurch entsteht Inspiration. Wenn man denkt, entstehen Hemmnisse, Barrieren. Wie ich auf Straßen Barrieren mit spitzen Nägeln nach oben eingeschlagen habe. Denken und Handeln ist eins. Aber das Handeln hat den ganzen Charakter des Ereignisses bestimmt. Dadurch war es glaubhaft und authentisch. Alles andere ist Konzeptkunst.
Haben Piene und Mack auch gleichzeitig gehandelt und gedacht?
Keine Ahnung. Ich habe mit den beiden ja nicht zusammengearbeitet, mit Ausnahme einer einzigen Arbeit für die documenta. ![]() Heinz Mack, Otto Piene und Günther Uecker, „Lichtraum (Hommage à Fontana)“, „documenta 3“, Kassel, 1964.
Heinz Mack, Otto Piene und Günther Uecker, „Lichtraum (Hommage à Fontana)“, „documenta 3“, Kassel, 1964. 
Aber mit Polke und Richter funktionierte es?
Ja, viel besser.
Mit Bazon Brock haben Sie auch zusammengearbeitet?
Ja, 1963 haben wir in der Galerie d die „Überflutung der Welt mit Kunst“ vorgetragen. ![]() „Sintflut der Nägel“, Galerie d, Frankfurt am Main, 13. September – 26. Oktober 1963.
„Sintflut der Nägel“, Galerie d, Frankfurt am Main, 13. September – 26. Oktober 1963. 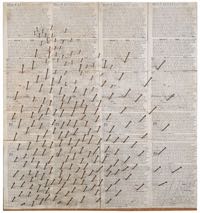 Ich habe damals diesen ganzen Kult der Galerie d mit Rochus Kowallek, Peter Iden und William Simmat zelebriert, indem ich sie mit Kunst überflutet habe. Kunst lässt sich auf alle Gegenstände, die uns sozusagen „die Welt verbalken“ und alles erblinden lassen, übertragen. So war es von mir gemeint. Damals hat Schmalenbach diesen Lesetisch erworben. Bazon Brock hatte zur Eröffnung ein Stück über diese Gedanken geschrieben. Er sagte: „Ich übertrage das jetzt auf einen fetten Menschen, der im Bett liegt und immer darüber sinniert, wie er aus dem Bett herauskommt. Weil er immer dicker und unbeweglicher wird.“ Während er diesen Text hinter mir stehend las, habe ich am Boden mit dem Rücken zu ihm eine Platte mit seinem Text benagelt. Die Platte hat Frieder Burda später gekauft. Das war ein großer Enthusiasmus, der damals in Frankfurt geweckt wurde, und dazu hat Bazon Brock einen großen Beitrag geleistet. Adorno natürlich auch. Das war eine – man könnte sagen – analytische Gruppierung unter den Studenten damals.
Ich habe damals diesen ganzen Kult der Galerie d mit Rochus Kowallek, Peter Iden und William Simmat zelebriert, indem ich sie mit Kunst überflutet habe. Kunst lässt sich auf alle Gegenstände, die uns sozusagen „die Welt verbalken“ und alles erblinden lassen, übertragen. So war es von mir gemeint. Damals hat Schmalenbach diesen Lesetisch erworben. Bazon Brock hatte zur Eröffnung ein Stück über diese Gedanken geschrieben. Er sagte: „Ich übertrage das jetzt auf einen fetten Menschen, der im Bett liegt und immer darüber sinniert, wie er aus dem Bett herauskommt. Weil er immer dicker und unbeweglicher wird.“ Während er diesen Text hinter mir stehend las, habe ich am Boden mit dem Rücken zu ihm eine Platte mit seinem Text benagelt. Die Platte hat Frieder Burda später gekauft. Das war ein großer Enthusiasmus, der damals in Frankfurt geweckt wurde, und dazu hat Bazon Brock einen großen Beitrag geleistet. Adorno natürlich auch. Das war eine – man könnte sagen – analytische Gruppierung unter den Studenten damals.
Abschließend möchte ich mit Ihnen noch über die anderen Kunstbewegungen sprechen, die etwa zu der gleichen Zeit in Deutschland stattgefunden haben. Über Richter und Polke haben wir gesprochen. Wie aber haben Sie das Werk von Georg Baselitz, Eugen Schönebeck oder Markus Lüpertz damals wahrgenommen?
Das war doch in der Ferne, wie man einen anderen Kontinent betrachtet. So wie Tasmanien, das ist ein Teil von Australien, da, wo die ersten Grünen sich zusammenfanden. So habe ich das gesehen.
Für diese Kunst waren Sie nicht offen?
Doch, ich hatte den Mund offen. Es hat mich einfach stumm gemacht. Aber ich habe nichts dazu zu sagen.
Ich sehe das heute wahrscheinlich ganz anders, als Sie es damals gesehen haben.
Ja, ich sehe da diese ganze Deutschtümelei. Das ist alles da drin, auch mit berechtigtem Ausdruck. Eine Generation, die sich deutsch fühlt. Was mir nie gelungen ist.
Haben Sie das damals abgelehnt?
Ich brauchte das doch nicht abzulehnen. Wenn der Kastanienbaum immer größer wird, wann soll ich ihn ablehnen? Und ich werde ihn auch nicht fällen. Ich kann mich nur auf das nächste Frühjahr freuen, wenn die Blüten wiederkommen. Das sind doch andere Welten. Der Künstler muss ein Idiot sein, der die ganze Welt auf sich vereinen möchte. Er ist selbst erst einmal groß, universal und gewaltig. Sich das bewusst zu machen, ist ein so anstrengender Prozess, eigentlich ist die Lebenszeit sehr hoch einzuschätzen, um das zu verwirklichen.
Michael Werner …
Den schätze ich sehr, weil er ein richtiger Künstlergalerist ist. So wie Schmela. Das habe ich immer bewundert. Er ist einer, der sich für seine Künstler einsetzt.
Michael Werner hat am Anfang probiert – so nannte er es –, Integrationsprogramme für seine Künstler in Köln zu machen. Das heißt, er wollte seine Künstler über den Kontakt zu anderen Künstlern, die im Rheinland verwurzelt waren, besser anbinden. Die ZERO-Künstler gehörten nach seinen Angaben auch zu diesem Integrationsprogramm.
Damit habe ich gar nichts zu tun. Ich weiß von ihm gar nichts. Ich habe ihn immer nur von Weitem betrachtet. Bewundert, wie er sich für seine Künstler einsetzt. Aber es gibt so viele Künstler. Muss ich die alle kennen? Die Friseure kennen sich doch untereinander auch nicht, oder die Zahnärzte.
Aber Franz Erhard Walther kannten Sie?
Und den schätze ich sehr. Von ihm habe ich auch die erste Arbeit gekauft. ![]() Franz Erhard Walther, „Ohne Titel (Weste) (Nr. 11 aus dem 1. Werksatz)“, 1965. Er arbeitete als Bäcker, um fünf Uhr morgens war er schon in der Bäckerei. Seine Frau war Näherin. Unten in der Corneliusstraße hatten sie einen kleinen Laden, und da wohnten sie auch. Das ist sehr lange her. Aber das habe ich bewundert, weil es authentisch war und auch mit physiologischer Leidenschaft zum Ausdruck gebracht wurde – körperlich.
Franz Erhard Walther, „Ohne Titel (Weste) (Nr. 11 aus dem 1. Werksatz)“, 1965. Er arbeitete als Bäcker, um fünf Uhr morgens war er schon in der Bäckerei. Seine Frau war Näherin. Unten in der Corneliusstraße hatten sie einen kleinen Laden, und da wohnten sie auch. Das ist sehr lange her. Aber das habe ich bewundert, weil es authentisch war und auch mit physiologischer Leidenschaft zum Ausdruck gebracht wurde – körperlich.
Ich glaube, Sie haben Franz Erhard Walther auch durch Alfred Schmela kennengelernt?
Ja, wir sind gemeinsam zu Franz Erhard Walther gegangen, wo ich auch die Weste gekauft habe, weil Schmela sich die Arbeiten ansehen wollte. Er hat mich gewissermaßen als Künstlertester benutzt: „Was hältst du davon?“
Angeblich war auch eine Ausstellung mit Franz Erhard Walther bei Schmela geplant, die dann aber aufgrund des Widerspruchs von Beuys nicht stattfand? ![]() Vgl. hierzu Franz Erhard Walther.
Vgl. hierzu Franz Erhard Walther.
Ja, aber das interessiert mich dann alles gar nicht mehr. Das muss man auch nicht polemisch sehen. Das ist, glaube ich, ein Übereifer von Egomanie. Mehr kann es gar nicht sein.
Eine letzte Frage: Sie haben zu der Zeit, als Sie im Westen waren, weiter im Osten ausgestellt.
Ja, sehr häufig. In verschiedenen Ländern. In Prag, in Brünn, also Tschechien, in Jugoslawien, in Taiwan, in Polen, in Moskau …
Aber eben auch in Ostdeutschland. ![]() „Positionen – Malerei aus der Bundesrepublik Deutschland“, Altes Museum, Ost-Berlin, 31. Oktober – 30. November 1986/Albertinum, Dresden, 10. Dezember 1986 – 12. Januar 1987. Beteiligt waren unter anderen Horst Antes, Raimund Girke, Anselm Kiefer, Gerhard Richter und Günther Uecker. Warum konnten Sie, der Sie ja geflüchtet waren, in die DDR reisen?
„Positionen – Malerei aus der Bundesrepublik Deutschland“, Altes Museum, Ost-Berlin, 31. Oktober – 30. November 1986/Albertinum, Dresden, 10. Dezember 1986 – 12. Januar 1987. Beteiligt waren unter anderen Horst Antes, Raimund Girke, Anselm Kiefer, Gerhard Richter und Günther Uecker. Warum konnten Sie, der Sie ja geflüchtet waren, in die DDR reisen?
Weil ich 58 amnestiert wurde. Von da an war ich kein DDR-Bürger mehr. Vorher war ich republikflüchtig und hätte auch die Kosten, die man in meine Ausbildung investiert hatte, zurückzahlen müssen. Die Ausstellung war vom Kulturministerium organisiert. Sehr offiziell. Das war die Öffnung der DDR für einen Kulturaustausch.
Und da haben Sie gerne teilgenommen?
Ja, ich immer. Ich habe auch in der Nacht, als die Mauer überwunden wurde, in Leipzig im Dimitroff-Museum ausgestellt. ![]() „Zeitzeichen. Stationen Bildender Kunst in Nordrhein-Westfalen“, Ministerium für Bundesangelegenheiten des Landes Nordrhein-Westfalen in Bonn, 13. September – 19. Oktober 1989/Museum der bildenden Künste und Galerie der Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig, 10. November 1989 – 07. Januar 1990/Wilhelm Lehmbruck Museum der Stadt Duisburg, 30. Januar – 25. März 1990. Das ist ja das Reichsgerichtsgebäude. Da hatte ich das Thema „Aufwischen“
„Zeitzeichen. Stationen Bildender Kunst in Nordrhein-Westfalen“, Ministerium für Bundesangelegenheiten des Landes Nordrhein-Westfalen in Bonn, 13. September – 19. Oktober 1989/Museum der bildenden Künste und Galerie der Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig, 10. November 1989 – 07. Januar 1990/Wilhelm Lehmbruck Museum der Stadt Duisburg, 30. Januar – 25. März 1990. Das ist ja das Reichsgerichtsgebäude. Da hatte ich das Thema „Aufwischen“ ![]() Günther Uecker, „Aufwischen“, 1988. , dieses Fass, das mit einem Ast einen Lappen mit Grafit und toxischem Material schleift, nach Tschernobyl. Die Eröffnung sollte am Abend sein. Wir waren um 19 Uhr ins Rathaus eingeladen, um mit dem Oberbürgermeister ein Essen einzunehmen. Dann hörten wir: „Der Oberbürgermeister kommt nicht, er ist abgesetzt.“ Und weiter: „Die Mauer ist offen.“ Das konnte keiner fassen. Meine DDR-Freunde von der Opposition sagten: „Das ist ein Schachzug der SED. Die Bevölkerung ist überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass die Grenzen jetzt geöffnet werden.“ Manche gingen ganz sinnend herum, andere riefen: „Ich fahre zur Grenze, Mutti.“ Das war ein merkwürdiger Zustand. Draußen gruppierten sich die Studenten, die schon seit Tagen demonstrierten und Angst hatten, dass das Militär oder die Polizei eingesetzt werden. Was ich damals gelernt habe – auch so ein psychotherapeutisches Moment –, als einige dort angesichts des Wahnsinns vor Angst zu kollabieren drohten, wirklich an der Grenze eines Komas oder Schocks, haben einige Demonstranten deren Beine genommen und sie in die Luft gehoben, das hat die Leute sehr beruhigt und umarmt. Das war fantastisch. Damals war ich mit Klaus Staeck da.
Günther Uecker, „Aufwischen“, 1988. , dieses Fass, das mit einem Ast einen Lappen mit Grafit und toxischem Material schleift, nach Tschernobyl. Die Eröffnung sollte am Abend sein. Wir waren um 19 Uhr ins Rathaus eingeladen, um mit dem Oberbürgermeister ein Essen einzunehmen. Dann hörten wir: „Der Oberbürgermeister kommt nicht, er ist abgesetzt.“ Und weiter: „Die Mauer ist offen.“ Das konnte keiner fassen. Meine DDR-Freunde von der Opposition sagten: „Das ist ein Schachzug der SED. Die Bevölkerung ist überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass die Grenzen jetzt geöffnet werden.“ Manche gingen ganz sinnend herum, andere riefen: „Ich fahre zur Grenze, Mutti.“ Das war ein merkwürdiger Zustand. Draußen gruppierten sich die Studenten, die schon seit Tagen demonstrierten und Angst hatten, dass das Militär oder die Polizei eingesetzt werden. Was ich damals gelernt habe – auch so ein psychotherapeutisches Moment –, als einige dort angesichts des Wahnsinns vor Angst zu kollabieren drohten, wirklich an der Grenze eines Komas oder Schocks, haben einige Demonstranten deren Beine genommen und sie in die Luft gehoben, das hat die Leute sehr beruhigt und umarmt. Das war fantastisch. Damals war ich mit Klaus Staeck da.
Hatten Sie mit Klaus Staeck einen engen Kontakt?
Habe ich bis heute. Weil er auch aus der DDR kommt. Aus Bitterfeld. Seine Entwicklung ist wohl eine andere. Er ist erst sehr viel später weggegangen, wie Richter auch. Vielleicht ist er anders geprägt. Ich möchte sagen, ich bin noch im rechten Moment gegangen. Sonst wäre ich zu sehr gehirngewaschen gewesen. Ich war psychisch wirklich gefährdet. Viele meiner Mitstudenten haben später in der Partei Karriere gemacht und sind auch psychisch erkrankt. Zwei von ihnen haben sich umgebracht. Diese psychische Entwicklung, unter diesen Umständen die Illusion eines Staats verwirklichen zu wollen und das Scheitern desselben zu beobachten und gleichzeitig an sich selbst nachzuvollziehen, ist wie ein Massakersuizid an der eigenen Person. Diese Vorwürfe! Es reicht nicht zu eifern, also eifere ich dann im Gebet weiter, dass Gott einen tragen möge.
Was genau bedeutet das?
Dass man eins ist. Mit Gott. Also wenn man in der Wüste kein Wasser hat, um die Füße und Hände zu waschen, was man in der Moschee tut, macht man es mit Sand.

