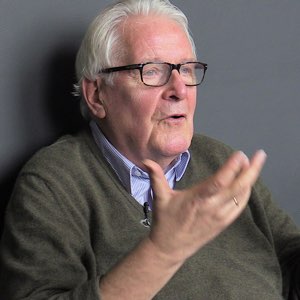Frankfurt am Main, 17. Mai 2016
Franziska Leuthäußer: Wie ich nachlesen konnte, sind Sie während Ihrer Schulzeit in Aachen erstmals mit Kunst in Berührung gekommen. Was hat Sie schließlich dazu bewegt, als junger Mensch Kunstgeschichte und Philosophie zu studieren?
Eduard Beaucamp: Für das Kind und den Schüler kamen die ersten Inspirationen von der Musik. Ich habe über 15 Jahre Klavierunterricht gehabt und gewann eine gewisse Reife. Ich habe aber früh eingesehen, dass die Begabung doch nicht allzu weit reichte. Dennoch hatte ich eine Disposition für die Kunst, und es war eine frühe Entscheidung, dass ich mich mein Leben lang damit beschäftigen wollte.
Mein Vater, Besitzer einer Tuchfabrik in Aachen, wollte wohl, dass ich bei ihm einmal einsteige. Das hätte ich vielleicht auch gemacht. Doch die Firma geriet im Zuge der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dann später durch die ostasiatische Konkurrenz ins Schlingern und musste aufgegeben werden. So kam ich überhaupt nicht in Versuchung, meine Jahre damit zu verschwenden.
Mütterlicherseits gab es einen Buchverlag in Köln, einen uralten, sich aus der Gegenreformation herleitenden, katholischen Verlag: J.P. Bachem ![]() Der von Johann Peter Bachem 1818 in Köln gegründete Verlag positionierte sich während der Auseinandersetzungen zwischen protestantischer Regierung und katholischer Bevölkerung in den 1870er-Jahren im Rheinland als katholischer Verlag, der die „Kölnischen Blätter“ für die katholische Opposition herausgab. Das Familienunternehmen verlegt bis heute kirchliche Zeitungen und Magazine, darunter die Kirchenzeitung des Erzbistums Köln, ist aber vornehmlich auf die Themengebiete Geschichte, Architektur, Freizeit und Reise sowie Kinder- und Jugendsachbücher spezialisiert. . Mein Vater empfahl mir, vor dem Studium ein praktisches Jahr zu absolvieren. Also ging ich zu den Verwandten in den Kölner Verlag, der damals den renommierten literarischen Verlag Jakob Hegner adoptiert hatte. Hier lernte ich als kleiner Volontär so große Figuren wie Martin Buber oder Reinhold Schneider und vor allem auch den Verleger selbst, Jakob Hegner, der ins Exil in die Schweiz gegangen war, persönlich kennen. Im anschließenden Studium wählte ich Germanistik als Hauptfach, wohl auch mit dem Gedanken, mich später damit für die Arbeit in einem Verlag zu empfehlen.
Der von Johann Peter Bachem 1818 in Köln gegründete Verlag positionierte sich während der Auseinandersetzungen zwischen protestantischer Regierung und katholischer Bevölkerung in den 1870er-Jahren im Rheinland als katholischer Verlag, der die „Kölnischen Blätter“ für die katholische Opposition herausgab. Das Familienunternehmen verlegt bis heute kirchliche Zeitungen und Magazine, darunter die Kirchenzeitung des Erzbistums Köln, ist aber vornehmlich auf die Themengebiete Geschichte, Architektur, Freizeit und Reise sowie Kinder- und Jugendsachbücher spezialisiert. . Mein Vater empfahl mir, vor dem Studium ein praktisches Jahr zu absolvieren. Also ging ich zu den Verwandten in den Kölner Verlag, der damals den renommierten literarischen Verlag Jakob Hegner adoptiert hatte. Hier lernte ich als kleiner Volontär so große Figuren wie Martin Buber oder Reinhold Schneider und vor allem auch den Verleger selbst, Jakob Hegner, der ins Exil in die Schweiz gegangen war, persönlich kennen. Im anschließenden Studium wählte ich Germanistik als Hauptfach, wohl auch mit dem Gedanken, mich später damit für die Arbeit in einem Verlag zu empfehlen.
Doch früh zog es mich zu der sinnlicheren Kunst. In der Schulzeit waren die Berührungen damit, vor allem mit moderner Kunst, noch spärlich. Die ersten großen Bilder sah ich auf Schulausflügen im Kölner Wallraf-Richartz-Museum und in Düsseldorf. Heute ist das kaum noch vorstellbar, denn 15-Jährige können sich alle Bilder dieser Welt ansehen oder herunterladen, die alten wie die modernen und zeitgenössischen. Damals waren die Museen durch die Razzien der Nazis leergeräumt. Wir kannten nichts, konnten allenfalls in grauen alten Büchern der Vorkriegszeit herumblättern.
Zu einem Schlüsselerlebnis wurde 1954 das Gastspiel des jungen Museums von São Paulo, das seine exzellente Sammlung mit Bildern von Giovanni Bellini über Diego Velázquez bis Auguste Renoir im Düsseldorfer Ehrenhof zeigte. ![]() „Meisterwerke aus dem Museu de Arte in São Paulo“, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 29. August – Oktober 1954. Die sinnlich aufregende Malerei grub sich tief in mein Gedächtnis ein. Später fuhren wir dann beispielsweise auch nach Amsterdam …
„Meisterwerke aus dem Museu de Arte in São Paulo“, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 29. August – Oktober 1954. Die sinnlich aufregende Malerei grub sich tief in mein Gedächtnis ein. Später fuhren wir dann beispielsweise auch nach Amsterdam …
Wie oft sind Sie nach Amsterdam gefahren? Wie groß war das Bedürfnis, auch immer wieder neue Werke aufzusuchen?
Nicht so oft. Ich würde mich stilisieren, wenn ich sage, dass damals schon eine Sucht entstanden ist. So war es nicht. Solche Ausflüge gab es während der gesamten Schulzeit vielleicht dreimal. Durch einen älteren Vetter bin ich allerdings schon auf der ersten documenta gewesen, damals noch ganz unerfahren. Ich erinnere mich vor allem an die Werke von Picasso und die Skulpturen von Lehmbruck.
Ein einschneidendes, tief prägendes Erlebnis war 1955 die große Picasso-Tournee durch Europa, wohl die größte, die es je gab. ![]() 1955 zeigte das Pariser Musée des Arts Décoratifs die erste Retrospektive Pablo Picassos nach dem Zweiten Weltkrieg. In leicht abgewandelter Form war die Ausstellung anschließend in Deutschland im Haus der Kunst in München (25. Oktober – 18. Dezember 1955), im Rheinischen Museum Köln (30. Dezember 1955 – 29. Februar 1956) und in der Hamburger Kunsthalle (10. März – 29. April 1956) zu sehen. Ich habe sie in Köln gesehen. Uns Schüler packte natürlich besonders „Guernica“
1955 zeigte das Pariser Musée des Arts Décoratifs die erste Retrospektive Pablo Picassos nach dem Zweiten Weltkrieg. In leicht abgewandelter Form war die Ausstellung anschließend in Deutschland im Haus der Kunst in München (25. Oktober – 18. Dezember 1955), im Rheinischen Museum Köln (30. Dezember 1955 – 29. Februar 1956) und in der Hamburger Kunsthalle (10. März – 29. April 1956) zu sehen. Ich habe sie in Köln gesehen. Uns Schüler packte natürlich besonders „Guernica“ ![]() Pablo Picasso, „Guernica“, 1937.
Pablo Picasso, „Guernica“, 1937.  , aber auch das damals politisch brisante Korea-Gemälde, ein linkes Antikriegsbild. Picassos Drastik war befremdlich, umwerfend und erschütternd: Archaische Krieger mit Gesichtsmasken zielen mit ihren Gewehren auf nackte, schwangere Frauen.
, aber auch das damals politisch brisante Korea-Gemälde, ein linkes Antikriegsbild. Picassos Drastik war befremdlich, umwerfend und erschütternd: Archaische Krieger mit Gesichtsmasken zielen mit ihren Gewehren auf nackte, schwangere Frauen. ![]() Pablo Picasso, „Massacre en Corée“, 1951.
Pablo Picasso, „Massacre en Corée“, 1951. 
Das Wallraf-Richartz-Museum war damals noch in einem Provisorium in Köln-Deutz untergebracht. Eine andere Ausstellung, die ich als Schüler gesehen habe, war die Max-Ernst-Ausstellung im Schloss Brühl. ![]() „Max Ernst. Gemälde und Graphik 1920–1950“, Schloss Brühl, 22. Juli – 16. September 1951. Das war ein Akt der Wiedergutmachung, weil Ernst aus Brühl stammte.
„Max Ernst. Gemälde und Graphik 1920–1950“, Schloss Brühl, 22. Juli – 16. September 1951. Das war ein Akt der Wiedergutmachung, weil Ernst aus Brühl stammte.
Was haben diese Bilder bei Ihnen damals ausgelöst?
Das hat sich verwischt, es ist zu lange her. Ich habe diese Ausstellung eher poetisch gesehen, vor allem die wunderschönen Muschelblumen aus den 20er-Jahren sind mir in Erinnerung geblieben. Bei Picasso war es anders. Er wühlte auf. Bei diesen verzerrten Menschenbildern ahnte man, dass sie nicht Produkt einer Manier, eines Stils oder einer Attitüde waren, sondern im Kontext eines fragwürdig gewordenen und zertrümmerten Menschenbilds innerhalb dieses ungeheuerlichen Jahrhunderts entstanden waren. Das war existentieller als Ernst.
Wir hatten damals übrigens einen Zeichenlehrer, der im rheinischen Raum ein namhafter informeller Maler war. In seinem Kunstunterricht behandelte er noch nach altem Brauch den „Bamberger Reiter“ ![]() Der „Bamberger Reiter“ ist eine Reiterplastik, die um 1230 von einem unbekannten Meister hergestellt wurde und im Bamberger Dom aufgestellt ist. Die Statue ist eine der ältesten erhaltenen figürlichen Plastiken des Mittelalters.
Der „Bamberger Reiter“ ist eine Reiterplastik, die um 1230 von einem unbekannten Meister hergestellt wurde und im Bamberger Dom aufgestellt ist. Die Statue ist eine der ältesten erhaltenen figürlichen Plastiken des Mittelalters.  , die Chorfiguren und den Lettner aus Naumburg
, die Chorfiguren und den Lettner aus Naumburg ![]() Westchor und Westlettner des Doms von Naumburg, Mitte des 13. Jahrhunderts von einem Naumburger Meister geschaffen, sind insbesondere für die Gruppe der Stifterfiguren bekannt, die als außergewöhnlich realistische und bedeutende Arbeiten der gotischen figürlichen Plastik gelten. . Als informeller Maler führte er uns aber auch behutsam an die moderne, ja die abstrakte Kunst heran. Unter dem Druck der Zeitgeschichte fragten wir uns damals schon: Reicht das, ist das dem Jahrhundert angemessen? Der Lehrer nahm mich einmal mit nach Hause, setzte sich ans Klavier, spielte ein paar Töne und sagte: „Das ist ja auch nicht inhaltlich. So ist unsere Kunst. Die Malerei ist heute Musik: Es sind Töne, Rhythmen, malerische Werte.“ Das hat mich beeindruckt, aber nicht gläubig gemacht.
Westchor und Westlettner des Doms von Naumburg, Mitte des 13. Jahrhunderts von einem Naumburger Meister geschaffen, sind insbesondere für die Gruppe der Stifterfiguren bekannt, die als außergewöhnlich realistische und bedeutende Arbeiten der gotischen figürlichen Plastik gelten. . Als informeller Maler führte er uns aber auch behutsam an die moderne, ja die abstrakte Kunst heran. Unter dem Druck der Zeitgeschichte fragten wir uns damals schon: Reicht das, ist das dem Jahrhundert angemessen? Der Lehrer nahm mich einmal mit nach Hause, setzte sich ans Klavier, spielte ein paar Töne und sagte: „Das ist ja auch nicht inhaltlich. So ist unsere Kunst. Die Malerei ist heute Musik: Es sind Töne, Rhythmen, malerische Werte.“ Das hat mich beeindruckt, aber nicht gläubig gemacht.
Es gab das Informel, es gab ZERO ![]() Ab 1958 verwendeten Heinz Mack und Otto Piene den Begriff „ZERO“ im Kontext ihrer gemeinsamen Ausstellungen sowie als Titel für die drei Ausgaben ihrer in Düsseldorf publizierten Zeitschrift. Ab 1961 nahm auch Günther Uecker regelmäßig an den Ausstellungen und Aktionen von ZERO teil. ZERO stand für die Stunde null, für Aufbruch und einen radikalen Neuanfang nach den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs. ZERO setzte sich deutlich vom etablierten Informel ab. Mit neuen Materialien und der Einbeziehung von Bewegung, Licht und Raum in das künstlerische Werk etablierte ZERO eine neue Formensprache. Vgl. Wieland Schmied, „Etwas über ZERO“, in: Dirk Pörschmann/Mattijs Visser (Hg.), „ZERO 4 3 2 1“, Düsseldorf 2012, S. 9–18. … Anfang der 60er-Jahre entstanden in Berlin die Bilder von Georg Baselitz und Eugen Schönebeck. Wie war das damals einzuordnen?
Ab 1958 verwendeten Heinz Mack und Otto Piene den Begriff „ZERO“ im Kontext ihrer gemeinsamen Ausstellungen sowie als Titel für die drei Ausgaben ihrer in Düsseldorf publizierten Zeitschrift. Ab 1961 nahm auch Günther Uecker regelmäßig an den Ausstellungen und Aktionen von ZERO teil. ZERO stand für die Stunde null, für Aufbruch und einen radikalen Neuanfang nach den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs. ZERO setzte sich deutlich vom etablierten Informel ab. Mit neuen Materialien und der Einbeziehung von Bewegung, Licht und Raum in das künstlerische Werk etablierte ZERO eine neue Formensprache. Vgl. Wieland Schmied, „Etwas über ZERO“, in: Dirk Pörschmann/Mattijs Visser (Hg.), „ZERO 4 3 2 1“, Düsseldorf 2012, S. 9–18. … Anfang der 60er-Jahre entstanden in Berlin die Bilder von Georg Baselitz und Eugen Schönebeck. Wie war das damals einzuordnen?
Sie überspringen Jahrzehnte. Was Baselitz angeht: Ich habe Respekt vor dem, was er in den 60er- und frühen 70er-Jahren gemacht hat. Mit seinen „Unbehausten“ hatte er natürlich ein Generationsthema gefunden. Für den Hype hatte ich jedoch nie Verständnis. Noch heute wird er als Urheber einer neuen Figuration gefeiert. Da waren Jean Dubuffet, Francis Bacon, David Hockney, Domenico Gnoli, Konrad Klapheck, Johannes Grützke – und für mich die Ostdeutschen – viel wichtiger.
Mit den „Unbehausten“ von Baselitz meinen Sie die „Helden“ ![]() Die zwischen 1965 und 1966 entstandenen Arbeiten von Georg Baselitz werden nach den wiederkehrenden Bildtiteln wie „Ein neuer Typ“, „Rebell“ oder „Der Held“ und der Variation einer gebrochenen Figurendarstellung als Werkgruppe der „Helden“ oder „Neuen Typen“ bezeichnet. ?
Die zwischen 1965 und 1966 entstandenen Arbeiten von Georg Baselitz werden nach den wiederkehrenden Bildtiteln wie „Ein neuer Typ“, „Rebell“ oder „Der Held“ und der Variation einer gebrochenen Figurendarstellung als Werkgruppe der „Helden“ oder „Neuen Typen“ bezeichnet. ?
Ja, die sogenannten „Helden“, die ich allerdings erst später wahrgenommen habe.
Und die Werke, die zur Zeit der „Pandämonischen Manifeste“ entstanden sind, also Anfang der 60er-Jahre? ![]() Georg Baselitz (eigtl. Hans-Georg Kern; * 1938 Deutschbaselitz) und Eugen Schönebeck (* 1936 Heidenau) forderten in ihren Manifesten „Pandämonium I“ (1961) und „Pandämonium II“ (1962) eine neue Bildsprache, die sich von der vorherrschenden abstrakten Malerei absetzt und einen neuen Zugang zur Realität anstrebt. Sie rebellierten gegen die etablierten Kunstformen, gegen das Glatte und sprachen sich für einen neuen expressiven Malstil aus, so heißt es unter anderem: „Ihr seht in meinen Augen den Naturaltar, das Fleischesopfer, Speisereste in der Kloakenpfanne, Ausdünstungen der Bettlaken.“
Georg Baselitz (eigtl. Hans-Georg Kern; * 1938 Deutschbaselitz) und Eugen Schönebeck (* 1936 Heidenau) forderten in ihren Manifesten „Pandämonium I“ (1961) und „Pandämonium II“ (1962) eine neue Bildsprache, die sich von der vorherrschenden abstrakten Malerei absetzt und einen neuen Zugang zur Realität anstrebt. Sie rebellierten gegen die etablierten Kunstformen, gegen das Glatte und sprachen sich für einen neuen expressiven Malstil aus, so heißt es unter anderem: „Ihr seht in meinen Augen den Naturaltar, das Fleischesopfer, Speisereste in der Kloakenpfanne, Ausdünstungen der Bettlaken.“
Die kannte man in Westdeutschland noch nicht. Musste man sie kennen? Baselitz war kein Markstein der Kunstgeschichte, auch wenn uns das heute der Kunstbetrieb und vor allem der Markt einhämmern. Um Gottes Willen, wirklich nicht!
Es geht mir nicht speziell um Baselitz, sondern um den Umgang mit der deutschen Geschichte in der Kunst der Nachkriegszeit. Auch Anselm Kiefer hat sich damit beschäftigt.
Auch Kiefer ist für mich kein unabdingbarer Markstein. Tut mir leid.
Macht ja nichts. Sie müssen das nicht gut finden. Mich interessieren die Tendenzen. Wollte man das Thema „Krieg und Vergangenheit“ aus der Kunst raushalten? Waren das Informel und ZERO deshalb so erfolgreich?
Die entgleiste deutsche Geschichte war in der Kunst ein Gegenstand höchster Skepsis. Man wollte und musste die Geschichte überwinden, ja transzendieren. Die Abstraktion bot einen Ausstieg an, übrigens bald eine Droge für ein avanciertes Publikum. Daher der Erfolg. Reinheitsgebote – „reine Kunst“, „autonome Kunst“, „gegenstandslose Kunst“: Solche Schlagworte beherrschten in der Nachkriegszeit die Diskussion. Ohne behaupten zu wollen, dass ich in früher Jugend intellektuell auf der Höhe war: Diese Verdrängung war mir immer unheimlich. Ich habe an diese Auswege und Antworten auf Geschichte einfach nicht geglaubt. Ich war der Meinung, da müsste eigentlich etwas anderes stattfinden. Beuys markierte in dieser Hinsicht ein sehr starkes Memento.
Sie kannten damals die informelle Malerei, und Sie kannten die Malerei der älteren Generation, wie zum Beispiel Picasso …
Ernst Wilhelm Nay ![]() Ernst Wilhelm Nay (1902 Berlin – 1968 Köln) war ein deutscher Maler und Grafiker, der insbesondere für seine auf rhythmischen Farbspielen beruhenden Bildkompositionen bekannt ist. Zwischen 1924 und 1928 studierte er bei Karl Hofer an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin. In der Propagandaausstellung „Entartete Kunst“, die 1937 in München stattfand, waren zwei seiner Werke ausgestellt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zählte Nay zu den bekanntesten Vertretern der abstrakten Malerei. Er war auf der documenta 1 (1955), 2 (1959), und 3 (1964) vertreten. war damals die national beherrschende Figur. Seine Bilder schmückten die Foyers der Banken und Konzerne, aber auch die Salons des wieder arrivierten Bürgertums – übrigens wie heute die Werke von Gerhard Richter, nur dass Nay substanzieller und aufrichtiger war. Willi Baumeister,
Ernst Wilhelm Nay (1902 Berlin – 1968 Köln) war ein deutscher Maler und Grafiker, der insbesondere für seine auf rhythmischen Farbspielen beruhenden Bildkompositionen bekannt ist. Zwischen 1924 und 1928 studierte er bei Karl Hofer an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin. In der Propagandaausstellung „Entartete Kunst“, die 1937 in München stattfand, waren zwei seiner Werke ausgestellt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zählte Nay zu den bekanntesten Vertretern der abstrakten Malerei. Er war auf der documenta 1 (1955), 2 (1959), und 3 (1964) vertreten. war damals die national beherrschende Figur. Seine Bilder schmückten die Foyers der Banken und Konzerne, aber auch die Salons des wieder arrivierten Bürgertums – übrigens wie heute die Werke von Gerhard Richter, nur dass Nay substanzieller und aufrichtiger war. Willi Baumeister, ![]() Willi Baumeister (1889 Stuttgart – 1955 Stuttgart) studierte von 1909 bis 1912 bei Adolf Hölzel an der Kunstakademie Stuttgart und war von 1927 bis 1933 Professor an der Kunstgewerbeschule in Frankfurt am Main. Fünf seiner Arbeiten waren 1937 in der nationalsozialistischen Propagandaausstellung „Entartete Kunst“ ausgestellt. Von 1946 bis 1955 war Baumeister Professor für Dekorative Malerei an der Kunstakademie Stuttgart. Zu seinen bekanntesten Schülern zählen Peter Brüning, Winfred Gaul, Emil Kiess und Ludwig Wilding. ein Bindeglied zwischen den 20er- und den Nachkriegsjahren, war durch seinen Widerstand im Dritten Reich auch hochgeschätzt. Ich selbst habe während des Studiums im Kunstmuseum in Bonn an einer Ausstellung des noblen russisch-französischen Abstrakten Serge Poliakoff
Willi Baumeister (1889 Stuttgart – 1955 Stuttgart) studierte von 1909 bis 1912 bei Adolf Hölzel an der Kunstakademie Stuttgart und war von 1927 bis 1933 Professor an der Kunstgewerbeschule in Frankfurt am Main. Fünf seiner Arbeiten waren 1937 in der nationalsozialistischen Propagandaausstellung „Entartete Kunst“ ausgestellt. Von 1946 bis 1955 war Baumeister Professor für Dekorative Malerei an der Kunstakademie Stuttgart. Zu seinen bekanntesten Schülern zählen Peter Brüning, Winfred Gaul, Emil Kiess und Ludwig Wilding. ein Bindeglied zwischen den 20er- und den Nachkriegsjahren, war durch seinen Widerstand im Dritten Reich auch hochgeschätzt. Ich selbst habe während des Studiums im Kunstmuseum in Bonn an einer Ausstellung des noblen russisch-französischen Abstrakten Serge Poliakoff ![]() Serge Poliakoff (1900 Moskau – 1969 Paris) flüchtete vor der Russischen Revolution im Jahr 1917 und gelangte über Umwege nach Paris, wo er ab 1929 Kunst studierte. Er zählt zu den zentralen Vertretern der École de Paris. mitgearbeitet. Die École de Paris war ja ein frühes Leitbild der westdeutschen Nachkriegskunst. Das war das, was lange en vogue war, bevor die Amerikaner auftauchten.
Serge Poliakoff (1900 Moskau – 1969 Paris) flüchtete vor der Russischen Revolution im Jahr 1917 und gelangte über Umwege nach Paris, wo er ab 1929 Kunst studierte. Er zählt zu den zentralen Vertretern der École de Paris. mitgearbeitet. Die École de Paris war ja ein frühes Leitbild der westdeutschen Nachkriegskunst. Das war das, was lange en vogue war, bevor die Amerikaner auftauchten.
Wer war der erste Künstler, den Sie kennengelernt haben, der sich mit der jüngsten Vergangenheit auseinandersetzte?
Jetzt kommt der Hammer, das hat meine Begeisterung für die bundesdeutsche Kunst nachhaltig gedämpft: Es war Ende der 60er-Jahre die Entdeckung der Kunst in der DDR, besonders der Leipziger Malerei, die man im Westen bis heute zu ignorieren, zu bekämpfen und auszuschalten versucht. In Leipzig hatte Werner Tübke ![]() Werner Tübke (1929 Schönebeck an der Elbe – 2004 Leipzig) gehört mit Bernhard Heisig und Wolfgang Mattheuer zu den Hauptvertretern der Leipziger Schule. Bekannt ist er vor allem für seine Historienbilder im altmeisterlichen Stil. Viele seiner Arbeiten sind als Auftragswerke der DDR-Regierung entstanden. Tübke studierte ab 1948 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und wechselte 1950 an die Universität Greifswald, wo er Kunsterziehung und Psychologie studierte. Ab 1955 war er Assistent an der Leipziger Hochschule, wo er 1957 aus politischen Gründen entlassen wurde. Nachdem er 1962 wieder eingestellt worden war, stand er der Hochschule von 1973 bis 1976 als Rektor vor. 1971 reiste Tübke zum ersten Mal nach Italien, 1976 nach Frankreich und in die BRD. Tübke war 1977 auf der „documenta 6“ vertreten. Zu seinen Schülern gehörten unter anderen Sighard Gille, Wolfgang Peuker und Arno Rink. in den 60er-Jahren einen umfassenden Zyklus zum Naziterror und zum Holocaust geschaffen, der 12 Bilder und um die 60 Zeichnungen umfasst. Nach Besuchen und Gesprächen in Leipziger Ateliers begann ich, grundsätzlich am allein seligmachenden Westkunst-Weg zu zweifeln. Hier eröffneten sich andere, zum Teil fundamentalere Wege.
Werner Tübke (1929 Schönebeck an der Elbe – 2004 Leipzig) gehört mit Bernhard Heisig und Wolfgang Mattheuer zu den Hauptvertretern der Leipziger Schule. Bekannt ist er vor allem für seine Historienbilder im altmeisterlichen Stil. Viele seiner Arbeiten sind als Auftragswerke der DDR-Regierung entstanden. Tübke studierte ab 1948 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und wechselte 1950 an die Universität Greifswald, wo er Kunsterziehung und Psychologie studierte. Ab 1955 war er Assistent an der Leipziger Hochschule, wo er 1957 aus politischen Gründen entlassen wurde. Nachdem er 1962 wieder eingestellt worden war, stand er der Hochschule von 1973 bis 1976 als Rektor vor. 1971 reiste Tübke zum ersten Mal nach Italien, 1976 nach Frankreich und in die BRD. Tübke war 1977 auf der „documenta 6“ vertreten. Zu seinen Schülern gehörten unter anderen Sighard Gille, Wolfgang Peuker und Arno Rink. in den 60er-Jahren einen umfassenden Zyklus zum Naziterror und zum Holocaust geschaffen, der 12 Bilder und um die 60 Zeichnungen umfasst. Nach Besuchen und Gesprächen in Leipziger Ateliers begann ich, grundsätzlich am allein seligmachenden Westkunst-Weg zu zweifeln. Hier eröffneten sich andere, zum Teil fundamentalere Wege.
Im Westen galt die Parole: „Je reiner die Kunst, umso besser.“ In New York bei Clement Greenberg hieß es, je flächiger, das heißt je illusionsloser die Malerei ist, desto besser … Das ist Ästhetizismus, im Grunde pure ästhetische Ideologie. Man könnte es umdrehen: Je unreiner die Kunst ist, je mehr sie kämpfen und sich auseinandersetzen muss, umso besser kann sie sein. Mag sie dabei auch manchmal stranden und scheitern, mögen Schleifspuren bleiben. Das hat übrigens Günter Grass später sehr gut gesehen, als der Kulturkampf West gegen Ost losging. Er meinte, die Ostdeutschen seien die ehrlicheren Künstler, sie hätten „die Erblast angenommen“ und quälten sich damit.
Apropos ZERO, wonach Sie fragten: Das war nach dem irrationalen, dunklen Rausch des Informel zweifellos ein Lichtblick, ein Fest der Lichtmalerei und der Schönheit. Übrigens: Heute sollte man all die Fortschrittsparameter und Reinheitsgebote, die sich zu Tode gesiegt haben, vergessen und zur Qualität als höchstem Kunstkriterium zurückkehren, wie es die besten Sammlungsleiter der Nachkriegszeit, allen voran Werner Schmalenbach, praktiziert haben. In dieser Kategorie waren die ZERO-Künstler in der Tat sehr gut. Ihre Qualität honoriert ihnen bis heute der Kunstmarkt.
Können Sie sich an die ersten Arbeiten aus dem Umfeld der ZERO-Künstler erinnern?
Im Rheinischen – Düsseldorf, Köln, Bonn –, später auch in Frankfurt, sah man einiges, aber große Ausstellungen habe ich damals nicht gesehen. Unvergessen ist der Auftritt bei der dritten documenta, 1964. Da bespielte ZERO im Fridericianum unterm Dach eine große Bühne. ![]() Am 23. Februar verfassten Peter Brüning, Karl Fred Dahmen, Winfred Gaul, K.O. Götz, Heinz Mack, Otto Piene und andere das sogenannte „Düsseldorfer Manifest“. Darin kritisierten sie die Ausrichtung der „documenta 3“. Dem Schreiben folgte eine öffentliche Fernsehdebatte. Aufgrund der Proteste gewährte das documenta-Team unter der Leitung von Arnold Bode den ZERO-Künstlern kurzfristig die Teilnahme. Im Dachgeschoss des Fridericianums installierten Heinz Mack, Otto Piene und Günther Uecker daraufhin eine „Hommage à Fontana“. Siehe auch: Ulrike Schmitt, „Zero ist gut für Dich“, in: „Zero ist gut für Dich“, Reihe „sediment. Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels“, Nr. 10, 2006, S. 9–33, hier S. 25–26. Aufgeboten waren auch Op-Art und kinetische Kunst. Der Galerist Hans Mayer, der zeitweise mit der Pariser Galerie Denise René zusammenarbeitete, siedelte damals aus dem Schwäbischen nach Krefeld und dann nach Düsseldorf über und bot fortan auf allen Kunstmärkten immer hochästhetisch möblierte Schaufenster für diese Kunst. Mayer präsentierte sie fast alle, samt dem Ahnherr Josef Albers.
Am 23. Februar verfassten Peter Brüning, Karl Fred Dahmen, Winfred Gaul, K.O. Götz, Heinz Mack, Otto Piene und andere das sogenannte „Düsseldorfer Manifest“. Darin kritisierten sie die Ausrichtung der „documenta 3“. Dem Schreiben folgte eine öffentliche Fernsehdebatte. Aufgrund der Proteste gewährte das documenta-Team unter der Leitung von Arnold Bode den ZERO-Künstlern kurzfristig die Teilnahme. Im Dachgeschoss des Fridericianums installierten Heinz Mack, Otto Piene und Günther Uecker daraufhin eine „Hommage à Fontana“. Siehe auch: Ulrike Schmitt, „Zero ist gut für Dich“, in: „Zero ist gut für Dich“, Reihe „sediment. Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels“, Nr. 10, 2006, S. 9–33, hier S. 25–26. Aufgeboten waren auch Op-Art und kinetische Kunst. Der Galerist Hans Mayer, der zeitweise mit der Pariser Galerie Denise René zusammenarbeitete, siedelte damals aus dem Schwäbischen nach Krefeld und dann nach Düsseldorf über und bot fortan auf allen Kunstmärkten immer hochästhetisch möblierte Schaufenster für diese Kunst. Mayer präsentierte sie fast alle, samt dem Ahnherr Josef Albers.
Die ZERO-Künstler sagen, sie wurden zur „documenta 3“ nachgeladen. So richtig zufrieden waren sie mit ihrer Beteiligung offenbar nicht. ![]() Vgl. Heinz Mack.
Vgl. Heinz Mack.
Zugedacht war ihnen unterm Dach ein Spielfeld mit vielen Durchblicken. Da ratterte, glitzerte, spiegelte und bewegte es sich. Es ist natürlich immer misslich, in der Herde zu erscheinen. Man muss jedes Objekt einzeln betrachten können, dann erst wirkt es. Wenn man 30 Lichtspiele auf einem Haufen hat, wird daraus leicht eine Spielhölle. Andererseits manifestierte sich hier ein Durchbruch auf breiter Front. Das haben die Künstler sicher auch gerne mitgemacht, weil sie wussten, dass man in der Gruppe stärker ist. Die Ästhetik des 20. Jahrhunderts läuft ja vielfach sozusagen über Bünde, über Ismen und kollektive Zielvorstellungen. Im Konstruktivismus und Surrealismus hätte sich der Einzelne wohl auch nicht so durchgesetzt wie im Verbund.
Wobei Beuys dagegenhält, oder?
Beuys ist eine Einzelfigur. Am stärksten war es aber der große Picasso. Als es für ihn mit dem Kubismus zu viel wurde, als ihn bald alle nachahmten, hat er ihn schnell wieder aufgegeben: Er hat den Modus gewechselt, beziehungsweise den kubistischen Modus in eine sich modifizierende und erweiternde Syntax seiner Bildsprache eingebaut. Picasso hat nie in der Gruppe funktioniert.
Was war das Erfolgskonzept von Beuys?
Zweifellos das natürliche Charisma, die Gabe, sich Menschen zuzuwenden und sie anzuziehen. Eine gewisse, später fast freundschaftliche Nähe zwischen uns ergab sich früh, weil in Bonn einer der Brüder van der Grinten Landwirtschaft studierte und der andere am selben Institut wie ich Kunstgeschichte. ![]() Die Brüder Hans van der Grinten (1929 Kranenburg – 2002 Essen) und Franz-Joseph van der Grinten (* 1933 Kranenburg) gelten als große Förderer von Joseph Beuys. 1951 erwarben sie die ersten Arbeiten des Künstlers, dem sie 1953 im Elternhaus in Kranenburg bei Kleve eine Ausstellung ausrichteten. Die Brüder van der Grinten sind Mitstifter des Museums Schloss Moyland, das 1990 gegründet wurde und insgesamt circa 6.000 Werke sowie das angeschlossene Joseph Beuys Archiv umfasst. Eines Tages kam der eine mit einem Packen Beuys-Zeichnungen ins Seminar, die er für 30 oder 40 Mark pro Stück anbot. Leider, leider habe ich damals nicht zugegriffen, wohl aber mein aus der DDR geflohener Freund, der eigentlich auf das 19. Jahrhundert fixiert war. So wehte schon um 1960 der Geist von Beuys durch das ehrwürdige, fast klösterliche Bonner Institut. Beuys war bald im Rheinischen eine – natürlich zunächst umstrittene – Größe.
Die Brüder Hans van der Grinten (1929 Kranenburg – 2002 Essen) und Franz-Joseph van der Grinten (* 1933 Kranenburg) gelten als große Förderer von Joseph Beuys. 1951 erwarben sie die ersten Arbeiten des Künstlers, dem sie 1953 im Elternhaus in Kranenburg bei Kleve eine Ausstellung ausrichteten. Die Brüder van der Grinten sind Mitstifter des Museums Schloss Moyland, das 1990 gegründet wurde und insgesamt circa 6.000 Werke sowie das angeschlossene Joseph Beuys Archiv umfasst. Eines Tages kam der eine mit einem Packen Beuys-Zeichnungen ins Seminar, die er für 30 oder 40 Mark pro Stück anbot. Leider, leider habe ich damals nicht zugegriffen, wohl aber mein aus der DDR geflohener Freund, der eigentlich auf das 19. Jahrhundert fixiert war. So wehte schon um 1960 der Geist von Beuys durch das ehrwürdige, fast klösterliche Bonner Institut. Beuys war bald im Rheinischen eine – natürlich zunächst umstrittene – Größe.
Es gab im Prinzip zwei Positionen, die Sie mit Ihrer Arbeit bei der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ maßgeblich unterstützt haben. Das war einerseits Joseph Beuys, als er Hilfe brauchte – oder als die Kunst Hilfe brauchte –, und andererseits waren es die Künstler aus der DDR. Beuys war früher.
Genau genommen fand das alles gleichzeitig und parallel statt. Es war eben eine tolle, mit Ereignissen prall gefüllte Zeit. Das spektakulärste Ereignis gegen Ende der 60er-Jahre war das Auftauchen der New Yorker Pop-Art, die dank der Sammler Ströher ![]() Der Sammler und Unternehmer Karl Ströher (1890 Rothenkirchen –1977 Darmstadt) erwarb 1968 die bedeutende Pop-Art-Sammlung des verstorbenen New Yorker Versicherungsmaklers Leon Kraushar. Die Sammlung umfasste 160 Objekte, darunter 6 Bilder von Roy Lichtenstein, 21 Objekte von Claes Oldenburg, 6 Bilder und Objekte von Andy Warhol, 15 Bilder von James Rosenquist, 7 Bilder von Tom Wesselmann sowie weitere Werke amerikanischer Künstler, unter anderem von Jasper Johns und Walter De Maria. und Ludwig
Der Sammler und Unternehmer Karl Ströher (1890 Rothenkirchen –1977 Darmstadt) erwarb 1968 die bedeutende Pop-Art-Sammlung des verstorbenen New Yorker Versicherungsmaklers Leon Kraushar. Die Sammlung umfasste 160 Objekte, darunter 6 Bilder von Roy Lichtenstein, 21 Objekte von Claes Oldenburg, 6 Bilder und Objekte von Andy Warhol, 15 Bilder von James Rosenquist, 7 Bilder von Tom Wesselmann sowie weitere Werke amerikanischer Künstler, unter anderem von Jasper Johns und Walter De Maria. und Ludwig ![]() Peter Ludwig (1925 Koblenz – 1996 Aachen) war ein deutscher Industrieller und international agierender Kunstmäzen, der ab 1969 eine der bedeutendsten Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst aufbaute. Durch Schenkungen und Leihgaben etablierte Ludwig zahlreiche Kooperationen zwischen öffentlichen Trägern und seiner Privatsammlung. Die Stadt Köln erhielt 1976 eine umfangreiche Auswahl seiner Sammlung – unter der Voraussetzung, für diese einen eigenen Präsentationsort, das heutige Museum Ludwig, zu errichten. 1982 gründeten Peter und Irene Ludwig die Ludwig Stiftung für Kunst und internationale Verständigung, die nach dem Tod Peter Ludwigs 1996 in die Peter und Irene Ludwig Stiftung überging. Vgl. Heinz Bude, „Peter Ludwig. Im Glanz der Bilder“, Bergisch Gladbach 1993. ihren triumphalen europäischen Durchbruch vor allem in der Bundesrepublik hatte. Übrigens nicht nur in Europa: Die hochmütigen, dogmatischen New Yorker Modernisten standen Pop noch lange reserviert gegenüber.
Peter Ludwig (1925 Koblenz – 1996 Aachen) war ein deutscher Industrieller und international agierender Kunstmäzen, der ab 1969 eine der bedeutendsten Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst aufbaute. Durch Schenkungen und Leihgaben etablierte Ludwig zahlreiche Kooperationen zwischen öffentlichen Trägern und seiner Privatsammlung. Die Stadt Köln erhielt 1976 eine umfangreiche Auswahl seiner Sammlung – unter der Voraussetzung, für diese einen eigenen Präsentationsort, das heutige Museum Ludwig, zu errichten. 1982 gründeten Peter und Irene Ludwig die Ludwig Stiftung für Kunst und internationale Verständigung, die nach dem Tod Peter Ludwigs 1996 in die Peter und Irene Ludwig Stiftung überging. Vgl. Heinz Bude, „Peter Ludwig. Im Glanz der Bilder“, Bergisch Gladbach 1993. ihren triumphalen europäischen Durchbruch vor allem in der Bundesrepublik hatte. Übrigens nicht nur in Europa: Die hochmütigen, dogmatischen New Yorker Modernisten standen Pop noch lange reserviert gegenüber.
Pop mussten Sie aber nicht fördern oder unterstützen?
Nein, aber es galt, die Sammler zu motivieren und zu stützen, die Kulturbürokratie zu überzeugen und das Publikum zu begeistern. Die Pop-Art hatte etwas Befreiendes, ja Erlösendes nach den grauen, irgendwie dumpfen, verengten und auch teutonischen 50er-Jahren. Da kamen plötzlich diese ungestümen New Yorker mit ihrer Ausbeutung und vitalen Verherrlichung der zuvor so missachteten Zivilisationsästhetik. Solchen Enthusiasmus konnten auch die Kinetiker und die ZERO-Leute nicht erzeugen. An das strahlende Weiß gewöhnt man sich, aber diese Orgien von derber, zugleich ironischer Lebenslust in den Bildern von Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg und Oldenburg rissen mit und erregten eine Hochstimmung, die auch das Ätzen der Linken nicht vertreiben konnte. Während der Etablierung der Ströher-Sammlung im Darmstädter Landesmuseum kam ich mit den Künstlern – speziell mit dem sehr sympathischen George Segal, aber auch mit Warhol – persönlich in Verbindung. Das waren großartige, souveräne Typen.
Die bewusstseinserweiternden Substanzen haben in dieser Zeit in bestimmten Künstlerkreisen sicherlich keine ganz unbedeutende Rolle gehabt. Das Umfeld um Warhol oder Polke war voll davon … Viele sind letztendlich daran zugrunde gegangen.
Wenn ich an diesem Punkt etwas einschieben darf, was die deutsche Szene angeht: Es gab in München einen Dr. Richard P. Hartmann, übrigens der Sohn von Karl Amadeus Hartmann, dem Komponisten. Er war Mediziner und betrieb eine Galerie und Edition. Hartmann hat in einer Ausstellung in der Galerie Brumme 1969 die Ergebnisse seiner Drogenexperimente präsentiert: Er zeigte im Vergleich die Werke von etwa zehn Künstlern, die ohne den Einfluss und auf der anderen Seite unter dem Einfluss von LSD entstanden waren. Man konnte also die Veränderungen, die Entfesselungen anschaulich studieren.
Unter dem Einfluss von LSD entstand vor allem sehr farbenfrohe Kunst. Sie haben die 50er-Jahre gerade als grau und dumpf beschrieben. Obwohl das Farbspektrum bei Beuys auch eher grau und braun war, waren Sie von seinem Werk irgendwie angezogen …
Beuys hatte eine ganz andere Dimension. Er strapazierte die Nerven und Sinne, er hatte exhibitionistische Züge und ging an existenzielle Wurzeln. Auf diese Art Bußästhetik hatte man lange gewartet. Das Verderben und die Vergänglichkeit wurden hier ohne jede ästhetische Beschönigung in krudester, drastischer Form beschworen, Erinnerungen an die Lagerwelten und das große Sterben kamen auf.
Können Sie das noch genauer beschreiben?
Erst einmal ist das Werk von der Person Beuys nicht zu trennen. Er verbarg seine Abgründe hinter einer gewissen rheinischen Verschlagenheit, überspielte sie mit einer fast abenteuerlichen, halsbrecherischen Intelligenz, die oft arg danebenlag und verbal auch großen Unsinn produzierte. Mit suggestivem, durchdringendem Charme wusste er trotzdem Menschen anzusprechen und zu gewinnen. Beuys war dabei kein Demagoge, er arbeitete nicht mit Tricks, nein, von dem Mann ging tiefe, rätselhafte Menschlichkeit aus.
Jetzt kommen wir auf die Darmstädter Geschichte – da habe ich mithilfe der „F.A.Z.“ eine gewisse Rolle gespielt. Die bildende Kunst und das Engagement für die Moderne waren, dank so großartiger Kritiker wie Will Grohmann ![]() Will Grohmann (1887 Bautzen – 1968 Berlin) war ein Kunsthistoriker, Kurator und Kritiker, der als wichtiger Vermittler der modernen und zeitgenössischen Kunst seiner Zeit gilt. Von 1908 bis 1913 studierte er Kunstgeschichte, Literatur, Geschichte, Philosophie und Orientalistik in Leipzig und Paris. Ab 1926 war er Mitarbeiter an der Staatlichen Gemäldegalerie Dresden. 1933 wurde er per Ruhestandsregelung aus allen Ämtern entlassen. Im gleichen Jahr wurde er Mitglied im Reichsverband der Deutschen Schriftsteller, ab 1936 war er auch Mitglied in der Reichsschrifttumskammer. Grohmann publizierte in dieser Zeit unter anderem in „Cahiers d'art“, „Deutsche Allgemeine Zeitung“ und „Das Reich“. 1946 wurde er Rektor der Hochschule für Werkkunst in Dresden, 1948 siedelte er nach West-Berlin über und lehrte dort als Professor für Kunstgeschichte an der Hochschule für Bildende Künste. Ab 1948 war er auch Chefkritiker der „Neuen Zeitung“ und arbeitete für den RIAS in Berlin. Ab 1955 war er außerdem für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und den „Tagesspiegel“ tätig. – ein Mitarbeiter vor meiner Zeit – und Albert Schulze Vellinghausen
Will Grohmann (1887 Bautzen – 1968 Berlin) war ein Kunsthistoriker, Kurator und Kritiker, der als wichtiger Vermittler der modernen und zeitgenössischen Kunst seiner Zeit gilt. Von 1908 bis 1913 studierte er Kunstgeschichte, Literatur, Geschichte, Philosophie und Orientalistik in Leipzig und Paris. Ab 1926 war er Mitarbeiter an der Staatlichen Gemäldegalerie Dresden. 1933 wurde er per Ruhestandsregelung aus allen Ämtern entlassen. Im gleichen Jahr wurde er Mitglied im Reichsverband der Deutschen Schriftsteller, ab 1936 war er auch Mitglied in der Reichsschrifttumskammer. Grohmann publizierte in dieser Zeit unter anderem in „Cahiers d'art“, „Deutsche Allgemeine Zeitung“ und „Das Reich“. 1946 wurde er Rektor der Hochschule für Werkkunst in Dresden, 1948 siedelte er nach West-Berlin über und lehrte dort als Professor für Kunstgeschichte an der Hochschule für Bildende Künste. Ab 1948 war er auch Chefkritiker der „Neuen Zeitung“ und arbeitete für den RIAS in Berlin. Ab 1955 war er außerdem für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und den „Tagesspiegel“ tätig. – ein Mitarbeiter vor meiner Zeit – und Albert Schulze Vellinghausen ![]() Albert Schulze Vellinghausen (1905 Bochum – 1967 Bochum) war ein deutscher Übersetzer, Sammler und Kunstkritiker und gilt als wichtiger Unterstützer der Nachkriegskunst im Rheinland. Ab 1953 war Schulze Vellinghausen als ständiger Korrespondent der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ für die Berichterstattung über das kulturelle Leben in Nordrhein-Westfalen zuständig. , eine Spezialität der Zeitung. Diese Leidenschaft wurde von dem damaligen Feuilletonherausgeber Karl Korn
Albert Schulze Vellinghausen (1905 Bochum – 1967 Bochum) war ein deutscher Übersetzer, Sammler und Kunstkritiker und gilt als wichtiger Unterstützer der Nachkriegskunst im Rheinland. Ab 1953 war Schulze Vellinghausen als ständiger Korrespondent der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ für die Berichterstattung über das kulturelle Leben in Nordrhein-Westfalen zuständig. , eine Spezialität der Zeitung. Diese Leidenschaft wurde von dem damaligen Feuilletonherausgeber Karl Korn ![]() Karl Korn (1908 Wiesbaden – 1991 Bad Homburg) war von 1938 bis 1940 Redakteur der Zeitschrift „Die Neue Rundschau“ des S. Fischer Verlags. Ab 1949 war er Feuilletonredakteur und -herausgeber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. sehr gefördert. Den Einfluss der „F.A.Z.“ auch auf Künstler können Sie an dem berühmten Schrank
Karl Korn (1908 Wiesbaden – 1991 Bad Homburg) war von 1938 bis 1940 Redakteur der Zeitschrift „Die Neue Rundschau“ des S. Fischer Verlags. Ab 1949 war er Feuilletonredakteur und -herausgeber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. sehr gefördert. Den Einfluss der „F.A.Z.“ auch auf Künstler können Sie an dem berühmten Schrank ![]() Joseph Beuys, „Szene aus der Hirschjagd (Plastisches Objekt zur Sibirischen Symphonie)“, 1961, Hessisches Landesmuseum Darmstadt.
Joseph Beuys, „Szene aus der Hirschjagd (Plastisches Objekt zur Sibirischen Symphonie)“, 1961, Hessisches Landesmuseum Darmstadt. 
Das Rhein-Main-Gebiet mit Frankfurt als Zentrum war damals in Sachen moderner Kunst, verglichen mit Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen oder Bayern, die wunderbare Sammlungen aufbauten, ein unterentwickeltes Gelände. Ein kleiner Lichtblick war allenfalls das Museum in Wiesbaden, wo sich Clemens Weiler stark für das Informel engagierte.
Ein großer Schub kam dann Ende der 60er-Jahre von dem Darmstädter Unternehmer und Wella-Chef Karl Ströher. Er war ein neugieriger, bald 80-jähriger Mann, der in der Kunst stets das spirituelle Abenteuer und die eigene Verjüngung suchte. In seiner Leidenschaft war Ströher geradlinig, in seiner Taktik und seinen Vorlieben durchaus schwankend und schillernd. In einem deutsch-idealistischen, bildungsbürgerlichen Rahmen wechseln die Leitsterne und Passionen: von den Deutschrömern und Romantikern über die im Dritten Reich verfemte Moderne bis zu Tendenzen der Nachkriegskunst. Wechselnde Händler und Ratgeber, darunter auch Will Grohmann, erschlossen ihm nacheinander den Zugang auch zu den Franzosen (mit Jean Dubuffet als Zentralfigur), den Engländern (vor allem Francis Bacon) und Spaniern (Antoni Tàpies, Antonio Saura, Manolo Millares).
In den Jahren 1967 und 68 änderte sich die Richtung der Ströher-Sammlung abrupt. Zwei junge Münchener Händler, Heiner Friedrich und Franz Dahlem, gewannen mit einiger List die Oberhand beim Einfluss auf Ströher, der als Sammler im hohen Alter noch eine ganz große Tat vollbringen wollte. Unter jeweils abenteuerlichen Umständen galt der erste Schritt dem Erwerb umfassender Werkkomplexe von Beuys (mit einem möglichen Zugriff auf „Beuys total“), der zweite der noch spektakuläreren Akquisition der Pop-Sammlung des damals plötzlich verstorbenen New Yorker Maklers Leon Kraushar. ![]() Franz Dahlem (* 1938 München), Heiner Friedrich (* 1938 Stettin, Pommern, heute Polen) und Six Friedrich (* 1938 Gelsenkirchen) eröffneten im Juli 1963 in München die Galerie Friedrich & Dahlem. Dort zeigten sie in den ersten Jahren unter anderem Werke von Uwe Lausen, Gerhard Richter, Francis Bacon, David Hockney, Cy Twombly, Georg Baselitz und Robert Rauschenberg. Zum Jahreswechsel 1966/67 eröffnete Dahlem eine eigene Galerie in Darmstadt und pflegte dort engen Kontakt zu dem Sammler Karl Ströher. Gemeinsam mit Heiner Friedrich vermittelte er Ströher 1968 die Sammlung Kraushar sowie den „Block Beuys“, den größten zusammenhängenden Werkkomplex von Joseph Beuys, der in den Jahren 1967 bis 1969 in mehreren Ankäufen von Ströher erworben wurde.
Franz Dahlem (* 1938 München), Heiner Friedrich (* 1938 Stettin, Pommern, heute Polen) und Six Friedrich (* 1938 Gelsenkirchen) eröffneten im Juli 1963 in München die Galerie Friedrich & Dahlem. Dort zeigten sie in den ersten Jahren unter anderem Werke von Uwe Lausen, Gerhard Richter, Francis Bacon, David Hockney, Cy Twombly, Georg Baselitz und Robert Rauschenberg. Zum Jahreswechsel 1966/67 eröffnete Dahlem eine eigene Galerie in Darmstadt und pflegte dort engen Kontakt zu dem Sammler Karl Ströher. Gemeinsam mit Heiner Friedrich vermittelte er Ströher 1968 die Sammlung Kraushar sowie den „Block Beuys“, den größten zusammenhängenden Werkkomplex von Joseph Beuys, der in den Jahren 1967 bis 1969 in mehreren Ankäufen von Ströher erworben wurde.
Besonders im Fall Beuys wurde ich zu einer publizistischen Intervention fast schon genötigt. Dahlem hatte sich in Darmstadt mit Blick auf Ströher mit einer Galerie etabliert und zum Auftakt hier im März 1967 als Köder die Beuys-Aktion „Hauptstrom“ ![]() Joseph Beuys und Henning Christiansen, „Hauptstrom“, Aktion zur Eröffnung der Ausstellung „Fettraum“, Galerie Franz Dahlem, Darmstadt, 20. März 1967. veranstaltet. Um Ströher zu überzeugen, brauchte es die Unterstützung durch eine Autorität. Die war natürlich nicht ich, der debütierende Kritiker, sondern die Zeitung, die für Ströher, wie es hieß, vor allem wegen ihres Wirtschaftsteils eine Art Evangelium darstellte. Es kam also ganz entscheidend darauf an, dass etwas in der „F.A.Z.“ erschien. Ich schrieb keinen enthusiastischen, eher einen staunenden, verständnisvoll-teilnehmenden, aber auch etwas distanzierten Artikel über das Beuys-Happening. Tatsächlich hat Ströher angebissen und die Reste der Darmstädter Aktion und schließlich fast das ganze Inventar der Mönchengladbacher Ausstellung
Joseph Beuys und Henning Christiansen, „Hauptstrom“, Aktion zur Eröffnung der Ausstellung „Fettraum“, Galerie Franz Dahlem, Darmstadt, 20. März 1967. veranstaltet. Um Ströher zu überzeugen, brauchte es die Unterstützung durch eine Autorität. Die war natürlich nicht ich, der debütierende Kritiker, sondern die Zeitung, die für Ströher, wie es hieß, vor allem wegen ihres Wirtschaftsteils eine Art Evangelium darstellte. Es kam also ganz entscheidend darauf an, dass etwas in der „F.A.Z.“ erschien. Ich schrieb keinen enthusiastischen, eher einen staunenden, verständnisvoll-teilnehmenden, aber auch etwas distanzierten Artikel über das Beuys-Happening. Tatsächlich hat Ströher angebissen und die Reste der Darmstädter Aktion und schließlich fast das ganze Inventar der Mönchengladbacher Ausstellung ![]() „Joseph Beuys“, Städtisches Museum Mönchengladbach, 13. September – 29. Oktober 1967. erworben.
„Joseph Beuys“, Städtisches Museum Mönchengladbach, 13. September – 29. Oktober 1967. erworben.
Das noch größere Ding aber war, dass Friedrich und Dahlem mit durchtriebenem Geschick Ströher dazu brachten, die überhaupt erste Pop-Kollektion, die von Leon Kraushar, der noch vor Robert Scull ![]() Robert C. Scull (1915 New York – 1986 Warren) war ein US-amerikanischer Taxiunternehmer und Kunstsammler. Während der 1960er- und 1970er-Jahre baute er eine der umfassendsten Sammlungen von Pop-Art, Minimal Art und Land-Art auf. Vertreten waren unter anderen Michael Heizer, Jasper Johns, Walter De Maria, Robert Rauschenberg, James Rosenquist und Andy Warhol. die jungen New Yorker gesammelt hatte, en bloc zu kaufen. Diese Tat eines fast 80-Jährigen sorgte in Europa, in Hessen, in Darmstadt und nicht zuletzt in der Ströher-Familie für einige Aufregung, für Begeisterung wie für Entsetzen. Ströhers Entschluss war sicher auch für Peter Ludwig ein letzter Anstoß, im gleichen Jahr und im großen Stil New Yorker Kunst zu kaufen und seine weltberühmte Pop-Sammlung aufzubauen. Um Ströher, der nicht zuletzt wegen des damals horrenden Ankaufspreises auch in die familiäre Kritik geriet, beizuspringen, hat ihm Ludwig mehrere Pop-Bilder zu Stützungspreisen abgekauft. Die Staatsgalerie in Stuttgart erwarb von Ströher das Warhol-Bild „White Disaster“
Robert C. Scull (1915 New York – 1986 Warren) war ein US-amerikanischer Taxiunternehmer und Kunstsammler. Während der 1960er- und 1970er-Jahre baute er eine der umfassendsten Sammlungen von Pop-Art, Minimal Art und Land-Art auf. Vertreten waren unter anderen Michael Heizer, Jasper Johns, Walter De Maria, Robert Rauschenberg, James Rosenquist und Andy Warhol. die jungen New Yorker gesammelt hatte, en bloc zu kaufen. Diese Tat eines fast 80-Jährigen sorgte in Europa, in Hessen, in Darmstadt und nicht zuletzt in der Ströher-Familie für einige Aufregung, für Begeisterung wie für Entsetzen. Ströhers Entschluss war sicher auch für Peter Ludwig ein letzter Anstoß, im gleichen Jahr und im großen Stil New Yorker Kunst zu kaufen und seine weltberühmte Pop-Sammlung aufzubauen. Um Ströher, der nicht zuletzt wegen des damals horrenden Ankaufspreises auch in die familiäre Kritik geriet, beizuspringen, hat ihm Ludwig mehrere Pop-Bilder zu Stützungspreisen abgekauft. Die Staatsgalerie in Stuttgart erwarb von Ströher das Warhol-Bild „White Disaster“ ![]() Andy Warhol, „White Disaster I“, 1963. . Alle diese und die nachfolgenden Turbulenzen, die triumphale Tournee der Sammlung durch die Bundesrepublik und West-Berlin, die Verwicklungen und Desaster, vor allem auch das Versagen der hessischen Kulturpolitik, und auf der anderen Seite die glorreichen Kampagnen Ludwigs im Rheinland begleitete ich publizistisch. Die Ströher-Story habe ich später detailliert für die vom Frankfurter Museum für Moderne Kunst herausgegebene Ströher-Monografie (2005) recherchiert und erzählt.
Andy Warhol, „White Disaster I“, 1963. . Alle diese und die nachfolgenden Turbulenzen, die triumphale Tournee der Sammlung durch die Bundesrepublik und West-Berlin, die Verwicklungen und Desaster, vor allem auch das Versagen der hessischen Kulturpolitik, und auf der anderen Seite die glorreichen Kampagnen Ludwigs im Rheinland begleitete ich publizistisch. Die Ströher-Story habe ich später detailliert für die vom Frankfurter Museum für Moderne Kunst herausgegebene Ströher-Monografie (2005) recherchiert und erzählt. ![]() Eduard Beaucamp, „Bruchstücke eines Denkmals“, in: Katrin Sauerländer (Hg.), „Karl Ströher. Eine Sammlergeschichte“, in Zusammenarbeit mit dem MMK – Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main 2005, S. 184–197.
Eduard Beaucamp, „Bruchstücke eines Denkmals“, in: Katrin Sauerländer (Hg.), „Karl Ströher. Eine Sammlergeschichte“, in Zusammenarbeit mit dem MMK – Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main 2005, S. 184–197.
Sie sind ein ausgewiesener Skeptiker, das sagen Sie ja selbst über sich …
Damals war ich doch noch recht enthusiastisch.
Haben Sie Mitte/Ende der 60er-Jahre versucht, alles aufzunehmen und überall dabei zu sein?
Das war unmöglich. Ich war sesshaft in der Redaktion verankert, von wo aus man das Geschehen mithilfe von Korrespondenten auch kulturpolitisch steuern konnte. Die kontroverse Vielfalt der Ereignisse, der man gerecht werden musste, zwang natürlich zum Pluralismus. Ich bin nicht einseitig auf Kunst aus der DDR fixiert, die Pop-Art war genauso wichtig. Oder Beuys. Sie müssen doch vieles nebeneinander sehen lernen und zu verstehen versuchen. In der Renaissance oder im Barock müssen Sie auch katholischer wie protestantischer Kunst, italienischer wie holländischer Kunst, Guido Reni wie Rubens und Rembrandt gerecht werden. Ich gehöre nicht einer Partei oder Sekte an.
Außerdem meldete ich schon Anfang der 70er-Jahre theoretisch begründete Zweifel an der Haltbarkeit und weiteren Zukunftsfähigkeit der modernen Avantgardeästhetik an und begann, nach Alternativen Ausschau zu halten. Das brachte mir im Kunstbetrieb, den ich damit tief kränkte, dauerhaft viel Feindschaft ein. Ich galt wohl als Spielverderber, wenn nicht gar als Verräter. Werner Hofmann schrieb damals in der „Süddeutschen“, ich sei nicht mehr als ein Hund, der den Mond anbellt.
Wenn wir jetzt auf das umstrittenste Thema, die Kunst in der DDR, zu sprechen kommen: Ich vermeide den Begriff „DDR-Kunst“. Man sagt auch nicht „BRD-Kunst“. Es geht um Kunst in der DDR, und zwar um die Hochkunst in der DDR, nicht um die dienstbare Politproduktion. Es geht vor allem immer um einzelne Künstler. Gute Künstler sind Exzentriker und extreme Individualisten. Gerade in der DDR sind es Charaktere, die durch die vielen heftigen Auseinandersetzungen geprägt und gewachsen sind.
Die „F.A.Z.“ war und ist konservativ und antikommunistisch. Es gab viele Kollegen, die aus der DDR geflohen waren, darunter auch mehrere Herausgeber. Aber in künstlerischen Dingen war die Zeitung sehr liberal. Es war übrigens leichter, das Publikum für die Leipziger Malerei zu gewinnen als für Beuys. Die Zeitung ermunterte uns, in die DDR zu fahren.1968 grassierte ja der linke Virus. Mich befiel er nicht, da ich gegenüber Ideologien immun bin. Wir sollten aus Gründen der Prophylaxe den real existierenden Sozialismus kennenlernen.
Für die Leipziger Messe brauchten wir kein Visum. Dort bekam man am Eingang der Messe eine Einreisegenehmigung. Ich nutzte die Gelegenheit, um das Bildermuseum, das damals noch im alten Reichsgerichtsgebäude untergebracht war, zu besuchen. Ich wollte vor allem Zeichnungen von Max Klinger sehen, deren Vorlage aber nur mit Erlaubnis des Direktors möglich war. Gerhard Winkler, der als Hardliner galt, lud mich zu einem freimütigen Gespräch ein. Als ich den Sozialistischen Realismus, den das Museum damals zeigte, für undiskutabel erklärte, überredete mich der deswegen keineswegs aufgebrachte Winkler zu einem Besuch im Atelierhaus in der Hauptmannstraße 1, wo Mattheuer und Tübke und kurz zuvor auch noch Heisig wohnten und arbeiteten. Sie bildeten kein Künstlerkollektiv – es waren drei Künstler, die denkbar kontrovers angelegt waren, sogar rivalisierten. Diese Persönlichkeiten haben mich auf Anhieb fasziniert. Ich bin Kunstkritiker mit unverstellten Augen, kein Kunsthistoriker und Kunstmoralist, der Kunst durch eine ideologische Westbrille sieht und mit Freiheits-, Fortschritts-, Reinheits- und Autonomiekategorien hantiert. Ich finde es geradezu lächerlich, dass man im Jahr 2016 noch immer die Westkeule schwingt und den längst ausgetretenen Weg der Westkunst für den einzig richtigen und erlaubten hält.
Im damals linken Westen hatte die Parole „Vom Ich zum Wir“ Konjunktur. Unter diesem Obertitel wurde 1972 ein natürlich ganz anders tendierter Sonntagmorgen-Essay von mir im WDR ausgestrahlt. Damals hatten die Künstler im Osten den Bitterfelder Weg ![]() Der sogenannte „Bitterfelder Weg“ bezeichnet die Neuausrichtung der sozialistischen Kulturpolitik der DDR, die den „wachsenden künstlerisch-ästhetischen Bedürfnissen der Werktätigen“ entgegenkommen sollte. Im Zentrum der sogenannten „ersten Bitterfelder Konferenz“ – offiziell war es eine Autorenkonferenz des Mitteldeutschen Verlags –, die am 24. April 1959 stattfand, stand die Frage nach dem möglichen Zugang der Arbeiter zu Kunst und Kultur. Bereits 1958, auf dem fünften Parteitag der SED, sagte Walter Ulbricht, damals stellvertretender Ministerpräsident der DDR: „In Staat und Wirtschaft ist die Arbeiterklasse der DDR bereits Herr. Jetzt muss sie auch die Höhen der Kultur stürmen und von ihnen Besitz ergreifen.“ Als exemplarisch für die ideologische Programmatik galten die jährlich stattfindenden Arbeiterfestspiele. Siehe auch: Manuela Bonnke, „Kunst in Produktion: Bildende Kunst und volkseigene Produktion in der SBZ/DDR“, Köln/Wien 2007, S. 189 ff. überwunden und waren auf dem Rückweg – „vom Wir zum Ich“. Als ich 1972 in der „F.A.Z.“ von einer „Leipziger Schule“ schrieb,
Der sogenannte „Bitterfelder Weg“ bezeichnet die Neuausrichtung der sozialistischen Kulturpolitik der DDR, die den „wachsenden künstlerisch-ästhetischen Bedürfnissen der Werktätigen“ entgegenkommen sollte. Im Zentrum der sogenannten „ersten Bitterfelder Konferenz“ – offiziell war es eine Autorenkonferenz des Mitteldeutschen Verlags –, die am 24. April 1959 stattfand, stand die Frage nach dem möglichen Zugang der Arbeiter zu Kunst und Kultur. Bereits 1958, auf dem fünften Parteitag der SED, sagte Walter Ulbricht, damals stellvertretender Ministerpräsident der DDR: „In Staat und Wirtschaft ist die Arbeiterklasse der DDR bereits Herr. Jetzt muss sie auch die Höhen der Kultur stürmen und von ihnen Besitz ergreifen.“ Als exemplarisch für die ideologische Programmatik galten die jährlich stattfindenden Arbeiterfestspiele. Siehe auch: Manuela Bonnke, „Kunst in Produktion: Bildende Kunst und volkseigene Produktion in der SBZ/DDR“, Köln/Wien 2007, S. 189 ff. überwunden und waren auf dem Rückweg – „vom Wir zum Ich“. Als ich 1972 in der „F.A.Z.“ von einer „Leipziger Schule“ schrieb, ![]() Eduard Beaucamp, „Neue Kunstszene DDR“, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 25.03.1972. Wiederabgedruckt in: Eduard Beaucamp, „Das Dilemma der Avantgarde“, Frankfurt am Main 1976, S. 250–257. Ferner in: Eduard Beaucamp, „Im Spiegel der Geschichte. Die Leipziger Schule der Malerei“, Göttingen 2017, S. 73–80. bekam ich übrigens in der Leipziger Volkszeitung scharfen Gegenwind. Die prominenten Künstler, meine Favoriten, protestierten heftig: Wir sind keine Gruppe, wir sind Individuen, der Westen will uns zusammenbündeln, um ein Angriffsobjekt zu haben.
Eduard Beaucamp, „Neue Kunstszene DDR“, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 25.03.1972. Wiederabgedruckt in: Eduard Beaucamp, „Das Dilemma der Avantgarde“, Frankfurt am Main 1976, S. 250–257. Ferner in: Eduard Beaucamp, „Im Spiegel der Geschichte. Die Leipziger Schule der Malerei“, Göttingen 2017, S. 73–80. bekam ich übrigens in der Leipziger Volkszeitung scharfen Gegenwind. Die prominenten Künstler, meine Favoriten, protestierten heftig: Wir sind keine Gruppe, wir sind Individuen, der Westen will uns zusammenbündeln, um ein Angriffsobjekt zu haben. ![]() Vgl. „Leipziger Schule?“, in: „Leipziger Volkszeitung“, 08.06.1973.
Vgl. „Leipziger Schule?“, in: „Leipziger Volkszeitung“, 08.06.1973.
Eine Gruppenbildung in der DDR hätte auch nicht besonders viel Sinn gemacht, oder?
Es ist paradox: Die DDR forderte und förderte den systemkonformen robusten Parteikünstler, den neuen gradlinigen, konstruktiven Künstlerfunktionär, ja das im Sozialistischen Realismus vereinigte Künstlerkollektiv. Heraus kamen auf der Hochkunstebene auf der einen Seite methodische Widerspruchsgeister und Unruhestifter wie Mattheuer, auf der anderen Seite extreme, spirituell und nervlich überspannte Individualisten oder Décadents vom Schlage Tübke und Heisig. Noch einmal: Gewünscht, ja gefordert war als Ziel eine sozialistische Nationalkultur. Das Gegenteil kam heraus. Die Künstler sind durch den Widerspruch gewachsen, sie schufen Gegenbilder und entwickelten Ausdrucksventile in der Zwangsgesellschaft.
Gruppenbildungen entstehen in der Regel, um etwas durchzusetzen. Dazu gab es in der DDR wenige Möglichkeiten, oder?
Im Gegenteil: Das besagte Leipziger Künstlertrio hat im Miteinander und Gegeneinander Erstaunliches bewirkt. Es hat an der Hochschule Frei- und Entfaltungsräume geschaffen, die zum Durchbruch einer Fülle großer und unbändiger Talente führten, die sich bei Wahrung dezidierter Individualität zur Leipziger Schule formierten, die über die Wende hinaus heute schon in der vierten Generation produktiv ist.
Als ich 1972 die schon erwähnte Leipziger Bezirkskunstausstellung besuchte, war ich perplex angesichts der explosiven Vitalität dieser Schule, der leidenschaftlichen Expressivität, dem Mut zur Selbstdarstellung und Selbstpoetisierung bei den damals jungen Künstlern der zweiten Generation, angesichts der wilden Malgestik, der Freizügigkeit und Verhöhnung sozialistischer Ideale und Rituale.
Nebenbei – was noch zu wenig erforscht ist: Es gab in der DDR Privatsammler, die den Eigenwillen der Künstler stärkten und förderten. Es gab zum Beispiel in Magdeburg einen prominenten Chirurgen, Rudolf Zuckermann, der aus der Emigration in den Osten Deutschlands zurückgekehrt war. ![]() Rudolf Zuckermann (1910 Elberfeld – 1995 Berlin) war ein Arzt und Kunstsammler jüdischer Herkunft. Ab 1939 lebte er im Exil, zunächst in Paris, ab 1941 in Mexiko. Dort gehörte Zuckermann zur Gemeinschaft der politischen Exilanten und lernte unter anderen Anna Seghers und Egon Erwin Kisch sowie die mexikanische Kulturszene um Diego Rivera, Frida Kahlo und David Alfaro Siqueiros kennen. 1953 übersiedelte er in die DDR, wo er als zionistischer Agent verhaftet und als Regimekritiker eingestuft wurde. Von 1955 bis zu seiner Emeritierung 1979 arbeitete er in Halle an der Saale als Oberarzt und Professor an der Universitätsklinik. Im Auftrag Zuckermanns, der sich eine Arbeit zum Aufstand im Warschauer Ghetto wünschte, fertigte Willi Sitte das Gemälde „Warschauer Paar 1943“ (1967) an.
Rudolf Zuckermann (1910 Elberfeld – 1995 Berlin) war ein Arzt und Kunstsammler jüdischer Herkunft. Ab 1939 lebte er im Exil, zunächst in Paris, ab 1941 in Mexiko. Dort gehörte Zuckermann zur Gemeinschaft der politischen Exilanten und lernte unter anderen Anna Seghers und Egon Erwin Kisch sowie die mexikanische Kulturszene um Diego Rivera, Frida Kahlo und David Alfaro Siqueiros kennen. 1953 übersiedelte er in die DDR, wo er als zionistischer Agent verhaftet und als Regimekritiker eingestuft wurde. Von 1955 bis zu seiner Emeritierung 1979 arbeitete er in Halle an der Saale als Oberarzt und Professor an der Universitätsklinik. Im Auftrag Zuckermanns, der sich eine Arbeit zum Aufstand im Warschauer Ghetto wünschte, fertigte Willi Sitte das Gemälde „Warschauer Paar 1943“ (1967) an.  Er hat intensiv gesammelt, aber gerade nicht die sozialistische Parteikunst. Durch seine Käufe hat er die Künstler in Krisenzeiten ermuntert. Die wollten, wie gesagt, weg von der organisierten Gruppe, weil sie in der Gruppe steuerbarer und politisierbarer waren. Sie ließen alle Kollektiverlebnisse hinter sich, lehnten den Bitterfelder Weg und den Zwang, der davon ausging, ab. Tübke stellte schon Anfang der 60er-Jahre trotzig im Tagebuch fest: „Ideologische Konzeption: ego“ und sprach vom „hybriden Wagnis (ego)“.
Er hat intensiv gesammelt, aber gerade nicht die sozialistische Parteikunst. Durch seine Käufe hat er die Künstler in Krisenzeiten ermuntert. Die wollten, wie gesagt, weg von der organisierten Gruppe, weil sie in der Gruppe steuerbarer und politisierbarer waren. Sie ließen alle Kollektiverlebnisse hinter sich, lehnten den Bitterfelder Weg und den Zwang, der davon ausging, ab. Tübke stellte schon Anfang der 60er-Jahre trotzig im Tagebuch fest: „Ideologische Konzeption: ego“ und sprach vom „hybriden Wagnis (ego)“. ![]() Vgl. die Tagebucheinträge Werner Tübkes am 22.12.1960 und am 31.01.1961 in: Werner Tübke, „Mein Herz empfindet optisch. Aus den Tagebüchern, Skizzen und Notizen“, hg. von Annika Michalski und Eduard Beaucamp, Göttingen 2017, S. 206 und 210. In der DDR, speziell in Leipzig, bin ich extrem starken Charakteren begegnet, stärkeren eigentlich als im Westen.
Vgl. die Tagebucheinträge Werner Tübkes am 22.12.1960 und am 31.01.1961 in: Werner Tübke, „Mein Herz empfindet optisch. Aus den Tagebüchern, Skizzen und Notizen“, hg. von Annika Michalski und Eduard Beaucamp, Göttingen 2017, S. 206 und 210. In der DDR, speziell in Leipzig, bin ich extrem starken Charakteren begegnet, stärkeren eigentlich als im Westen.
Und warum ist es in Ihrem Fall bei der Beschäftigung mit nur vier Künstlern in der DDR geblieben?
Da sind Sie nicht ausreichend im Bilde. Beim ersten großen Auftritt der Leipziger Schule in der Bezirkskunstausstellung von 1972 nannte ich in meiner Rezension eine Fülle bis dahin unbekannter Namen der zweiten Generation. Im Laufe der Zeit schrieb ich und verfasste nach meiner Pensionierung auch Katalog- und Buchtexte über Harald Metzkes, Volker Stelzmann, Hartwig Ebersbach, Gerhard Altenbourg, Carlfriedrich Claus, A.R. Penck, später Michael Triegel, Neo Rauch und manche andere. Über Willi Sitte, eine kulturpolitisch wichtige, in den 50er-Jahren auch künstlerisch bedeutende Figur, habe ich eigentlich nie geschrieben, da mich seine spätere Malerei nicht affizierte.
Sie sagten gerade: Es ging vom Wir zum Ich. Das ist vielleicht schon die Rechtfertigung, dass man sich nicht für alle interessieren muss. Und das muss man natürlich nicht. Wenn man sich aber mit der Kunstgeschichte beschäftigt und teilnimmt, hat man möglicherweise auch eine gewisse Verantwortung. Die drei Künstler, Heisig, Mattheuer, Tübke, auf die Sie sich konzentrierten, sind exemplarisch, vielleicht herausragend. Aber da liegt vielleicht auch die Schwierigkeit, diese Kunst in den Überblicksausstellungen miteinzubeziehen. Sie werden zu Alibikünstlern. Das sind die Etablierten. Aber sobald man darüber hinausgehen will, das vertiefen möchte, wird es ziemlich mager. Mir ist jetzt noch einmal aufgefallen, dass in Ihren vielen Texten und Interviews immer nur diese drei Namen fallen. Tübke noch viel öfter als die anderen.
Ich bin dezidierter Kritiker, ich will kein ausgleichender Kunstwissenschaftler oder Kurator sein. Herr Kahnweiler konzentrierte sich sein Leben lang auf Picasso, daneben vor allem auf Braque und Léger. Werner Spies hatte seinen Max Ernst. Das ist doch erlaubt, ja sogar wünschenswert. Widersprechen muss ich Ihnen darin, dass die Szene abseits der drei Lehrerfiguren mager sei. Die Schüler sind, wie schon gesagt, zahlreich und ganz stark: Stelzmann, Ebersbach, Gille, Giebe, Rink, Peuker … ![]() Die Künstler Hartwig Ebersbach (* 1940 Zwickau), Sighard Gille (* 1941 Eilenburg), Hubertus Giebe (* 1953 Dohna), Wolfgang Peuker (1945 Ústí nad Labem, Tschechoslowakei, heute Tschechische Republik – 2001 Groß Glienicke), Arno Rink (1940 Schlotheim – 2017 Leipzig) und Volker Stelzmann (* 1940 Dresden) werden zur zweiten und dritten Generation der „Leipziger Schule“ gezählt. Damit wird ein figurativer Malstil bezeichnet, den die Künstler Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke und andere an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig begründeten und als Professoren der Hochschule an ihre Schüler weitergaben. Außerhalb Leipzigs habe ich leider erst im letzten Jahrzehnt Harald Metzkes näher kennengelernt, einen wunderbaren Maler und vollkommenen Einzelgänger, der heute am Rande von Berlin lebt und aus der französischen Tradition von Watteau bis Cézanne und Matisse schöpft.
Die Künstler Hartwig Ebersbach (* 1940 Zwickau), Sighard Gille (* 1941 Eilenburg), Hubertus Giebe (* 1953 Dohna), Wolfgang Peuker (1945 Ústí nad Labem, Tschechoslowakei, heute Tschechische Republik – 2001 Groß Glienicke), Arno Rink (1940 Schlotheim – 2017 Leipzig) und Volker Stelzmann (* 1940 Dresden) werden zur zweiten und dritten Generation der „Leipziger Schule“ gezählt. Damit wird ein figurativer Malstil bezeichnet, den die Künstler Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke und andere an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig begründeten und als Professoren der Hochschule an ihre Schüler weitergaben. Außerhalb Leipzigs habe ich leider erst im letzten Jahrzehnt Harald Metzkes näher kennengelernt, einen wunderbaren Maler und vollkommenen Einzelgänger, der heute am Rande von Berlin lebt und aus der französischen Tradition von Watteau bis Cézanne und Matisse schöpft.
Das heißt, in Ost-Berlin waren Sie damals nicht?
Doch, das ging ja über die Friedrichstraße relativ leicht. Da fand ich aber leider keinen Kontakt zu Künstlern, die mich interessierten. Außer über die Nationalgalerie vielleicht.
Hatten Sie sonst irgendwelche Kontakte im Osten?
Nein, eigentlich nur in Leipzig.
Und zu Penck?
Penck habe ich erst über die Westschiene, über seine Galeristen wahrgenommen. Bei Heiner Friedrich in München habe ich ihn, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. ![]() 1971 waren erstmals Werke A.R. Pencks in der Galerie Friedrich in München ausgestellt.
1971 waren erstmals Werke A.R. Pencks in der Galerie Friedrich in München ausgestellt.
War Penck für Sie eine spannende Position?
Doch, das war er, aber keineswegs spannender und bedeutender als die Leipziger. Außerdem brauchte er keine Unterstützung. Das lief von selber. Was mich bald etwas verstimmte und skeptisch machte, war hier im Westen die Inszenierung durch die Händler und durch Künstler wie Baselitz. Sie machten Penck zum Parade-Dissidenten, der gegen die im Osten Verbliebenen in Stellung gebracht wurde. Das ist kein Vorwurf gegen Penck persönlich, der in Dresden ein mutiger, höchst produktiver, geradezu mit einer bildnerischen Philosophie operierender Nonkonformist war und sich nach seiner Flucht nicht an den Kampagnen gegen die Ostdeutschen, die bis heute anhalten, beteiligte und die intrigante und verfilzte bundesdeutsche Szene schnell wieder in Richtung Irland verließ.
Ich durchschaute früh das absichtsvolle Spiel der Händler und Künstlerfreunde im Westen, was mich natürlich nicht abhielt, bei der nach seiner Flucht ersten umfassenden und objektiven Penck-Ausstellung in der West-Berliner Nationalgalerie 1988 einen großen und, wie ich glaube, auch begeisterten Artikel zu schreiben. ![]() A.R. Penck (eigtl. Ralf Winkler; 1939 Dresden – 2017 Zürich) wurde im August 1980 offiziell aus der DDR ausgebürgert und siedelte aufgrund seiner Kontakte zur Galerie Michael Werner ins Rheinland über. 1988 widmete die Nationalgalerie Berlin ihm eine große Retrospektive. Anlässlich der Ausstellung verfasste Eduard Beaucamp den Artikel „Der monumentale Widerspruch. Ein Tagebuch in Bildern: A.R. Penck“, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 07.05.1988. Wiederabdruck in: Eduard Beaucamp, „Der verstrickte Künstler. Wider die Legende von der unbefleckten Avantgarde“, Köln 1998, S. 264–269. So begeistert habe ich nie über Baselitz, Richter, Kiefer oder Lüpertz schreiben können.
A.R. Penck (eigtl. Ralf Winkler; 1939 Dresden – 2017 Zürich) wurde im August 1980 offiziell aus der DDR ausgebürgert und siedelte aufgrund seiner Kontakte zur Galerie Michael Werner ins Rheinland über. 1988 widmete die Nationalgalerie Berlin ihm eine große Retrospektive. Anlässlich der Ausstellung verfasste Eduard Beaucamp den Artikel „Der monumentale Widerspruch. Ein Tagebuch in Bildern: A.R. Penck“, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 07.05.1988. Wiederabdruck in: Eduard Beaucamp, „Der verstrickte Künstler. Wider die Legende von der unbefleckten Avantgarde“, Köln 1998, S. 264–269. So begeistert habe ich nie über Baselitz, Richter, Kiefer oder Lüpertz schreiben können.
Was genau war das Spiel, das Sie durchschauten?
Das umfasst einen ganzen Komplex. Ich erinnere nur an den documenta-Eklat von 1977. Da wurde Penck von den Westmatadoren als Hebel benutzt, um die Ostdeutschen, vor allem die Leipziger, die hier zum ersten Mal eingeladen worden waren, auszuschalten. ![]() Vgl. hierzu Markus Lüpertz. Beuys, der Mensch, sprang den Ostdeutschen übrigens damals in Kassel bei. Das war eine komplizierte, noch immer nicht restlos aufgeklärte Affäre, über die die Osnabrücker Kunsthistorikerin Gisela Schirmer ein Buch geschrieben hat.
Vgl. hierzu Markus Lüpertz. Beuys, der Mensch, sprang den Ostdeutschen übrigens damals in Kassel bei. Das war eine komplizierte, noch immer nicht restlos aufgeklärte Affäre, über die die Osnabrücker Kunsthistorikerin Gisela Schirmer ein Buch geschrieben hat. ![]() Gisela Schirmer, „DDR und documenta. Kunst im deutsch-deutschen Widerspruch“, Berlin 2005.
Gisela Schirmer, „DDR und documenta. Kunst im deutsch-deutschen Widerspruch“, Berlin 2005.
Der in der DDR rundum bespitzelte und zeitweise stark bedrängte Gerhard Altenbourg ![]() Gerhard Altenbourg (eigtl. Gerhard Ströch; 1926 Rödichen-Schnepfenthal – 1989 Altenburg) war ein Grafiker, Maler und Dichter, der in seinen vorwiegend grafischen Arbeiten eine individuell abstrahierende Bildsprache verfolgte, die in Opposition zur staatlich geförderten Ästhetik des Sozialistischen Realismus in der DDR stand. Seine erste Einzelausstellung fand 1952 in der Galerie Rudolf Springer in West-Berlin statt, wo er bis in die 1960er-Jahre vertreten war. 1959 nahm Altenbourg an der „documenta 2“ teil. andererseits hat sich vor keine Karren spannen lassen. Ausgegrenzt und verfolgt zu sein wurde im Westen, gerade in kommerziellen Kreisen, als Adelsprädikat geführt. Warum auch nicht? Doch kann das kein Qualitätskriterium sein, es gehört in einen Katalog moralischer Qualifikationen. In den Katalog der Untugenden gehören auch die Manipulationen, Intrigen und Korruptionen, mit deren Hilfe die Karrieren der Westkünstler befördert wurden. Die im Osten Verbliebenen wurden und werden bis heute pauschal unter Verdacht gestellt und von Künstlern wie Baselitz regelrecht angepöbelt.
Gerhard Altenbourg (eigtl. Gerhard Ströch; 1926 Rödichen-Schnepfenthal – 1989 Altenburg) war ein Grafiker, Maler und Dichter, der in seinen vorwiegend grafischen Arbeiten eine individuell abstrahierende Bildsprache verfolgte, die in Opposition zur staatlich geförderten Ästhetik des Sozialistischen Realismus in der DDR stand. Seine erste Einzelausstellung fand 1952 in der Galerie Rudolf Springer in West-Berlin statt, wo er bis in die 1960er-Jahre vertreten war. 1959 nahm Altenbourg an der „documenta 2“ teil. andererseits hat sich vor keine Karren spannen lassen. Ausgegrenzt und verfolgt zu sein wurde im Westen, gerade in kommerziellen Kreisen, als Adelsprädikat geführt. Warum auch nicht? Doch kann das kein Qualitätskriterium sein, es gehört in einen Katalog moralischer Qualifikationen. In den Katalog der Untugenden gehören auch die Manipulationen, Intrigen und Korruptionen, mit deren Hilfe die Karrieren der Westkünstler befördert wurden. Die im Osten Verbliebenen wurden und werden bis heute pauschal unter Verdacht gestellt und von Künstlern wie Baselitz regelrecht angepöbelt.
Der Angriff der Frondeure führte 1977 in Kassel dazu, dass die Ostdeutschen auf der documenta separiert und wie in eine Wagenburg gesperrt wurden. Solche Behandlung und Ächtung wiederholte sich 2009 in der Berliner Ausstellung „60 Jahre – 60 Werke“ ![]() „60 Jahre – 60 Werke. Kunst aus der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis 2009“, Martin-Gropius-Bau, Berlin, 01. Mai – 14. Juni 2009. , wo die Künstler der inzwischen verflossenen DDR programmatisch ausgeschlossen wurden. Ein besonders dummer rheinischer Kurator sprach ihrem Werk auf beleidigende Weise das Kunstrecht ab: Es sei ein Produkt der Käfighaltung wie im Zoo. Den Ostdeutschen warf man vor, dass sie nicht heftiger gegen die Obrigkeit rebellierten, dass sie angeblich nichts zur Mauer, nichts zu den Maueropfern sagten. Dabei sind kritische Spuren zu diesen Themen durchaus in ihren Bildern zu finden.
„60 Jahre – 60 Werke. Kunst aus der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis 2009“, Martin-Gropius-Bau, Berlin, 01. Mai – 14. Juni 2009. , wo die Künstler der inzwischen verflossenen DDR programmatisch ausgeschlossen wurden. Ein besonders dummer rheinischer Kurator sprach ihrem Werk auf beleidigende Weise das Kunstrecht ab: Es sei ein Produkt der Käfighaltung wie im Zoo. Den Ostdeutschen warf man vor, dass sie nicht heftiger gegen die Obrigkeit rebellierten, dass sie angeblich nichts zur Mauer, nichts zu den Maueropfern sagten. Dabei sind kritische Spuren zu diesen Themen durchaus in ihren Bildern zu finden.
Gerne mache ich den Gegentest: Sehen Sie bei den amerikanischen Pop-Art-Künstlern manifeste Kommentare zu Hiroshima und Nagasaki, zu den Rassenkonflikten, zum Vietnam- oder Irakkrieg und den anderen Verbrechen der Amerikaner? Die Intellektuellen und Musiker in den USA haben leidenschaftlich interveniert. Andy Warhol hat anfangs ein paar kritische Sujets seriell bearbeitet, sich dann aber wahllos und lukrativ auf Werbelabels, Glamourfiguren und Prominentenfotos, Produktpaletten von Autos und die kosmetische Paraphrase von Kunstgeschichtsikonen spezialisiert und sie in gefälliger Überarbeitung auf dem Markt feilgeboten. So sehen unsere Freiheitsapostel aus.
Wenn Sie sagen, Penck habe Ihre Unterstützung nicht gebraucht, heißt das, Sie haben sich nur für die Sachen eingesetzt, die Ihrer Hilfe bedurften?
Im Kalten Krieg galt die Grundregel – und zwar für den ganzen Ostblock: Künstler, die im Westen bekannt waren, die von hier aus beobachtet und diskutiert wurden, waren in gewisser Weise geschützt. Mit den Unbekannten verfuhren die Machthaber fast willkürlich. Solange Penck in Dresden war und drangsaliert wurde, musste man für ihn kämpfen. Dort hatte er sein Bildkonzept entwickelt, da traf seine Analyse genau. Im Westen wurden diese Chiffren zu Selbstläufern und Markenzeichen. Eine Modifikation blieb er uns schuldig. Prinzipiell ist mir allerdings unbegreiflich, wie man 50 Jahre lang am gleichen Sujet und Schema, mag es auch noch so flexibel sein, festhalten kann. Da muss man sich doch selber peinlich werden. Für mich wäre so etwas wie Gefängnis, wie lebenslänglich.
Dieser Vorwurf trifft heute fast das gesamte verbliebene Avantgardesystem der Moderne. Früher überstürzte es sich, heute schleppt es sich durch Steppen, durch ermüdende, sinnentleerte Wiederholungen weiter. Warhol betrieb bald eine Konfektionsmaschine.
Bei unseren hochmütigen westdeutschen Matadoren ist die Leere besonders peinlich. Baselitz produziert explizit verdünnte Wiederholungen früherer Figurationen. Richter, der sein Leben lang fast alle Trends der letzten Jahrzehnte aufgriff und gleichsam nachspielte, hat sich im Kreis gedreht und ist zum Abstrakten Expressionismus der 50er-Jahre, zu einem im besten Fall farbenprächtig aufgefrischten oder mystisch dunklen Informel, das er übrigens in seinen jungen Jahren bekämpft hat, zurückgekehrt. Er handhabt das Pathos heute mit brettergroßen Rakeln.
Haben Sie die abendfüllenden Filme mit Baselitz und Richter im Atelier gesehen, die in den letzten Jahren gedreht worden sind? ![]() „Gerhard Richter Painting“, Buch und Regie von Corinna Belz, D 2011. „Georg Baselitz“, Regie Evelyn Schels, D 2013. Da dröhnen einem die Leere und Banalität und in den verbalen Partien die gedankliche Armut entgegen. Baselitz, unser nationaler Freiheitsheld und Drachentöter der turmhoch interessanteren ostdeutschen Künstler, der kürzlich den Pass gewechselt hat und, um der Erbschaftssteuer zu entgehen, Österreicher geworden ist, prunkt im Film mit seiner Villa am Ammersee, mit einem Atelierhaus samt Park am Mittelmeer und überdies mit einer Wohnung in New York City.
„Gerhard Richter Painting“, Buch und Regie von Corinna Belz, D 2011. „Georg Baselitz“, Regie Evelyn Schels, D 2013. Da dröhnen einem die Leere und Banalität und in den verbalen Partien die gedankliche Armut entgegen. Baselitz, unser nationaler Freiheitsheld und Drachentöter der turmhoch interessanteren ostdeutschen Künstler, der kürzlich den Pass gewechselt hat und, um der Erbschaftssteuer zu entgehen, Österreicher geworden ist, prunkt im Film mit seiner Villa am Ammersee, mit einem Atelierhaus samt Park am Mittelmeer und überdies mit einer Wohnung in New York City.
Überall Sackgassen und Wiederholungsspiralen. Der einzige Ausweg scheint heute eine inflationäre Concept-Art, die faktisch nichts mehr realisiert, nur noch Fingerzeige gibt, die flott mit Fundstücken aus dem Internet hantiert, mithin Zweitverwertung betreibt und moralisiert. Da ist ein neues Denken dringend notwendig. Die Reformen der Moderne müssen ihrerseits reformiert, gegebenenfalls auch revidiert werden. Im 21. Jahrhundert ist die Kunst noch kaum mit dezidierten eigenen Positionen auf die Beine gekommen.
Vergleichen Sie 2016 einmal mit 1916 oder auch mit 1816. Da überschlugen sich die Ideen und Aktivitäten. Unser neues Jahrhundert bringt es nicht fertig, sich von den Vätern und Großvätern zu trennen und neu anzufangen. 1916 war das 19. Jahrhundert mit seiner bürgerlich-akademischen Kunst und seinen Salons gründlich entsorgt. Heute bewegt sich die Kunstszene immer noch in den für sie viel zu großen Pantoffeln der Expressionisten, der Dadaisten, der Konstruktivisten oder auch Surrealisten. Als habe sich die Welt nicht weitergedreht, als seien das ewig gültige, unumstößliche, päpstliche Dogmen, die man nicht bezweifeln und aufs Spiel setzen darf. Überall Reprisen, Aufgüsse, Variationen, Kombinationen, Endspiele.
Mir dämmert, dass es in den gründlich veränderten Gesellschaften der Zukunft aus ist mit der autonomen, individualistischen, weltbildenden und weltdeutenden Kunst. In der digitalen Welt wird es eine kollektive, unvermeidlich vulgäre, kommerzielle Bildproduktion und Bildversorgung geben, die in riesigen Mengen ausgestoßen und in rasender Geschwindigkeit konsumiert, verbraucht und wieder entsorgt wird.
Es ist eine Ironie der Geschichte, dass wir heute immer noch Museumspaläste für eine dauerhafte Kunst bauen, die es so gar nicht mehr geben wird. Der Kunstbegriff ist restlos offen und fließend geworden. Er hat sich zur Bühne und zur digitalen Welt geöffnet und mischt sich unter den Einheitsbrei der modernen Bildmedien. Das Ende ist offen. Dabei können alle nur möglichen Mixturen, Metamorphosen und Wechselbälger herauskommen. Man muss dieser Mixed-Media-Kultur, die universell und global benutzbar ist, allerdings ihr emanzipatorisches Potenzial zugutehalten. Sie gibt in autoritären Gesellschaften Sprachmittel und Aktionsformen an die Hand, um weltweit Proteste zu artikulieren und den Widerstand, womöglich sogar Rebellionen zu organisieren.
Doch wird sich künftig die Kunst, wie wir sie kennen, behaupten und ihre Qualität und Einzigartigkeit verteidigen können? Ich glaube, wir treten in eine völlig neue Epoche. Das schöpferische Individuum, die Fantasie und die Freiheit, wie wir sie gekannt haben, wird es künftig wohl nicht mehr geben. Jetzt kommt mein Schocker: Meine Erfahrung sagt mir, dass der Sozialismus die Kunst nicht kleingekriegt hat. Er hat die Künstler durch die Auseinandersetzung, den Widerspruch und den Entwurf von Gegenwelten stark gemacht. Der Kapitalismus scheint die Kunst dagegen kleinzukriegen. Er macht sich die Künstler als freiwillige, freudige, beflissene, dienstbare Partner gefügig, er domestiziert ihre Werke zu einem marktkonformen Systemprodukt. Pionier dieser Entwicklung war Warhol. Ob er ein gedopter Optimist war oder im Innersten ein Zyniker, vielleicht auch ein Tragiker, ist bis heute unklar.
Mit wem haben Sie sich über all diese gesellschaftlichen, politischen und künstlerischen Themen unterhalten? Mit wem hatten Sie beispielsweise in Frankfurt zu tun?
Mit mir selber. Ich war nie in einer Gruppe.
Peter Iden, Bazon Brock, Paul Maenz, Thomas Bayrle, Rochus Kowallek, Hermann Goepfert – mit all diesen Leuten hatten Sie nichts zu tun?
Natürlich hatte man hin und wieder Umgang mit ihnen. Durch die Galerien Loehr, Kowallek und Lichter waren ZERO, Op-Art und überhaupt die neue konkrete Kunst sehr präsent. Ich genügte natürlich meiner kunstkritischen Chronistenpflicht. Als einer der Ersten, vielleicht sogar als Allererster schrieb ich schon 1966 über den früh verstorbenen Frankfurter Peter Roehr, der durch seine rasanten seriellen Montagen, das Tempo und die Schönheit des Designs faszinierte. Er erschien damals fast als neuer Futurist.
1982 gab ich mit Raimer Jochims und Thomas Bayrle eine Anthologie zur Geschichte der Städelschule heraus, um ihren Ruf und ihre damals nicht ungefährdete Stellung zu stärken. ![]() „Städelschule Frankfurt am Main. Aus der Geschichte einer Kunsthochschule“, hg. vom Verein Freunde der Städelschule e.V. Frankfurt, mit Texten von Eduard Beaucamp, Raimer Jochims, Georg Swarzenski, Franz Erhard Walther und anderen, Layout von Thomas Bayrle und René Vogelsinger, Frankfurt am Main 1982. Außerdem hatte ich täglich von morgens bis abends Austausch mit meinen brillanten Kollegen in der Feuilletonredaktion. Neue, zu Recht auch politische Kunstimpulse gingen vom Programm des Frankfurter Kunstvereins unter Georg Bussmann und Peter Weiermair aus. Das Angebot schwoll dann in der Stadt durch ein verjüngtes, modern geführtes Städel Museum, durch die Schirn und das Museum für Moderne Kunst gewaltig an. Aber neue Ideen, geschweige denn Entwicklungen gingen von dieser Stadt nicht aus. Meine größte Leidenschaft entzündete sich, wie ich schon mehrfach eingestand, an den Leipziger Entwicklungen und an den künstlerischen Meisterleistungen in dieser Stadt, die zur Selbstbefreiung in der DDR beitrug. Dieses große Kunstabenteuer wurde in westdeutschen Kunstkreisen ungern wahrgenommen und bis heute kaum gewürdigt.
„Städelschule Frankfurt am Main. Aus der Geschichte einer Kunsthochschule“, hg. vom Verein Freunde der Städelschule e.V. Frankfurt, mit Texten von Eduard Beaucamp, Raimer Jochims, Georg Swarzenski, Franz Erhard Walther und anderen, Layout von Thomas Bayrle und René Vogelsinger, Frankfurt am Main 1982. Außerdem hatte ich täglich von morgens bis abends Austausch mit meinen brillanten Kollegen in der Feuilletonredaktion. Neue, zu Recht auch politische Kunstimpulse gingen vom Programm des Frankfurter Kunstvereins unter Georg Bussmann und Peter Weiermair aus. Das Angebot schwoll dann in der Stadt durch ein verjüngtes, modern geführtes Städel Museum, durch die Schirn und das Museum für Moderne Kunst gewaltig an. Aber neue Ideen, geschweige denn Entwicklungen gingen von dieser Stadt nicht aus. Meine größte Leidenschaft entzündete sich, wie ich schon mehrfach eingestand, an den Leipziger Entwicklungen und an den künstlerischen Meisterleistungen in dieser Stadt, die zur Selbstbefreiung in der DDR beitrug. Dieses große Kunstabenteuer wurde in westdeutschen Kunstkreisen ungern wahrgenommen und bis heute kaum gewürdigt.