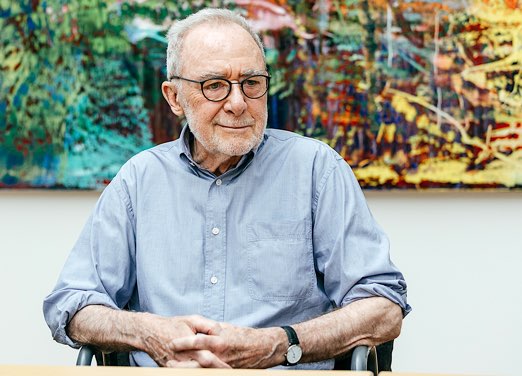Köln, 07. Mai 2015
Gerhard Richter: Es geht also um die 60er-Jahre?
Franziska Leuthäußer: Genau, es geht im Prinzip um die Kunstszene, die sich um 1960 in Deutschland, vor allem in Westdeutschland, etablierte.
Die ZERO ![]() Ab 1958 verwendeten Heinz Mack und Otto Piene den Begriff „ZERO“ im Kontext ihrer gemeinsamen Ausstellungen sowie als Titel für die drei Ausgaben ihrer in Düsseldorf publizierten Zeitschrift. Ab 1961 nahm auch Günther Uecker regelmäßig an den Ausstellungen und Aktionen von ZERO teil. ZERO stand für die Stunde null, für Aufbruch und einen radikalen Neuanfang nach den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs. ZERO setzte sich deutlich vom etablierten Informel ab. Mit neuen Materialien und der Einbeziehung von Bewegung, Licht und Raum in das künstlerische Werk etablierte ZERO eine neue Formensprache. Vgl. Wieland Schmied, „Etwas über ZERO“, in: Dirk Pörschmann/Mattijs Visser (Hg.), „ZERO 4 3 2 1“, Düsseldorf 2012, S. 9–18. -Leute, vor allem.
Ab 1958 verwendeten Heinz Mack und Otto Piene den Begriff „ZERO“ im Kontext ihrer gemeinsamen Ausstellungen sowie als Titel für die drei Ausgaben ihrer in Düsseldorf publizierten Zeitschrift. Ab 1961 nahm auch Günther Uecker regelmäßig an den Ausstellungen und Aktionen von ZERO teil. ZERO stand für die Stunde null, für Aufbruch und einen radikalen Neuanfang nach den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs. ZERO setzte sich deutlich vom etablierten Informel ab. Mit neuen Materialien und der Einbeziehung von Bewegung, Licht und Raum in das künstlerische Werk etablierte ZERO eine neue Formensprache. Vgl. Wieland Schmied, „Etwas über ZERO“, in: Dirk Pörschmann/Mattijs Visser (Hg.), „ZERO 4 3 2 1“, Düsseldorf 2012, S. 9–18. -Leute, vor allem.
Ja, die ZERO-Leute und Sie …
Ich kam aber ein bisschen später. Nicht vom Alter her, aber …
Sie kamen 61?
Ja, da war ZERO schon ganz „in“.
Als Sie nach Düsseldorf kamen, waren die schon …
… bekannt und erfolgreich. Mit leichtem Spott haben wir das gesehen, der Polke und ich.
Mit leichtem Spott?
Ja. Die waren so siegessicher!
Die ZERO-Künstler haben die Entstehung ihrer Arbeiten und ihre Aktionen ja bereits Anfang der 60er-Jahre filmisch dokumentiert.
Aha, das weiß ich gar nicht so genau.
Ja, beispielsweise ist 1962 der Film „0 × 0 = Kunst“ von Gerhard Winkler entstanden, eine Dokumentation der Aktion ![]() Die Künstler des ZERO-Umfelds nutzten für ihre als „Demonstrationen“ bezeichneten Aktionen mehrfach den öffentlichen Raum als Plattform. Zu den bekanntesten Beispielen zählt die am 17. Mai 1962 von Heinz Mack, Otto Piene und Günther Uecker veranstaltete „ZERO Demonstration“ auf den Düsseldorfer Rheinwiesen. Vgl. ZERO foundation, „Düsseldorf: Ohne Titel [ZERO-Demonstration], Rheinwiesen 17. Mai 1962“, unter: http://www.4321zero.com/1962.html (eingesehen am 21.04.2017). auf den Rheinwiesen. Der Hessische Rundfunk strahlte sie am 27. Juni 1962 aus. Das waren also keineswegs Filme fürs Archiv, sondern, wenn man so will, bestes Marketing für die Kunst der ZERO-Künstler.
Die Künstler des ZERO-Umfelds nutzten für ihre als „Demonstrationen“ bezeichneten Aktionen mehrfach den öffentlichen Raum als Plattform. Zu den bekanntesten Beispielen zählt die am 17. Mai 1962 von Heinz Mack, Otto Piene und Günther Uecker veranstaltete „ZERO Demonstration“ auf den Düsseldorfer Rheinwiesen. Vgl. ZERO foundation, „Düsseldorf: Ohne Titel [ZERO-Demonstration], Rheinwiesen 17. Mai 1962“, unter: http://www.4321zero.com/1962.html (eingesehen am 21.04.2017). auf den Rheinwiesen. Der Hessische Rundfunk strahlte sie am 27. Juni 1962 aus. Das waren also keineswegs Filme fürs Archiv, sondern, wenn man so will, bestes Marketing für die Kunst der ZERO-Künstler.
Ja.
Kennen Sie die 7.200 Meter lange Linie ![]() Piero Manzoni, „Linea m 7200“, 1960.
Piero Manzoni, „Linea m 7200“, 1960.  , die Piero Manzoni in Herning in Dänemark in der Druckerei einer Tageszeitung – übrigens vor Publikum – produziert und dann in einem großen Zinkbehälter verschlossen hat?
, die Piero Manzoni in Herning in Dänemark in der Druckerei einer Tageszeitung – übrigens vor Publikum – produziert und dann in einem großen Zinkbehälter verschlossen hat?
Ja, ja doch.
Der gesamte Produktionsprozess, der Künstler bei der Arbeit, beim Zeichnen, wurde filmisch festgehalten.
Ja, der wusste Bescheid, war sich sicher, dass das gut ist und wichtig.
Waren Ihrer Meinung nach die Künstler des ZERO-Netzwerks in dieser Zeit so präsent, weil sie die Medien anders bedient haben als Einzelgänger wie zum Beispiel Konrad Klapheck?
Klapheck war zu altmodisch, um da mithalten zu können, zu nahe am Surrealismus und an der Neuen Sachlichkeit.
Haben Sie das damals auch schon so empfunden?
Ja. Ich war mehr interessiert an Action-Painting und so was.
Action-Painting? – Jackson Pollock?
Ja.
Und wann haben Sie das zum ersten Mal gesehen?
Das war 59, als ich zur documenta ![]() Vom 11. Juli bis 11. Oktober 1959 fand in Kassel, von Arnold Bode geleitet, die „documenta 2“ unter dem Titel „Kunst nach 1945“ statt. Nach der ersten documenta 1955, die vor allem einen retrospektiven Blick auf die Kunst legte, sollten vier Jahre später die neuen Entwicklungen nach dem Krieg gezeigt werden. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der abstrakten Kunst, dem europäischen Informel und Tachismus sowie dem Abstrakten Expressionismus der Amerikaner, die auf dieser documenta unter anderen mit Jackson Pollock, Franz Kline und Clyfford Still erstmals vertreten waren. nach Kassel fuhr. Damals war das noch möglich.
Vom 11. Juli bis 11. Oktober 1959 fand in Kassel, von Arnold Bode geleitet, die „documenta 2“ unter dem Titel „Kunst nach 1945“ statt. Nach der ersten documenta 1955, die vor allem einen retrospektiven Blick auf die Kunst legte, sollten vier Jahre später die neuen Entwicklungen nach dem Krieg gezeigt werden. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der abstrakten Kunst, dem europäischen Informel und Tachismus sowie dem Abstrakten Expressionismus der Amerikaner, die auf dieser documenta unter anderen mit Jackson Pollock, Franz Kline und Clyfford Still erstmals vertreten waren. nach Kassel fuhr. Damals war das noch möglich.
Das war ja vor dem Mauerbau. Sie sind vor dem Mauerbau in den Westen gereist, um sich hier Kunst anzuschauen?
Ja, getrampt, das ging damals gut.
Sie sind aber immer wieder zurückgegangen?
Ja, Wurzeln, das ist so. Es dauert lange, bis man sich dazu entschließt, abzuhauen und alles im Stich zu lassen.
Das war Ihre Heimat?
Ja. War’s ja auch. Mit allen Freunden und Bekannten.
Waren Sie vor dem Mauerbau in der DDR insgesamt künstlerisch weniger eingeschränkt?
Das System war doch von Anfang an so. Die Akademie war streng traditionell, antimodern, der Sozialistische Realismus war das große Ziel.
Trotzdem sind Sie immer wieder zurückgegangen?
Ja, ich wollte erst die Akademie hinter mich gebracht haben. Und man hat sich da auch was vorgemacht, hatte Hoffnung, dass alles besser wird, freier. Man suchte Gründe, warum der kapitalistische Westen gar nicht das Ideal sein kann. Wir sprachen viel über einen dritten Weg. Hinzu kam auch eine gewisse Geborgenheit. Überwachung ist ja auch eine Art Fürsorge. Das gab’s ja hier nicht.
Wer passte auf?
Der Staat mit all seinen gehorsamen Leuten. Auch wenn man sich jeden Tag darüber ärgerte, er war da. Und dann plötzlich, hier im Westen, da war man frei – und das machte auch Angst.
Als Sie im Westen angekommen sind?
Ja. Das war so ein anderes Klima.
Auch weil der Wettbewerb größer war?
Ja.
Sie haben drei Jahre lang, von 1957 bis Anfang 1961, als freier Künstler in der DDR gelebt.
Nicht ganz, denn ich hatte eine Aspirantur.
Was bedeutet das?
Das war eine Auszeichnung nach dem Studium. Ich bekam ein Stipendium und ein Atelier in der Akademie zur Verfügung gestellt. Das habe ich jetzt wiedergesehen, zum ersten Mal nach über 50 Jahren, und ich habe gestaunt, was ich damals für ein großes Atelier hatte.
Dann ging es Ihnen in der DDR eigentlich gut?
Da ging’s mir gut, ja. Wirtschaftlich privilegiert, sozusagen.
Warum sind Sie dann nach Düsseldorf gegangen?
Ich hatte null Vorstellung, wohin. Und so besuchte ich einen ehemaligen Mitstudenten, den einzigen Bekannten in Westdeutschland, in Düsseldorf. Bei ihm konnte ich ein paar Wochen wohnen. Ich sagte ihm, dass ich wohl in die Kunststadt München ziehen sollte, und er erwiderte: „Nein, um Gottes willen, Düsseldorf ist die Kunststadt.“
Wer war das?
Reinhard Graner, ein Bildhauer, den ich von der Dresdener Akademie her kannte und der hier im Amt für Denkmalpflege arbeitete.
In Düsseldorf trafen Sie auch auf Manfred Kuttner, den Sie, glaube ich, schon aus der DDR kannten?
Den habe ich erst hier getroffen, ich kannte ihn vorher nicht. Aber er kannte mich, weil ich in Dresden Aktzeichenkurse gegeben hatte. Als Aspirant war man auch verpflichtet, irgendwas zu leisten, also zum Beispiel Abendkurse zu geben, und da hatte er wohl teilgenommen. Hier an der Düsseldorfer Akademie sprach er mich dann an: „Dich kenne ich doch“, sagte er. „Was willst du hier? Du bist doch eher ein Bonze.“
Der Bonze, der das Stipendium hatte. Das ist natürlich verdächtig.
Ja.
Dann haben Sie sich an der Düsseldorfer Akademie eingeschrieben, um …
… um Fuß zu fassen. Ich kannte ja keinen Menschen.
Jürgen Schreiber stellt es in seinem Buch über Sie ![]() Jürgen Schreiber, „Ein Maler aus Deutschland. Gerhard Richter – Das Drama einer Familie“, München 2005. so dar, als seien Sie unter anderem aus Enttäuschung über den Osten in den Westen gegangen.
Jürgen Schreiber, „Ein Maler aus Deutschland. Gerhard Richter – Das Drama einer Familie“, München 2005. so dar, als seien Sie unter anderem aus Enttäuschung über den Osten in den Westen gegangen.
Enttäuschung ist vielleicht das falsche Wort. Ich konnte und wollte das nicht länger ertragen.
Und dann haben Sie 61 den Entschluss gefasst, in den Westen zu gehen?
Der Entschluss war schon vorher da. Dazu trug auch mein Kontakt zu einer Gruppe von Dissidenten bei, die allerdings einen gewissen Dünkel pflegten, so im Bewusstsein: „Wir sind was Besseres.“
Die haben auch versucht, Sie rüberzuziehen?
Ja, schon. Aber den letzten Anstoß gab eine Gruppenausstellung im Albertinum ![]() „Junge Künstler“, Albertinum, Dresden, 17. Juli – 11. September 1960. , in der auch ein oder zwei Bilder von mir hingen. Darüber berichtete der englische Rundfunk und erwähnte mich als Beispiel für einen, der sich querstellt, der „anti“ war. Da ist man ja erst mal stolz, aber gleichzeitig wusste ich, dass diese Bilder gar nicht so gut waren. Also auf dieser Schiene wollte ich kein Lob. Im Februar 61 bin ich weg, am 28. Februar.
„Junge Künstler“, Albertinum, Dresden, 17. Juli – 11. September 1960. , in der auch ein oder zwei Bilder von mir hingen. Darüber berichtete der englische Rundfunk und erwähnte mich als Beispiel für einen, der sich querstellt, der „anti“ war. Da ist man ja erst mal stolz, aber gleichzeitig wusste ich, dass diese Bilder gar nicht so gut waren. Also auf dieser Schiene wollte ich kein Lob. Im Februar 61 bin ich weg, am 28. Februar.
Sind Sie ganz ohne Material ausgereist?
Ich habe alles liegen lassen, oben auf dem Dachboden. Zum Teil ist das dann vom Staatlichen Kunsthandel beschlagnahmt worden und zum Teil haben es sich irgendwelche Leute angeeignet. So was taucht jetzt noch auf und wird teuer gehandelt, was ich sehr ärgerlich finde. Ich habe das alles dem Archiv ![]() Das Gerhard Richter Archiv wurde 2006 unter der Leitung von Dietmar Elger als Teil der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden mit großer Unterstützung des Künstlers gegründet. Dort werden sämtliche Dokumente zum Werk und zur Person Gerhard Richters gesammelt und erforscht, darunter insbesondere bisher nicht veröffentlichte Schriftstücke, Dokumente und Fotografien. Das umfangreichste Forschungsprojekt des Archivs ist die Erarbeitung und Herausgabe des Werkverzeichnisses von Gerhard Richter. in Dresden geschenkt, um so publik zu machen, dass das eigentlich noch immer mein Eigentum ist. Ich hoffe, dass das den Handel schwieriger macht, weil er damit eigentlich unrechtmäßig ist.
Das Gerhard Richter Archiv wurde 2006 unter der Leitung von Dietmar Elger als Teil der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden mit großer Unterstützung des Künstlers gegründet. Dort werden sämtliche Dokumente zum Werk und zur Person Gerhard Richters gesammelt und erforscht, darunter insbesondere bisher nicht veröffentlichte Schriftstücke, Dokumente und Fotografien. Das umfangreichste Forschungsprojekt des Archivs ist die Erarbeitung und Herausgabe des Werkverzeichnisses von Gerhard Richter. in Dresden geschenkt, um so publik zu machen, dass das eigentlich noch immer mein Eigentum ist. Ich hoffe, dass das den Handel schwieriger macht, weil er damit eigentlich unrechtmäßig ist.
Wenn Sie die Chance gehabt hätten, die Arbeiten zu vernichten, hätten Sie es getan?
Zum großen Teil, ja. Ein paar Sachen sind ganz schön, die mag ich heute noch.
Was waren das für Arbeiten, die Sie damals gemacht haben?
Ölbilder, Zeichnungen, Aquarelle, alles Mögliche. Typische Studentenarbeiten.
Figurativ?
Fast nur, ja.
Gab es auch Werke, die sich am Sozialistischen Realismus orientierten?
Die gab es natürlich, aber die waren auch ein bisschen dagegen. Die meisten waren angelehnt an Picasso, das war ein großes Vorbild, oder Guttuso. Das waren dann genauso unangenehme Sachen.
In Düsseldorf haben Sie die Kunstwelt noch mal ganz neu entdeckt?
Ja, ich musste das ja für mich entdecken. Ich habe dann im ersten Jahr der Akademie wie im Schnellgang irre viel produziert und das dann alles verbrannt, aber nicht als Aktion, sondern …
… wie Baldessari.
Hat der das gemacht?
Ja, Baldessari hat 1970 sein komplettes Frühwerk verbrannt. Daraus ist das „Cremation Project“ ![]() Am 24. Juli 1970 verbrannte John Baldessari in einem Krematorium in San Diego, Kalifornien, im Beisein von Freunden und Studenten sämtliche seiner zwischen 1953 und 1966 entstandenen Gemälde. Der Titel der Arbeit, „Cremation Project“, bezeichnet sowohl die Aktion als auch die Urne in Buchform, in der seither die Asche der verbrannten Werke aufbewahrt wird. Vgl. Coosje van Bruggen, „John Baldessari“, New York 1990, S. 54 f.
Am 24. Juli 1970 verbrannte John Baldessari in einem Krematorium in San Diego, Kalifornien, im Beisein von Freunden und Studenten sämtliche seiner zwischen 1953 und 1966 entstandenen Gemälde. Der Titel der Arbeit, „Cremation Project“, bezeichnet sowohl die Aktion als auch die Urne in Buchform, in der seither die Asche der verbrannten Werke aufbewahrt wird. Vgl. Coosje van Bruggen, „John Baldessari“, New York 1990, S. 54 f. 
Schön, spektakulär. Liegt mir nicht so.
Baldessari?
Ja, die letzten Sachen. Der wird ja immer noch hochgehalten. Diese ganze Schau!
Aber er hatte doch eine wichtige Position in den 60er- und 70er-Jahren?
Das kann sein, ja.
In Düsseldorf haben Sie bei K.O. Götz studiert.
Erst bei Ferdinand Macketanz und dann bei K.O. Götz. ![]() Gerhard Richter studierte von 1961 bis 1962 in der Klasse von Ferdinand Macketanz, von 1962 bis 1964 bei K.O. Götz. Der war sehr zurückhaltend und vorsichtig, wenn er in die Klasse kam, sagte er: „Lasst euch nicht stören. Ich muss nur mal durchgehen.“ Er hat nicht viel gesagt, man ging mit den Sachen, die man gemacht hatte, zu ihm, und dann wurde drüber gesprochen. Er hat mehr Einzelgespräche geführt. Keine Gruppentherapie.
Gerhard Richter studierte von 1961 bis 1962 in der Klasse von Ferdinand Macketanz, von 1962 bis 1964 bei K.O. Götz. Der war sehr zurückhaltend und vorsichtig, wenn er in die Klasse kam, sagte er: „Lasst euch nicht stören. Ich muss nur mal durchgehen.“ Er hat nicht viel gesagt, man ging mit den Sachen, die man gemacht hatte, zu ihm, und dann wurde drüber gesprochen. Er hat mehr Einzelgespräche geführt. Keine Gruppentherapie.
War er für Sie als Lehrer wichtig?
Ja, er war mir der Sympathischste von allen. Und das Informel liegt mir sehr.
Sie arbeiten ja auch mit der Rakel, mittlerweile.
Ja, könnte man so sagen, dass das auch mit ihm etwas zu tun hat. Ja, das war mir noch nie so bewusst.
Hat er auch Kunstgeschichte …
… gelehrt? Nein.
Vielleicht nicht gelehrt, aber irgendwelche Sachen gezeigt?
Irgendwelche Beispiele von Künstlern, die er in Paris erlebt hatte. So was in der Art.
Aber eigentlich ging er direkt auf Ihre Werke zu?
Ja, das schon, aber doch sehr zurückhaltend.
Warum sind dann alle zu K.O. Götz in die Klasse gewechselt?
Er war der Modernste. Konrad Fischer ![]() Konrad Fischer (1939 Düsseldorf – 1996 Düsseldorf) war ein deutscher Künstler und Galerist. In seiner 1967 in der Düsseldorfer Altstadt eröffneten Galerie stellte er frühe Vertreter der Minimal Art und der Konzeptkunst vor, darunter Carl Andre, Hanne Darboven, Bruce Nauman und Lawrence Weiner. Als „Konrad Lueg“ war Fischer vor Gründung seiner Galerie als Künstler tätig und stellte mehrfach unter anderen mit Gerhard Richter aus. Die bekannteste künstlerische Aktion, an der Lueg beteiligt war, fand im Oktober 1963 im Düsseldorfer Möbelhaus Berges unter dem Titel „Leben mit Pop. Eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus“ statt. war Student bei ihm und sagte mir: „Du kannst doch nicht bei Macketanz bleiben, Götz ist viel besser.“ So war’s ja auch. Macketanz war auch ein bisschen bieder. Netter Mensch. Und beide hielten sich an der Pfeife fest.
Konrad Fischer (1939 Düsseldorf – 1996 Düsseldorf) war ein deutscher Künstler und Galerist. In seiner 1967 in der Düsseldorfer Altstadt eröffneten Galerie stellte er frühe Vertreter der Minimal Art und der Konzeptkunst vor, darunter Carl Andre, Hanne Darboven, Bruce Nauman und Lawrence Weiner. Als „Konrad Lueg“ war Fischer vor Gründung seiner Galerie als Künstler tätig und stellte mehrfach unter anderen mit Gerhard Richter aus. Die bekannteste künstlerische Aktion, an der Lueg beteiligt war, fand im Oktober 1963 im Düsseldorfer Möbelhaus Berges unter dem Titel „Leben mit Pop. Eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus“ statt. war Student bei ihm und sagte mir: „Du kannst doch nicht bei Macketanz bleiben, Götz ist viel besser.“ So war’s ja auch. Macketanz war auch ein bisschen bieder. Netter Mensch. Und beide hielten sich an der Pfeife fest.
Im Atelier?
Ja. Wenn die zu uns in die Klasse kamen.
Sie haben dort in einem Großraumatelier gearbeitet?
Ja. Sehr viel. Jeden Tag.
Wie oft kam K.O. Götz vorbei?
Das weiß ich nicht mehr. Zweimal die Woche vielleicht.
Ihre allererste Ausstellung in Westdeutschland war 1962 in Fulda? ![]() Vom 08. bis zum 30. September 1962 stellte Gerhard Richter gemeinsam mit Manfred Kuttner in der Galerie Junge Kunst in Fulda aus.
Vom 08. bis zum 30. September 1962 stellte Gerhard Richter gemeinsam mit Manfred Kuttner in der Galerie Junge Kunst in Fulda aus.
Ja. Das kam durch Franz Erhard Walther, der hatte Beziehungen zu dem Kunstverein dort.
Und kamen da Leute nach Fulda?
Da ist keiner hingekommen. Fuldaer waren da – und Kuttner und ich. Die meisten meiner Arbeiten habe ich bald danach verbrannt.
Warum so radikal? Haben Sie sich darüber geärgert, über Ihre eigenen Werke? Es waren ja wahrscheinlich nicht so viele, dass man sie nicht einfach hätte aufheben können?
Hätte ich, ja. Aber ich wusste plötzlich, dass das nicht das ist, was ich will, solche Variationen vom Üblichen, wie „Neuer Realismus“ oder so was.
Nouveau Réalisme ![]() Nouveau Réalisme war eine Kunstströmung, die Ende der 1950er-Jahre in Frankreich entstand. In Abkehr vom Informel und anderen gestisch-abstrakten Ausdrucksweisen forderten die Künstler die Hinwendung zur alltäglichen Lebenswelt. Konkret wurde dieser Anspruch zum Beispiel in der Verwendung von Alltagsgegenständen als Material in der Kunst sichtbar. Am 27. Oktober 1960 wurde in der Pariser Wohnung von Yves Klein das Gründungsmanifest von Arman, François Dufrêne, Raymond Hains, Yves Klein, Martial Raysse, Pierre Restany, Daniel Spoerri, Jean Tinguely und Jacques de la Villeglé unterzeichnet. Siehe auch: „Nouveau Réalisme. Revolution des Alltäglichen“, hg. von Ulrich Krempel, Ausst.-Kat. Sprengel Museum Hannover, Ostfildern 2007. .
Nouveau Réalisme war eine Kunstströmung, die Ende der 1950er-Jahre in Frankreich entstand. In Abkehr vom Informel und anderen gestisch-abstrakten Ausdrucksweisen forderten die Künstler die Hinwendung zur alltäglichen Lebenswelt. Konkret wurde dieser Anspruch zum Beispiel in der Verwendung von Alltagsgegenständen als Material in der Kunst sichtbar. Am 27. Oktober 1960 wurde in der Pariser Wohnung von Yves Klein das Gründungsmanifest von Arman, François Dufrêne, Raymond Hains, Yves Klein, Martial Raysse, Pierre Restany, Daniel Spoerri, Jean Tinguely und Jacques de la Villeglé unterzeichnet. Siehe auch: „Nouveau Réalisme. Revolution des Alltäglichen“, hg. von Ulrich Krempel, Ausst.-Kat. Sprengel Museum Hannover, Ostfildern 2007. .
Ja.
Danach haben Sie nie wieder etwas verbrannt? Oder kommt das heute noch vor?
Verbrennen geht nicht mehr. Aber zerstören, übermalen oder ganz entsorgen, das ist normal. Ich wollte es damals loswerden, wusste aber nicht, wie. Und dann entdeckte ich diesen großen Container für Bauschutt, und der Hausmeister sagte, dass ich es darin verbrennen könne. Das war natürlich wunderbar: anzünden und erleichtert sein, dass alles weg war. ![]() Die Verbrennung der Werke fand nach dem Ende der Fuldaer Ausstellung im September 1962 statt. Vgl. Dietmar Elger, „Gerhard Richter, Maler“, Köln 2002, S. 51.
Die Verbrennung der Werke fand nach dem Ende der Fuldaer Ausstellung im September 1962 statt. Vgl. Dietmar Elger, „Gerhard Richter, Maler“, Köln 2002, S. 51.
In der Düsseldorfer Akademie?
Ja, im Hof der Akademie. Aber da war keiner dabei, außer dem Hausmeister.
Haben das andere Künstler auch gemacht?
Nein. Ich glaube nicht. Aber man weiß es ja nicht.
Wie haben Sie am Anfang im Westen Ihr Leben finanziert? Auch wenn Sie in der DDR durch die Aspirantur etwas privilegiert waren, war die Ostmark im Westen nichts wert.
Da hatte ich erst mal kein Geld.
Wovon haben Sie gelebt?
Ich bekam vom Amt ein kleines Stipendium. Zusätzlich haben wir gejobbt, und dann bauten wir Karnevalswagen. Darin waren wir sehr gut und haben richtig Geld verdient. War schön. Manchmal habe ich auch gekellnert. Statt feiern: kellnern. Das war richtig gut.
Haben Sie beim Karneval auch mal mitgefeiert?
Nicht oft. Das liegt mir nicht so.
Sie haben auch Porträts gemacht, als Auftragsarbeit. Zum Beispiel einmal ein Porträt von Herrn Schniewind. Der Auftrag kam, glaube ich, über Rudolf Jährling zustande? ![]() Gerhard Richter fertigte 1964 drei Porträts von Wilhelm Schniewind an. Siehe auch: Rudolf Jährling an Gerhard Richter, 02.12.1964, in: Brigitte Jacobs, „Dokumentation/Documentation“, Reihe „sediment. Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels“, Nr. 7, 2004, S. 61–109, hier S. 86.
Gerhard Richter fertigte 1964 drei Porträts von Wilhelm Schniewind an. Siehe auch: Rudolf Jährling an Gerhard Richter, 02.12.1964, in: Brigitte Jacobs, „Dokumentation/Documentation“, Reihe „sediment. Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels“, Nr. 7, 2004, S. 61–109, hier S. 86. 
Mit Jährling, das kam erst später, also nachdem wir die Bilder im Garten aufgestellt hatten. ![]() Im Februar 1964 fuhren Manfred Kuttner, Konrad Lueg, Sigmar Polke und Gerhard Richter mit einem VW-Bus nach Wuppertal, um dort im Vorgarten der von Rudolf Jährling gegründeten Galerie Parnass ihre Bilder aufzustellen.
Im Februar 1964 fuhren Manfred Kuttner, Konrad Lueg, Sigmar Polke und Gerhard Richter mit einem VW-Bus nach Wuppertal, um dort im Vorgarten der von Rudolf Jährling gegründeten Galerie Parnass ihre Bilder aufzustellen.
Was war das für eine Aktion?
Wir waren gierig darauf, dass unsere Arbeiten mal gesehen werden, und die Galerie hatte so eine Art Nimbus. Also sind wir nach Wuppertal zu der Galerie Parnass gefahren, haben die Bilder in den Garten gestellt und geklingelt: „Gucken Sie sich die Bilder an!“ Das hat denen gefallen und dann haben sie uns auch bald ausgestellt. ![]() „Neue Realisten. Konrad Lueg, Sigmar Polke, Gerd Richter“, Galerie Parnass, Wuppertal, 20. November – 30. Dezember 1964.
„Neue Realisten. Konrad Lueg, Sigmar Polke, Gerd Richter“, Galerie Parnass, Wuppertal, 20. November – 30. Dezember 1964.
Auch heute überlegen sich ja Künstler noch …
… wie sie bekannt werden können.
Ja! Wie geht das? Die wenigsten würden sich heute Erfolg davon versprechen, wenn sie im Garten einer etablierten Galerie ihre Bilder aus dem Auto auspackten und aufstellten. Haben Sie damals wirklich damit gerechnet, dass das Erfolg haben könnte? Oder war das eher ein Streich?
Nein, das war schon ernst gemeint.
Im Februar in Wuppertal – im Schnee?
Es hatte nur etwas geschneit.
Waren Sie nicht sehr überrascht, dass die Ihnen gleich eine Ausstellung angeboten haben?
Das haben die auch nicht sofort gesagt, also nicht zur selben Stunde. Aber doch bald nach dieser Vorstellung, die sie wohl etwas beeindruckt hat.
Haben andere so etwas auch gemacht?
Nein, ich glaube nicht. Das weiß ich nicht. Aber einen Laden mieten, wie wir das gemacht haben – in der Kaiserstraße ![]() Unter dem Titel „Kuttner, Lueg, Polke, Richter“ organisierten die vier Künstler vom 11. bis 26. Mai 1963 eine Ausstellung in einem angemieteten Laden in der Kaiserstraße 31A in Düsseldorf. –, das machte auch keiner, denke ich.
Unter dem Titel „Kuttner, Lueg, Polke, Richter“ organisierten die vier Künstler vom 11. bis 26. Mai 1963 eine Ausstellung in einem angemieteten Laden in der Kaiserstraße 31A in Düsseldorf. –, das machte auch keiner, denke ich.
Obwohl es auf der Hand liegt, dass sich Künstler, solange sie noch unbekannt sind, selbst Möglichkeiten schaffen, um ihre Werke zu zeigen. Da ist ein angemieteter Raum weniger exotisch als eine Präsentation unter freiem Himmel bei Schnee.
Ja, wir konnten die Bilder ja nicht reintragen, das wäre ja Belästigung gewesen.
War Ihre Ausstellung in der Kaiserstraße gut besucht?
Da war’s voll, der war ja klein, der Laden.
Haben Sie die Ausstellung im Vorfeld stark beworben?
Ja, mit Faltblättern, und jedes hatte eine andere Abbildung, da haben wir uns viel Arbeit gemacht.
Da haben Sie sich mit Konrad Lueg, Manfred Kuttner und Sigmar Polke zusammengesetzt und überlegt, wie man die Ausstellung bewerben kann?
Ja, das wurde geplant und dann gemacht.
Sie haben oft betont, dass es für Sie eher ein Zusammenschluss von …
Es war eine Art Notgemeinschaft. Wir hatten ähnliche Ansichten – darüber, was wir gut und schlecht finden –, und so tut man sich zusammen.
Als „Notgemeinschaft“ haben Sie dann sehr viel Zeit miteinander verbracht. Entwickelte sich daraus dennoch so etwas wie eine Freundschaft?
Ja, das schon, nur mit Kuttner war es nicht so ausgeprägt, er war halt dabei. Da hat sich kein so enges Verhältnis eingestellt wie zwischen Polke, Lueg und mir in der Zeit. Später dann nicht mehr.
Ist Kuttner freiwillig ausgestiegen? Er hat ja dann auch aufgehört zu malen.
Der war wohl weniger frei als wir. Es ergab sich dann einfach, also ohne Streit. Den gab es eher zwischen uns dreien. Böse Streite. Wenn wir uns gegenseitig besucht haben, war die Kritik oft sehr hart. Oder wir hatten auch mal Fischer verdächtigt, dass er viel zu tricky ist und alle seine Beziehungen spielen lässt oder irgend so etwas.
Haben Sie sich auch über Ihre Werke unterhalten?
Ja, sofort, und es wurde auch kritisiert.
Was haben Sie zum Beispiel bei Polke kritisiert?
Bei Polke gab’s nicht viel zu kritisieren. Da hieß es: „Das ist gut und das ist nicht so gut.“ So in der Art.
Warum gab es da nichts zu kritisieren?
Ich mochte seine Sachen. Bei Fischer war’s schon schwieriger. Er ist ja auch dann Galerist geworden.
Haben Sie ihn darin bestärkt? Dass er eigentlich nicht malen kann?
Nicht so direkt, denn so sicher ist man sich ja nicht, dass man gleich aburteilt. Da gab es auch so ein Erlebnis: Wir sind in der Altstadt, Konrad Fischer und ich, und da steht Alfred Schmela ![]() Alfred Schmela (1918 Dinslaken – 1980 Düsseldorf) eröffnete 1957 in der Hunsrückenstraße 16–18 in Düsseldorf eine Galerie. Sein Programm umfasste wesentliche Positionen der deutschen Nachkriegskunst, darunter Joseph Beuys, Gerhard Richter sowie Künstler aus dem Umfeld der ZERO-Bewegung. mit Hans-Jürgen Müller
Alfred Schmela (1918 Dinslaken – 1980 Düsseldorf) eröffnete 1957 in der Hunsrückenstraße 16–18 in Düsseldorf eine Galerie. Sein Programm umfasste wesentliche Positionen der deutschen Nachkriegskunst, darunter Joseph Beuys, Gerhard Richter sowie Künstler aus dem Umfeld der ZERO-Bewegung. mit Hans-Jürgen Müller ![]() Hans-Jürgen Müller (1936 Ilmenau – 2009 Stuttgart) eröffnete 1958 die Galerie Müller in Stuttgart, die nach seinem Umzug 1969 nach Köln von Margret Müller weitergeführt wurde. 1967 gehörte der Galerist zu den Mitbegründern des Kölner Kunstmarkts. Bis zur Schließung seiner Kölner Galerie 1973 zeigte er unter anderem Werke von Willi Baumeister, Peter Brüning, Arnulf Rainer, Dieter Roth und Günther Uecker. Zwischen 1976 und 1982 war Müller unter anderem am Aufbau der Privatsammlungen der Familien Grässlin, Krauss und Scharpff beteiligt. und stellt uns vor: „Das ist der Richter, der wird mal ein guter Maler, musste aufpassen, und das ist Konrad Fischer, der wird mal ein ganz toller Galerist.“ Da verstummte Konrad; das hat ihn so getroffen, dass er direkt das Lokal verließ.
Hans-Jürgen Müller (1936 Ilmenau – 2009 Stuttgart) eröffnete 1958 die Galerie Müller in Stuttgart, die nach seinem Umzug 1969 nach Köln von Margret Müller weitergeführt wurde. 1967 gehörte der Galerist zu den Mitbegründern des Kölner Kunstmarkts. Bis zur Schließung seiner Kölner Galerie 1973 zeigte er unter anderem Werke von Willi Baumeister, Peter Brüning, Arnulf Rainer, Dieter Roth und Günther Uecker. Zwischen 1976 und 1982 war Müller unter anderem am Aufbau der Privatsammlungen der Familien Grässlin, Krauss und Scharpff beteiligt. und stellt uns vor: „Das ist der Richter, der wird mal ein guter Maler, musste aufpassen, und das ist Konrad Fischer, der wird mal ein ganz toller Galerist.“ Da verstummte Konrad; das hat ihn so getroffen, dass er direkt das Lokal verließ.
Direkt?
Ja, sofort. Das hatte ihn bis ins Mark getroffen.
Klar, stellen Sie sich vor, es wäre andersrum gewesen.
Nein, das geht nicht, er war ja auch ein ganz anderer Typ. Allein im Atelier, das war nicht so seine Sache. Er war eher das Gegenteil eines einsamen Malers. Er brauchte Kontakte.
Und von der Malerei her?
Auch nicht so.
Aber die Aktion im Möbelhaus Berges ![]() „Leben mit Pop. Eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus“, Möbelhaus Berges, Düsseldorf, 11.–25. Oktober 1963.
„Leben mit Pop. Eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus“, Möbelhaus Berges, Düsseldorf, 11.–25. Oktober 1963. 
Ja, das war auch ein richtiges Spektakel, was wir da gemacht haben.
Und das konnte er: Spektakel.
Ja, und richtig gut.
Wer kam auf die Idee?
Wir suchten wieder mal einen Raum, um unsere Bilder auszustellen. Er stellte den Kontakt zu dem Möbelhaus her, und die hatten zwar etwas leer stehen, aber das war uns zu klein. So kam es zu der Idee, unsere Bilder in die verschiedenen Ausstellungsräume zu hängen, locker verteilt über drei Etagen. Hinzu kam so etwas wie eine Performance. Das war schon ziemlich gut alles, und aufregend.
Und warum waren Kuttner und Polke nicht dabei?
Zu zweit ist es unkomplizierter. Da kommt man leichter auf eine Idee und ist sich schneller einig. Ein Dritter stört dann eher.
Sie vier waren also wirklich keine Gruppe?
Nein. Nur anfangs sah es so aus; in der Kaiserstraße haben wir zu viert ausgestellt und später dann mal zu dritt in Holland ![]() „Kapitalistischer Realismus. Richter, Lueg & Polke“, Galerie Orez, Den Haag, 10. Juli –05. August 1965. .
„Kapitalistischer Realismus. Richter, Lueg & Polke“, Galerie Orez, Den Haag, 10. Juli –05. August 1965. .
Sie haben ja wahlweise mit Polke und mit Lueg ausgestellt …
Ja.
Haben die auch mal ohne Sie ausgestellt?
Nein.
Was haben Sie da richtig gemacht? Oder was haben die anderen falsch gemacht?
Gar nichts. Ich war vielleicht aktiver oder irgend so etwas.
War das so?
Ja, also mit Polke hatte ich dann auch einen viel engeren Kontakt als mit Lueg. Andererseits hatte Lueg immer die tolle Fähigkeit, sehr schnell zu sehen, was gut oder schlecht ist.
Was hat Polke an Ihren Arbeiten kritisiert?
Da war Fischer wichtiger. Kaum im Atelier, konnte er schon sagen: „gut“ oder „is nix“. Ganz schnelle Urteile, die hatte er auch später als Galerist. Das habe ich dann nur noch bei Palermo erlebt, diesen Sinn für Qualität. Polke hatte auch mehr Sinn für Ironie, das zeigte sich besonders bei unserem Katalog für die Galerie h in Hannover ![]() Sigmar Polke/Gerhard Richter, „Polke/Richter. Richter/Polke“, Ausst.-Kat. Galerie h, Hannover, Hannover 1966. .
Sigmar Polke/Gerhard Richter, „Polke/Richter. Richter/Polke“, Ausst.-Kat. Galerie h, Hannover, Hannover 1966. .
Das war für Sie das Wichtigste an diesen engen Verbindungen mit Polke oder mit Palermo, dieser Austausch über die Kunst?
Ja, genau. Was Kunst, was Malerei ausmacht, was das für Qualitäten sind, die gute Bilder von schlechten unterscheiden. Wir – besonders Palermo – waren richtig überzeugt, dass es Kriterien gibt, die Kunst ausmachen.
Intuitiv oder deskriptiv?
Intuitiv. Denn beschreiben kann man das nicht, auch nicht erklären. Man kann es nur sehen.
Das heißt, es ging eher um „Finde ich gut, finde ich nicht gut“? Oder haben Sie versucht, das zu diskutieren?
Ja, sicher, das hört ja nicht auf. So war es dann auch mit Benjamin Buchloh.
In Gesprächen über Ihre eigenen Arbeiten?
Ja. Und natürlich auch über die Arbeiten anderer, über Kunst überhaupt.
Wo haben Sie sich kennengelernt?
Buchloh arbeitete damals bei Rudolf Zwirner in Köln, als ich 1968 dort ausstellte ![]() „Gerhard Richter“, Galerie Rudolf Zwirner, Köln, Juli – Oktober 1968. . Er fand meine Bilder interessant, und dann …
„Gerhard Richter“, Galerie Rudolf Zwirner, Köln, Juli – Oktober 1968. . Er fand meine Bilder interessant, und dann …
… ist daraus ein lebenslanges Gespräch geworden?
Ja, ungefähr so, ja.
Zwirner, glaube ich, wollte Sie im April 1965 schon unter Vertrag nehmen? ![]() Vgl. Günter Herzog, „Ganz am Anfang“, in: „Ganz am Anfang. Richter, Polke, Lueg & Kuttner“, Reihe „sediment. Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels“, Nr. 7, 2004, S. 9–31, hier S. 21.
Vgl. Günter Herzog, „Ganz am Anfang“, in: „Ganz am Anfang. Richter, Polke, Lueg & Kuttner“, Reihe „sediment. Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels“, Nr. 7, 2004, S. 9–31, hier S. 21.
Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war es nicht das, was ich wollte. Er war ja mehr Händler als Galerist. Während Fischer ein Galerist mit einer Meinung und einem Konzept war: mit Carl Andre, Sol LeWitt und anderen Minimal- und Konzeptkünstlern. Da waren wir erst einmal kurz abgemeldet.
Sie haben erst in den 70er-Jahren bei Fischer ausgestellt. ![]() Im April 1970 stellte Gerhard Richter erstmals in der Galerie von Konrad Fischer in Düsseldorf aus. Bis 1983 wurden seine Werke dort in sechs weiteren Einzelausstellungen gezeigt.
Im April 1970 stellte Gerhard Richter erstmals in der Galerie von Konrad Fischer in Düsseldorf aus. Bis 1983 wurden seine Werke dort in sechs weiteren Einzelausstellungen gezeigt.
Ja. Vorher hatte ich bei Heiner Friedrich ![]() Heiner Friedrich (* 1938 Stettin, Pommern, heute Polen) gründete 1963 gemeinsam mit Franz Dahlem und seiner damaligen Ehefrau Six Friedrich die Galerie Friedrich & Dahlem in München. 1970 siedelte er mit seiner neuen Lebensgefährtin Thordis Moeller nach Köln über und betrieb dort eine zweite Galerie. Ab 1973 expandierte er in die Vereinigten Staaten und eröffnete im New Yorker Stadtteil SoHo die Heiner Friedrich Gallery Inc. Das Galerieprogramm umfasste wichtige Positionen der Minimal Art und Konzeptkunst, darunter Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd und Walter De Maria. Mit seiner späteren Ehefrau Philippa de Menil und der Kunsthistorikerin Helen Winkler gründete Friedrich 1974 in New York die Dia Art Foundation, die eine dauerhafte Setzung künstlerischer Großprojekte unterstützt. Gerhard Richter war in der Galerie Friedrich & Dahlem unter anderem in folgenden Ausstellungen vertreten: „Gerd Richter. Fotobilder, Portraits und Familien“, 10. Juni – 10. Juli 1964 (Doppelausstellung mit Peter Klasen); „Uwe Lausen, Natai Morosov, Gerd Richter“, 19. Oktober – 20. November 1964; „Gerhard Richter – Farbtafeln“, 11.–27. Oktober 1966; „Gerhard Richter. Neue Bilder“, 02. Mai – 04. Juni 1967. ausgestellt.
Heiner Friedrich (* 1938 Stettin, Pommern, heute Polen) gründete 1963 gemeinsam mit Franz Dahlem und seiner damaligen Ehefrau Six Friedrich die Galerie Friedrich & Dahlem in München. 1970 siedelte er mit seiner neuen Lebensgefährtin Thordis Moeller nach Köln über und betrieb dort eine zweite Galerie. Ab 1973 expandierte er in die Vereinigten Staaten und eröffnete im New Yorker Stadtteil SoHo die Heiner Friedrich Gallery Inc. Das Galerieprogramm umfasste wichtige Positionen der Minimal Art und Konzeptkunst, darunter Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd und Walter De Maria. Mit seiner späteren Ehefrau Philippa de Menil und der Kunsthistorikerin Helen Winkler gründete Friedrich 1974 in New York die Dia Art Foundation, die eine dauerhafte Setzung künstlerischer Großprojekte unterstützt. Gerhard Richter war in der Galerie Friedrich & Dahlem unter anderem in folgenden Ausstellungen vertreten: „Gerd Richter. Fotobilder, Portraits und Familien“, 10. Juni – 10. Juli 1964 (Doppelausstellung mit Peter Klasen); „Uwe Lausen, Natai Morosov, Gerd Richter“, 19. Oktober – 20. November 1964; „Gerhard Richter – Farbtafeln“, 11.–27. Oktober 1966; „Gerhard Richter. Neue Bilder“, 02. Mai – 04. Juni 1967. ausgestellt.
Den hat Ihnen, glaube ich, Kasper König ![]() Kasper König (* 1943 Mettingen) ist ein Kurator und ehemaliger Museumsdirektor. Nach einem Volontariat in der Galerie Rudolf Zwirner in Köln lebte er ab 1965 in New York. Von 1973 bis 1975 arbeitete er als Dozent am Nova Scotia College of Art & Design in Halifax, Kanada, 1977 gründete er gemeinsam mit dem Kunsthistoriker Klaus Bußmann die Skulptur-Projekte in Münster. König war von 1984 bis 1988 Professor für Kunst und Öffentlichkeit an der Kunstakademie Düsseldorf sowie 1989 bis 2000 Rektor der Städelschule in Frankfurt am Main. Im Jahr 2000 wurde König Direktor des Museums Ludwig in Köln, das er bis 2012 leitete. Er verantwortete zahlreiche Großausstellungen, darunter „Westkunst. Zeitgenössische Kunst seit 1939“ (Rheinhallen, Köln 1981), „von hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf“ (Messe Düsseldorf, 1984) sowie die „Manifesta 10“ (2014) in St. Petersburg. König gilt als wichtiger Vermittler der Kunst von Donald Judd, On Kawara, Claes Oldenburg, Gerhard Richter und Franz Erhard Walther. geschickt?
Kasper König (* 1943 Mettingen) ist ein Kurator und ehemaliger Museumsdirektor. Nach einem Volontariat in der Galerie Rudolf Zwirner in Köln lebte er ab 1965 in New York. Von 1973 bis 1975 arbeitete er als Dozent am Nova Scotia College of Art & Design in Halifax, Kanada, 1977 gründete er gemeinsam mit dem Kunsthistoriker Klaus Bußmann die Skulptur-Projekte in Münster. König war von 1984 bis 1988 Professor für Kunst und Öffentlichkeit an der Kunstakademie Düsseldorf sowie 1989 bis 2000 Rektor der Städelschule in Frankfurt am Main. Im Jahr 2000 wurde König Direktor des Museums Ludwig in Köln, das er bis 2012 leitete. Er verantwortete zahlreiche Großausstellungen, darunter „Westkunst. Zeitgenössische Kunst seit 1939“ (Rheinhallen, Köln 1981), „von hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf“ (Messe Düsseldorf, 1984) sowie die „Manifesta 10“ (2014) in St. Petersburg. König gilt als wichtiger Vermittler der Kunst von Donald Judd, On Kawara, Claes Oldenburg, Gerhard Richter und Franz Erhard Walther. geschickt?
Das stimmt. Kasper König hatte zu Friedrich gesagt: „Geh mal und guck dir den Akademie-Rundgang an, da gibt’s ein paar interessante Typen.“ Lange her, so um 1963 oder 64
Und dann kam Friedrich aus München?
Dann kam er. Bald darauf rief er mich an oder schrieb, und so kam die Verbindung zustande.
Und wie kam der bei Ihnen an?
Na ja, der war schon ein neuartiger und sehr intensiver Typ. Und wer sich für mich interessierte, davon gab’s ja nicht viele, der war erst mal gut. Friedrich war noch nicht etabliert, der hatte sehr schlicht angefangen. Meine erste Ausstellung fand zusammen mit Peter Klasen statt. ![]() „Gerd Richter. Fotobilder, Portraits und Familien“, Galerie Friedrich & Dahlem, München, 10. Juni – 10. Juli 1964 (Doppelausstellung mit Peter Klasen). Kennt kein Mensch, glaube ich. Und Galeriekünstler war Uwe Lausen. Dann war in der Galerie noch Franz Dahlem
„Gerd Richter. Fotobilder, Portraits und Familien“, Galerie Friedrich & Dahlem, München, 10. Juni – 10. Juli 1964 (Doppelausstellung mit Peter Klasen). Kennt kein Mensch, glaube ich. Und Galeriekünstler war Uwe Lausen. Dann war in der Galerie noch Franz Dahlem ![]() Franz Dahlem (* 1938 München) gründete 1963 gemeinsam mit Heiner und Six Friedrich die Galerie Friedrich & Dahlem in München. Zum Jahreswechsel 1966/67 eröffnete Dahlem eine Galerie in Darmstadt und lernte dort den Sammler Karl Ströher kennen. Gemeinsam mit Heiner Friedrich vermittelte er Ströher unter anderem die Sammlung des US-amerikanischen Versicherungsmaklers Leon Kraushar. Dahlem gilt als wichtiger Vermittler der Kunst von Georg Baselitz, Joseph Beuys, Uwe Lausen und Blinky Palermo. , den konnte ich nicht so richtig für voll nehmen.
Franz Dahlem (* 1938 München) gründete 1963 gemeinsam mit Heiner und Six Friedrich die Galerie Friedrich & Dahlem in München. Zum Jahreswechsel 1966/67 eröffnete Dahlem eine Galerie in Darmstadt und lernte dort den Sammler Karl Ströher kennen. Gemeinsam mit Heiner Friedrich vermittelte er Ströher unter anderem die Sammlung des US-amerikanischen Versicherungsmaklers Leon Kraushar. Dahlem gilt als wichtiger Vermittler der Kunst von Georg Baselitz, Joseph Beuys, Uwe Lausen und Blinky Palermo. , den konnte ich nicht so richtig für voll nehmen.
Warum nicht?
Der war schon ein verrückter Typ.
Ein bisschen verrückt ist doch gut.
Ja, aber wenn das alles ist, nichts weiter, dann ist das zu wenig.
Aber er hatte doch unheimlich Einfluss?
In der Galerie hatte er nicht viel Einfluss. Dann später, mit Karl Ströher ![]() Bei einer New-York-Reise für den Sammler Karl Ströher hatte Franz Dahlem erfahren, dass die Sammlung Kraushar zum Verkauf stand, und setzte alles daran, Ströher dafür zu interessieren. Die Sammlung umfasste 160 Objekte, darunter 6 Bilder von Roy Lichtenstein, 21 Objekte von Claes Oldenburg, 6 Bilder und Objekte von Andy Warhol, 15 Bilder von James Rosenquist, 7 Bilder von Tom Wesselmann und weitere Werke amerikanischer Künstler (unter anderen von Jasper Johns und Walter De Maria). Im Frühjahr 1968 erwarb Karl Ströher die gesamte Sammlung Kraushar und brachte diese nach Darmstadt. Vgl. Jean-Christophe Ammann/Christmut Präger, „Museum für Moderne Kunst und Sammlung Ströher“, Schriften zur Sammlung des Museums für Moderne Kunst, Frankfurt am Main 1991, S. 37, 81, sowie Günter Herzog, „Die Galerie Heiner Friedrich.“, in: „Galerie Heiner Friedrich. München, Köln, New York, 1963–1980“, Reihe „sediment. Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels“, Nr. 21/22, 2013, S. 9–21, hier S. 13. und mit der Pop-Art, da war er wohl sehr erfolgreich, er konnte sehr intensiv sein.
Bei einer New-York-Reise für den Sammler Karl Ströher hatte Franz Dahlem erfahren, dass die Sammlung Kraushar zum Verkauf stand, und setzte alles daran, Ströher dafür zu interessieren. Die Sammlung umfasste 160 Objekte, darunter 6 Bilder von Roy Lichtenstein, 21 Objekte von Claes Oldenburg, 6 Bilder und Objekte von Andy Warhol, 15 Bilder von James Rosenquist, 7 Bilder von Tom Wesselmann und weitere Werke amerikanischer Künstler (unter anderen von Jasper Johns und Walter De Maria). Im Frühjahr 1968 erwarb Karl Ströher die gesamte Sammlung Kraushar und brachte diese nach Darmstadt. Vgl. Jean-Christophe Ammann/Christmut Präger, „Museum für Moderne Kunst und Sammlung Ströher“, Schriften zur Sammlung des Museums für Moderne Kunst, Frankfurt am Main 1991, S. 37, 81, sowie Günter Herzog, „Die Galerie Heiner Friedrich.“, in: „Galerie Heiner Friedrich. München, Köln, New York, 1963–1980“, Reihe „sediment. Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels“, Nr. 21/22, 2013, S. 9–21, hier S. 13. und mit der Pop-Art, da war er wohl sehr erfolgreich, er konnte sehr intensiv sein.
Aber warum …
… haben sich Heiner Friedrich und Franz Dahlem zusammengetan? Das weiß ich auch nicht.
Michael Werner meint, während bei ihm ein etwas ruppiger Ton im Umgang mit den Künstlern vorherrschte, erfuhr Baselitz bei Friedrich etwas mehr Komfort, unter anderem mit Blumen für die Gattin. Waren das unterschiedliche Welten?
Also Blumen für die Gattin hat’s nicht gegeben.
Das wüssten Sie?
Aber ja!
Friedrich hat dennoch Eindruck auf Sie gemacht?
Ja, seine Art zu denken lag mir sehr. Und so habe ich bei ihm sehr gern ausgestellt. Einige Jahre.
Bei ihm haben Sie auch einen Vertrag unterschrieben. ![]() Der Vertrag zwischen Gerhard Richter und Heiner Friedrich bestand von April 1966 bis März 1968.
Der Vertrag zwischen Gerhard Richter und Heiner Friedrich bestand von April 1966 bis März 1968.
Den ich dann vorzeitig wieder aufgelöst habe. Deshalb habe ich gleich eine Stelle als Kunstlehrer angenommen – um mich finanziell abzusichern.
Von 65 bis 68 waren Sie bei ihm, oder?
Genau, bis 68. Und das war ein Schritt für mich zu sagen: „Ich will nicht mehr mit dir.“ Er war nicht richtig nett. Er zahlte nicht. Da hab ich mir einen Rechtsanwalt genommen, damit ich an mein Geld komme. Und es passte mir auch nicht, dass er die Amis so bevorzugte.
Wer war das damals?
Mike Heizer, Bridget Polk, Walter De Maria, Dan Flavin und so weiter. Die wohnten alle in tollen Hotels, während wir, Palermo und ich, immer so billige Hotels bekamen. Das hat mich ein bisschen gefuchst.
Imi Knoebel ![]() Imi Knoebel (eigtl. Klaus Wolf Knoebel; * 1940 Dessau) ist ein deutscher Künstler und Beuys-Schüler, der mit seinen analytisch angelegten Bildern und Skulpturen zu den frühesten Vertretern der Minimal Art in Deutschland gehört. Zwischen 1971 und 1979 war er regelmäßig in Ausstellungen der Galerie Heiner Friedrich vertreten. war ja auch bei Heiner Friedrich.
Imi Knoebel (eigtl. Klaus Wolf Knoebel; * 1940 Dessau) ist ein deutscher Künstler und Beuys-Schüler, der mit seinen analytisch angelegten Bildern und Skulpturen zu den frühesten Vertretern der Minimal Art in Deutschland gehört. Zwischen 1971 und 1979 war er regelmäßig in Ausstellungen der Galerie Heiner Friedrich vertreten. war ja auch bei Heiner Friedrich.
Ah ja, der war auch da.
Und Polke aber nicht?
Das kann sein. Es gibt einen Brief, in dem ich den Polke so empfehle … Nein, ich irre, damals hatte ich den Konrad Fischer empfohlen, nicht Polke. So mit kleinen Skizzen seiner Bilder.
Sie haben aufgezeichnet, was Fischer machte, damit Heiner Friedrich sich ein Bild von seinen Arbeiten machen konnte?
Ja, im Brief. Damals sahen seine Bilder aus wie Tapetenmuster.
Und Friedrich wollte nicht?
Ich glaube, er hat ihn nie ausgestellt.
Sie haben auch nach Vertragsauflösung weiter bei ihm in der Galerie ausgestellt. ![]() In den Jahren 1968 bis 1975 stellte Gerhard Richter in zehn Einzel- und Gruppenausstellungen in den verschiedenen Dependencen der Galerie Heiner Friedrich in Köln, München und New York aus.
In den Jahren 1968 bis 1975 stellte Gerhard Richter in zehn Einzel- und Gruppenausstellungen in den verschiedenen Dependencen der Galerie Heiner Friedrich in Köln, München und New York aus.
Ah ja, stimmt. Ziemlich oft sogar, unter anderem mit Palermo.
Das heißt aber, Sie haben damals nicht mit Heiner Friedrich gebrochen?
Erst mal war das schon ein Bruch oder ein Krach. Aber Sie haben recht. Und später, so gegen Ende unserer Zusammenarbeit, habe ich ihm sogar Prozente gegeben, als ich mal was direkt verkaufte, an Hans Grothe ![]() Hans Grothe (* 1930 Duisburg) ist ein Architekt, Bauunternehmer und Kunstsammler. Ab Ende der 1960er-Jahre legte er mit Werken von Georg Baselitz, Jörg Immendorff, Anselm Kiefer, Sigmar Polke und Gerhard Richter eine bedeutende Sammlung zeitgenössischer deutscher Malerei an. . Da teilten sich zwei Galeristen die Prozente.
Hans Grothe (* 1930 Duisburg) ist ein Architekt, Bauunternehmer und Kunstsammler. Ab Ende der 1960er-Jahre legte er mit Werken von Georg Baselitz, Jörg Immendorff, Anselm Kiefer, Sigmar Polke und Gerhard Richter eine bedeutende Sammlung zeitgenössischer deutscher Malerei an. . Da teilten sich zwei Galeristen die Prozente.
Nämlich?
Friedrich und Fischer. Ich glaube, jeder bekam 20 Prozent.
Ohne Vertrag?
Ohne Vertrag. Ich hatte ja bei beiden ausgestellt.
Kasper König, der Ihnen den Friedrich geschickt hatte, hat aus der „Leben mit Pop“-Ausstellung die Schmela-Pappfigur an den Sammler Wolfgang Hahn vermittelt. ![]() Vgl. Günter Herzog, „Ganz am Anfang“, in: „Ganz am Anfang. Richter, Polke, Lueg & Kuttner“, Reihe „sediment. Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels“, Nr. 7, 2004, S. 9–31, hier S. 21.
Vgl. Günter Herzog, „Ganz am Anfang“, in: „Ganz am Anfang. Richter, Polke, Lueg & Kuttner“, Reihe „sediment. Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels“, Nr. 7, 2004, S. 9–31, hier S. 21.
Fischer und ich hatten damals zwei Figuren für die „Leben mit Pop“-Ausstellung gemacht – so wie die Karnevalsfiguren: Pappmaschee über Drahtgeflecht – und dann bemalt. Schmela und Kennedy, nur so zum Spaß. Wir haben die dann verschenkt oder vergessen. Ich erinnere nur noch, dass Kasper König die lebensgroße Kennedy-Figur aufs Dach seines Autos gebunden hatte, um sie nach Münster zu schaffen – und das war am Tag nach dem Attentat ![]() Am 22. November 1963 wurde der amtierende US-Präsident John F. Kennedy während einer Wahlkampfreise von Lee Harvey Oswald in Dallas erschossen. Die Umstände des Attentats sind bis heute umstritten. Siehe auch: Robert Dallek, „John F. Kennedy. Ein unvollendetes Leben“, München 2003. . Das war schon makaber. Was mit dem Schmela geworden ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, dass ich mich sehr geärgert habe, als ich diese lächerliche Figur im Kunstmuseum in München wiedersah, ausgestellt.
Am 22. November 1963 wurde der amtierende US-Präsident John F. Kennedy während einer Wahlkampfreise von Lee Harvey Oswald in Dallas erschossen. Die Umstände des Attentats sind bis heute umstritten. Siehe auch: Robert Dallek, „John F. Kennedy. Ein unvollendetes Leben“, München 2003. . Das war schon makaber. Was mit dem Schmela geworden ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, dass ich mich sehr geärgert habe, als ich diese lächerliche Figur im Kunstmuseum in München wiedersah, ausgestellt.
Hat sich mit Kasper König eine enge Freundschaft entwickelt?
Ja, eine leicht gebrochene. Seine anarchistische Seite störte mich manchmal. Die Art, wie er mal reagierte, als Kinder einen Ball gegen ein Bild in seinem Wohnzimmer knallten, die war schon sehr lässig. Dann wieder konnte diese Respektlosigkeit auch imponierend sein.
Mit den Künstlern ist er aber gut umgegangen?
Wenn er sie leiden konnte, ja.
Er hat Sie auch 87 nach Frankfurt an die Städelschule geholt. Wie lange waren Sie da?
Ich glaube nur ein Semester. ![]() 1987 wurde Gerhard Richter von Kasper König an die Städelschule berufen. 1988 trat Richter dort seine Stelle als Professor an. Seine Klasse übernahm ab 1989 Jörg Immendorff.
1987 wurde Gerhard Richter von Kasper König an die Städelschule berufen. 1988 trat Richter dort seine Stelle als Professor an. Seine Klasse übernahm ab 1989 Jörg Immendorff.
Haben Sie damals auch in Frankfurt gelebt?
Nein, ich habe im Hotel geschlafen. Jede Woche ging’s hin und zurück. Die Schule dort hatte eine nicht so angenehme Atmosphäre. Die Düsseldorfer Akademie dagegen war elitär, mit Kricke, Götz und dann Beuys. Das hatte einen Anspruch, das liegt mir mehr. Die Frankfurter nannten sich alle „Du“, und einer war Koch, Peter Kubelka ![]() Peter Kubelka (* 1934 Wien) ist ein österreichischer Filmemacher und Künstler, der sich vornehmlich mit den Möglichkeiten des metrischen Films beschäftigt. Er war von 1978 bis 2000 als Professor der Klasse für Film und Kochen als Kunstgattung an der Städelschule in Frankfurt am Main tätig. . Wie eine Malklasse hatte er eine Kochklasse … Dafür bin ich viel zu einseitig interessiert, nur an Malerei.
Peter Kubelka (* 1934 Wien) ist ein österreichischer Filmemacher und Künstler, der sich vornehmlich mit den Möglichkeiten des metrischen Films beschäftigt. Er war von 1978 bis 2000 als Professor der Klasse für Film und Kochen als Kunstgattung an der Städelschule in Frankfurt am Main tätig. . Wie eine Malklasse hatte er eine Kochklasse … Dafür bin ich viel zu einseitig interessiert, nur an Malerei.
War es auch zu sehr Familie?
Ja, so könnte man sagen. Thomas Bayrle war auch dort. In der Mittagszeit spielte die Lehrerschaft Boule. Also alles eher gemütlich, ein Trend. Und so anspruchslos schienen mir auch die Studenten. Als ich zum Beispiel mal wieder etwas an einer Studienarbeit kritisierte, bekam ich zur Antwort: „Mir gefällt das aber.“ – Was sollte ich da noch?
Waren Ihre Lehrer anders?
Ja, sicher. Das war ein ganz anderes Klima, da war Kunst noch eher was Hehres und schwierig, also das Gegenteil einer entspannenden Freizeitbeschäftigung.
Trotzdem kann man doch auch als Student anderer Meinung sein und sagen, dass man es anders sieht. Ist das nicht ganz normal?
Ja, wenn man versucht, die Kritik zu bedenken. Nur so, mit der Antwort: „Mir gefällt das aber“, wird doch jede weitere Bemühung verhindert. Das ist eine gefährliche Selbstzufriedenheit.
Bei Künstlern war das vermutlich damals schon sehr ausgeprägt. Heute hat sich die ganze Gesellschaft in diese Richtung bewegt, oder?
Da geht ja das Fernsehen voran. Auf allen Kanälen ist es Vorbild für plumpes Verhalten, für Dummheit. Das alles geht doch schon in Richtung Verwahrlosung, so wie auf der Domplatte. Das ist auch neu, diese Selbstüberschätzung und Rücksichtslosigkeit. Ich merke das in den Briefen, die ich bekomme. Ohne jede Scheu wollen die mich mal besuchen oder Geld haben oder ein Bild mit mir tauschen.
Haben Sie früher mit Künstlern Bilder oder Werke getauscht?
Ja doch, natürlich hatte ich was von Polke und Palermo und Fischer – und dann auch einen Uecker und Graubner, später auch Artschwager. Also von allen, mit denen ich zu tun hatte.
Mit Uecker hatten Sie eine engere Beziehung? Er war derjenige aus dem ZERO-Umfeld, mit dem Sie am meisten Kontakt hatten?
Ja! Durch ihn habe ich mein erstes Atelier bekommen. Das war am Fürstenwall, direkt neben seinem.
Der Kontakt entstand allein durch die räumliche Nähe?
Ja. Und dann ist er ein unglaublich herzlicher Typ.
Mit ihm haben Sie 68 eine Ausstellung in Baden-Baden gemacht?
Ja, das war nicht so doll.
Das „Leben im Museum“ ![]() „Junge deutsche Künstler. 14 x 14 – Leben im Museum“, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, 05.–15. April 1968. .
„Junge deutsche Künstler. 14 x 14 – Leben im Museum“, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, 05.–15. April 1968. .
Ja, genau das ist der Punkt. Da bin ich, sagen wir mal, verführt worden.
Von Uecker?
Ja, und von Klaus Gallwitz ![]() Klaus Gallwitz (* 1930 Pillnitz) ist ein deutscher Kunsthistoriker und Kurator, der von 1967 bis 1974 die Kunsthalle Baden-Baden leitete. Von 1974 bis 1994 war er Direktor am Städel Museum in Frankfurt am Main, von 1995 bis 2002 leitete er das Künstlerhaus Schloss Balmoral in Bad Ems. Ab 2004 war er unter anderen als Gründungsdirektor des Museums Frieder Burda in Baden-Baden und des Arp Museums Bahnhof Rolandseck in Remagen tätig. Zwischen 1976 und 1980 betreute Gallwitz dreimal den Deutschen Pavillon auf der Biennale von Venedig, wo er Ausstellungen mit Joseph Beuys (1976), Jochen Gerz (1976), Reiner Ruthenbeck (1976), Dieter Krieg (1978), Ulrich Rückriem (1978), Georg Baselitz (1980) und Anselm Kiefer (1980) verantwortete. und dem damaligen Zeitgeist. Ich glaube, dass das ganz gut ankam. Aber ich fand es bald ziemlich lächerlich, was wir da machten.
Klaus Gallwitz (* 1930 Pillnitz) ist ein deutscher Kunsthistoriker und Kurator, der von 1967 bis 1974 die Kunsthalle Baden-Baden leitete. Von 1974 bis 1994 war er Direktor am Städel Museum in Frankfurt am Main, von 1995 bis 2002 leitete er das Künstlerhaus Schloss Balmoral in Bad Ems. Ab 2004 war er unter anderen als Gründungsdirektor des Museums Frieder Burda in Baden-Baden und des Arp Museums Bahnhof Rolandseck in Remagen tätig. Zwischen 1976 und 1980 betreute Gallwitz dreimal den Deutschen Pavillon auf der Biennale von Venedig, wo er Ausstellungen mit Joseph Beuys (1976), Jochen Gerz (1976), Reiner Ruthenbeck (1976), Dieter Krieg (1978), Ulrich Rückriem (1978), Georg Baselitz (1980) und Anselm Kiefer (1980) verantwortete. und dem damaligen Zeitgeist. Ich glaube, dass das ganz gut ankam. Aber ich fand es bald ziemlich lächerlich, was wir da machten.
Es war nicht Ihre Idee?
Wir haben sie zusammen entwickelt, hauptsächlich erst beim Aufbau der Ausstellung. Da war Uecker sicher der Aktivere.
Und die Idee war, dass Sie im Museum anwesend sind?
Ja, angeblich da wohnend. Gibt ja auch Fotos davon; sehe ich heute noch nicht gerne. Wir, in Schlafanzügen auf der Museumstreppe liegend. Die Ausstellung selbst war eigentlich ganz gut.
„Leben mit Pop“ im Möbelhaus mit Konrad Lueg …
… war ganz anders.
Was war der Unterschied?
„Leben mit Pop“ hatte eine Bedeutung, war richtig durchdacht, jede Handlung genau festgelegt. Bei aller Komik war das nie so billig wie unser Happening in Baden-Baden.
Sie haben sehr früh Ihre Begeisterung für Fluxus geäußert.
Ja! Fluxus hat mich sehr beeindruckt, mir gewissermaßen eine Tür geöffnet. Und auch „Leben mit Pop“ stand Fluxus viel näher.
In der Ausstellung in der Kaiserstraße gab es ein Gästebuch ![]() Vgl. Günter Herzog, „Ganz am Anfang“, in: „Ganz am Anfang. Richter, Polke, Lueg & Kuttner“, Reihe „sediment. Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels“, Nr. 7, 2004, S. 9–31, hier S. 14. , in dem unter anderen Nam June Paik und Vostell verzeichnet sind.
Vgl. Günter Herzog, „Ganz am Anfang“, in: „Ganz am Anfang. Richter, Polke, Lueg & Kuttner“, Reihe „sediment. Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels“, Nr. 7, 2004, S. 9–31, hier S. 14. , in dem unter anderen Nam June Paik und Vostell verzeichnet sind.
Ach, die waren da?
Im Gästebuch waren die Namen aufgeführt.
Nicht von denen selber geschrieben?
Es steht die These im Raum, dass das Ihre Handschrift sei!
Ah ja, ich erinnere mich.
Lehmbruck ![]() Der Bildhauer Wilhelm Lehmbruck (1881 Meiderich – 1919 Berlin) studierte von 1901 bis 1906 an der Düsseldorfer Kunstakademie. 1910 zog er mit seiner Familie nach Paris und kehrte erst nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs nach Deutschland zurück. Aufgrund einer amtlich bescheinigten Schwerhörigkeit war Lehmbruck vom Kriegsdienst freigestellt. Ende 1916 übersiedelte er nach Zürich. Im März 1919, bei einem Aufenthalt in Berlin, nahm er sich das Leben. beispielsweise war auch eingetragen.
Der Bildhauer Wilhelm Lehmbruck (1881 Meiderich – 1919 Berlin) studierte von 1901 bis 1906 an der Düsseldorfer Kunstakademie. 1910 zog er mit seiner Familie nach Paris und kehrte erst nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs nach Deutschland zurück. Aufgrund einer amtlich bescheinigten Schwerhörigkeit war Lehmbruck vom Kriegsdienst freigestellt. Ende 1916 übersiedelte er nach Zürich. Im März 1919, bei einem Aufenthalt in Berlin, nahm er sich das Leben. beispielsweise war auch eingetragen.
Ach, das ist gut. Ein hübscher Spaß.
Mit welcher Absicht?
Um das ein bisschen witzig, ironisch zu sehen, solche Gästebücher.
Waren das Vorbilder von Ihnen? Vostell …
Den hatte ich auch reingeschrieben, aber Vostell fanden wir gar nicht gut, nie. Und mit Lehmbruck hatte ich auch nichts zu tun.
Aber mit Nam June Paik?
Ja, mit dem ja.
Da ging es um gesteigerte Aufmerksamkeit?
Ja klar! Darum, ein paar bekannte Namen zu haben. Ein netter Gag.
Dietmar Elger schrieb über Sie, Ihre Sorge, mit anderen eine Gruppe oder ein Kollektiv zu bilden, ziehe sich durch Ihr gesamtes Leben. ![]() Vgl. Stephan Strsembski, „Kapitalistischer Realismus?“, in: „Ganz am Anfang. Richter, Polke, Lueg & Kuttner“, Reihe „sediment. Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels“, Nr. 7, 2004, S. 47–54, hier S. 49.
Vgl. Stephan Strsembski, „Kapitalistischer Realismus?“, in: „Ganz am Anfang. Richter, Polke, Lueg & Kuttner“, Reihe „sediment. Mitteilungen zur Geschichte des Kunsthandels“, Nr. 7, 2004, S. 47–54, hier S. 49.
Es kann sein, dass ich kein Gruppenmensch bin – oder wie war das gemeint?
Ja, so verstehe ich das. Dass Sie fast Angst hatten, mit einer Gruppe identifiziert zu werden.
Eher eine Abneigung. Keinen Spaß an der Gruppe.
Es geht also nicht darum, dass Sie als Künstler als Individuum wahrgenommen werden wollen? Oder spielte das auch eine Rolle?
Doch. Das ist für mich irgendwie selbstverständlich, deswegen kann ich auch den Satz von Adorno nicht vergessen: „Jedes Kunstwerk ist der Todfeind des anderen.“ ![]() „Ein Kunstwerk ist der Todfeind des anderen.“ Theodor W. Adorno, „Ästhetische Theorie“, Frankfurt am Main 1970, S. 59. Das schließt andere aus. Was aber nicht heißt, dass ich andere Künstler nicht schätzen könnte. Im Gegenteil.
„Ein Kunstwerk ist der Todfeind des anderen.“ Theodor W. Adorno, „Ästhetische Theorie“, Frankfurt am Main 1970, S. 59. Das schließt andere aus. Was aber nicht heißt, dass ich andere Künstler nicht schätzen könnte. Im Gegenteil.
Auch jüngere?
Da kenne ich natürlicherweise viel weniger.
Wen schätzen Sie?
Von meiner Generation Serra zum Beispiel, Ryman, Andre, Kounellis, Darboven und andere in der Richtung. Und in Deutschland Polke und später dann Schütte.
Und Palermo?
Palermo sogar sehr.
Wie war das mit Gotthard Graubner oder Joseph Beuys?
Beuys war natürlich sehr beeindruckend, immer überraschend und interessant. Der konnte es so gut. Unglaublich war seine Fähigkeit, Leute zu bezaubern, richtig zu reagieren und der Mittelpunkt zu sein.
Hat man ihn primär als Künstler mit seinem Werk wahrgenommen oder war es mehr seine Persönlichkeit?
Wir haben ihn schon auch kritisch gesehen. Auch die Werke. Es gibt natürlich einige, die ich ganz großartig finde, wie „Das Ende des 20. Jahrhunderts“ ![]() Joseph Beuys, „Das Ende des 20. Jahrhunderts“, 1983.
Joseph Beuys, „Das Ende des 20. Jahrhunderts“, 1983. 
![]() Joseph Beuys, „Honigpumpe am Arbeitsplatz“, 1977.
Joseph Beuys, „Honigpumpe am Arbeitsplatz“, 1977. 
![]() 1972 installierte Joseph Beuys das Büro der „Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung“ als Beitrag auf der „documenta 5“. Wie bei anderen Aktionen zuvor verwendete Beuys Staffeleien mit Tafeln, auf denen er seine Erklärungen, Argumente oder Ideen manifestierte. , beschriftet mit direkter Demokratie, das war doch nur verblüffend.
1972 installierte Joseph Beuys das Büro der „Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung“ als Beitrag auf der „documenta 5“. Wie bei anderen Aktionen zuvor verwendete Beuys Staffeleien mit Tafeln, auf denen er seine Erklärungen, Argumente oder Ideen manifestierte. , beschriftet mit direkter Demokratie, das war doch nur verblüffend.
Das ist als Skulptur für Sie nicht interessant?
Es war oft zu abhängig von seiner Anwesenheit. Wenn er dann nicht mehr daneben agiert – was bleibt übrig?
Das ist die Frage: Ist das Dokumentation oder ist das Skulptur oder …
… vielleicht Kulisse, die ja sehr schön sein kann.
Sie hätten die Dinge aus dem Möbelhaus Berges auch aufheben können.
Ja. Das liegt mir einfach nicht, daran hat auch Fischer nicht gedacht.
Um noch einmal auf die Gruppe zurückzukommen – gab es da eine starke Konkurrenz? Michael Werner sagt: „Gerhard Richter war schon immer der Erfolgreichste!“
Das habe ich übrigens nie so wahrgenommen. Wahrscheinlich, um mich zu schützen. Ich habe allerdings gestaunt, als ich jetzt, nach über 50 Jahren, in Dresden war und das alte Atelier wiedersah, das ich an der Akademie für mich hatte. Da wurde mir eigentlich erst klar, wie erfolgreich ich da schon war.
Schon zu Ostzeiten.
Ja, zu Ostzeiten, in der SBZ. Sonst hätte ich keine Aspirantur bekommen, nicht das Atelier bekommen und nicht die Aufträge. Ich sah jetzt auch das SED-Parteihaus wieder, wo ich mal so ein Guttuso-Abklatsch-Bild gemacht habe.
Sie hatten in zwei sehr unterschiedlichen Gesellschaften gleichermaßen Erfolg.
Ja! So sieht es aus. Cornelius Tittel von der „Welt“ sagte mir mal: „Wissen Sie eigentlich, dass Sie auch oft gehasst werden?“ Sage ich: „Schwer zu glauben, die sind alle nett zu mir.“
Sind alle nett zu Ihnen?
Ja. Ich bin ja auch nett.
Mit Georg Baselitz gab es jedoch 1981 bei der Eröffnung Ihrer gemeinsamen Ausstellung ![]() „Georg Baselitz, Gerhard Richter“, Städtische Kunsthalle Düsseldorf, 30. Mai – 05. Juli 1981. in Düsseldorf eine heftige Auseinandersetzung?
„Georg Baselitz, Gerhard Richter“, Städtische Kunsthalle Düsseldorf, 30. Mai – 05. Juli 1981. in Düsseldorf eine heftige Auseinandersetzung?
In Düsseldorf? Ach, in der Bar dann …
Was ist in der Bar passiert?
Ich weiß nur, dass die Frau von Baselitz sagte: „Georg, wir gehen! Das ist nichts für uns.“ Die sind dann aufgestanden. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Ich glaube, es ging um Lüpertz, das könnte sein, dass es um Lüpertz ging, den ich da kritisierte.
Sie fanden Lüpertz nicht gut? Warum?
Nein, das sagt mir gar nicht zu.
Die Malerei?
Ja, und auch seine Skulpturen.
Wie kam es überhaupt zu dieser Ausstellung?
Durch Jürgen Harten ![]() Jürgen Harten (* 1933 Hamburg) war von 1972 bis 1998 Direktor der Kunsthalle Düsseldorf. Dort organisierte er viel beachtete Ausstellungen internationaler Gegenwartskunst, unter anderem von Marcel Broodthaers (1972), Sigmar Polke (1976), Anselm Kiefer (1984) und Gerhard Richter (1986). Ab 1998 war Harten in der Düsseldorfer Stiftung Museum Kunstpalast als Gründungsdirektor an der Planung des im Jahr 2001 eröffneten Museums beteiligt. . Im Nachhinein gesehen, war es keine gute Idee. Nicht, dass ich den Baselitz so schlecht finde. Er war schon ein interessanter Typ.
Jürgen Harten (* 1933 Hamburg) war von 1972 bis 1998 Direktor der Kunsthalle Düsseldorf. Dort organisierte er viel beachtete Ausstellungen internationaler Gegenwartskunst, unter anderem von Marcel Broodthaers (1972), Sigmar Polke (1976), Anselm Kiefer (1984) und Gerhard Richter (1986). Ab 1998 war Harten in der Düsseldorfer Stiftung Museum Kunstpalast als Gründungsdirektor an der Planung des im Jahr 2001 eröffneten Museums beteiligt. . Im Nachhinein gesehen, war es keine gute Idee. Nicht, dass ich den Baselitz so schlecht finde. Er war schon ein interessanter Typ.
Und die Malerei?
Die meine ich, die fand ich ganz interessant. Aber unsere Ausstellung wirkte wie ein Zweikampf. So stand es dann auch in der Zeitung.
Es war ja von Vornherein eine merkwürdige …
… Kombination, ja.
Also auch als Zweikampf inszeniert. Es war ja eigentlich auch damals allen klar, dass Sie sehr unterschiedliche Positionen hatten.
Ja!
Haben Sie die Ausstellung damals zusammen aufgebaut?
Jürgen Harten hat die Räume verteilt: „Du machst das, du das.“
Es waren getrennte Räume?
Ich glaube ja.
Jeder hatte seinen Bereich? Es hat da keine Gegenüberstellungen gegeben?
Doch, die gab es wohl auch.
Als Michael Werner 1968 mit seiner Galerie nach Köln kam, kaufte er, wie er selbst sagt, Polke im Handel, weil er den direkten Kontakt zu den Künstlern, also zu Ihnen, nicht herstellen konnte. Warum gab es da solche Spannungen?
Wir waren doch zwei konkurrierende Gruppierungen, extrem gegensätzlich. Selbst im Verhalten konnte man das sehen. Die waren sehr viel selbstsicherer als wir. Vor allem Lüpertz und Baselitz – und Werner natürlich auch. Bei aller Schnoddrigkeit, die wir aufsetzten, waren wir doch sehr unsicher. Das hatte auch mit dem politischen Klima zu tun, mit Relevanz und mit „Hört-auf-zu-malen“-Parolen, die nicht nur mir sehr zusetzten.
Dennoch waren Sie in der ersten Ausstellung von Michael Werner in Köln mit Werken vertreten. ![]() „Accrochage“, Eröffnungsausstellung der Galerie Michael Werner in Köln, 08.–21. Oktober 1969. In der Ausstellung vertreten waren unter anderen Georg Baselitz, Joseph Beuys, Markus Lüpertz, Heinz Mack, Gerhard Richter, Otto Piene, Sigmar Polke, Dieter Roth und Andy Warhol.
„Accrochage“, Eröffnungsausstellung der Galerie Michael Werner in Köln, 08.–21. Oktober 1969. In der Ausstellung vertreten waren unter anderen Georg Baselitz, Joseph Beuys, Markus Lüpertz, Heinz Mack, Gerhard Richter, Otto Piene, Sigmar Polke, Dieter Roth und Andy Warhol.
Mag sein. Vielleicht war das ganz am Anfang, aber ganz sicher habe ich ihm nie ein richtiges Bild gegeben.
Haben Sie später je mit Michael Werner zusammengearbeitet?
Nie. Es gab einmal einen Versuch, als er mit Mary Boone liiert war. Da besuchte sie mich, weil sie mich in ihrer New Yorker Galerie zeigen wollte. Sie sagte: „We offer you a limousine, the best hotel …“ Das war’s dann aber auch.
Das hat Sie nicht beeindruckt?
Im Gegenteil.
Kurz vor der Eröffnung der „documenta 6“ ![]() Die „documenta 6“ fand vom 24. Juni bis 02. Oktober 1977 unter der künstlerischen Leitung von Manfred Schneckenburger statt. Erstmals waren auch Künstler aus der DDR vertreten. haben Baselitz und Lüpertz ihren Beitrag aus Solidarität mit A.R. Penck zurückgezogen. Warum haben Sie Ihre Bilder abgehängt?
Die „documenta 6“ fand vom 24. Juni bis 02. Oktober 1977 unter der künstlerischen Leitung von Manfred Schneckenburger statt. Erstmals waren auch Künstler aus der DDR vertreten. haben Baselitz und Lüpertz ihren Beitrag aus Solidarität mit A.R. Penck zurückgezogen. Warum haben Sie Ihre Bilder abgehängt?
Das hatte mit der Sache gar nichts zu tun, ich weiß schon nicht mehr, um was es überhaupt ging.
Die documenta-Leitung beziehungsweise die Kuratoren Evelyn Weiss und Klaus Honnef haben die Werke von A.R. Penck – angeblich aus Platzgründen – nicht zeigen wollen, obwohl Penck offiziell eingeladen war. Michael Werner hat daraufhin seinen Künstlern, unter anderen eben Baselitz und Lüpertz, angetragen, ihren Beitrag komplett zurückzuziehen, und es heißt, Sie hätten dann auch mitgemacht.
Ich habe meinen Beitrag aus ganz anderen Gründen zurückgezogen: Die Bilder hingen ganz ungünstig neben Frank Stella, sodass ich sagte: „So geht es nicht, meine Bilder müssen abgehängt werden.“ Später hieß es dann, ich hätte das wegen der DDR-Kunst, die da erstmalig gezeigt wurde, gemacht. Das stimmte genauso wenig.
Das hatte mit Michael Werner und Penck also gar nichts zu tun?
Gar nichts. Es war ein richtiger Streit.
Mit wem haben Sie da gestritten?
Mit Klaus Honnef? Kann das sein?
Ja.
Also ich verweigerte diese Platzierung und sagte Hasenkamp, der Kunstspedition, dass sie meine Bilder wieder einpacken sollen. Eigentlich geht so was gar nicht, vertraglich. Aber die haben es so gemacht.
Penck war damals noch im Osten. Zu dem hatten Sie keinen Kontakt?
Nicht gleich. Später traf ich ihn manchmal in Köln. Der war in Ordnung.
Hatten Sie zu anderen Künstlern in der DDR Kontakt, nachdem Sie in den Westen übergesiedelt waren?
Aber ja, ein bisschen … Längere Zeit mit Wieland Förster, einem Bildhauer, und dann vor allem mit Helmut Heinze. Mit ihm heute noch.
Das lief dann über Briefkontakt?
Briefkontakt, und seitdem die Mauer weg ist …
… kann man sich ja auch besuchen. Sie durften damals nicht in den Osten, oder? Sie galten als Flüchtling?
Ja, mit C-Schein ![]() „C-Schein“ war der umgangssprachliche Ausdruck für den offiziellen „Reiseausweis Flüchtlingsgruppe C“, den die Bundesrepublik Deutschland ab 1953 an Flüchtlinge aus der Sowjetzone erteilte. Er war das am häufigsten vergebene Statusdokument für politische Flüchtlinge aus der DDR. .
„C-Schein“ war der umgangssprachliche Ausdruck für den offiziellen „Reiseausweis Flüchtlingsgruppe C“, den die Bundesrepublik Deutschland ab 1953 an Flüchtlinge aus der Sowjetzone erteilte. Er war das am häufigsten vergebene Statusdokument für politische Flüchtlinge aus der DDR. .
Wann waren Sie das erste Mal in Berlin?
Anfang der 50er-Jahre ging das noch gut, nach West-Berlin zu fahren, es gab ja da noch keine Mauer. Da sind wir ins Kino gegangen und haben viele Ausstellungen gesehen.
1964 hatten Sie die erste Ausstellung bei René Block. Sind Sie zu den Eröffnungen nach Berlin gefahren?
Doch, doch. Da wurde das aufgebaut und aufgehängt.
René Block hatte damals innerhalb des Kunstbetriebs eine sehr spezielle Position …
Ja, das hat uns auch gefallen. Das hatte so etwas Unkommerzielles, es steckte Engagement dahinter und eine Meinung. Der wollte was!
Es gibt ein schönes Zitat von Ihnen aus den 70er-Jahren: „Es gab eine Zeit, so 1962–1967, als sehr viele Leute von Kunst fasziniert waren, in die Ateliers kamen und staunten und sich selbst was vormachten. Ich glaube, die sind inzwischen alle enttäuscht, weil die Sensation nicht anhielt. Das ist auch ganz gut so; es ist ja auch wirklich nichts Staunenswertes daran, wenn jemand Nägel in ein Brett klopft (ich hatte damals mein Atelier neben Uecker) oder wenn jemand Familienfotos in Öl malt.“ ![]() Gerhard Richter, „Interview mit Gislind Nabakowski“, in: Dietmar Elger/Hans Ulrich Obrist (Hg.), „Gerhard Richter. Text 1961 bis 2007. Schriften, Interviews, Briefe“, Köln 2008, S. 85–90, hier S. 90.
Gerhard Richter, „Interview mit Gislind Nabakowski“, in: Dietmar Elger/Hans Ulrich Obrist (Hg.), „Gerhard Richter. Text 1961 bis 2007. Schriften, Interviews, Briefe“, Köln 2008, S. 85–90, hier S. 90.
Ja, so in Richtung Aberglaube war das wohl gemeint.
Oder eine Modeerscheinung?
Ja, bloß dass die immer noch anhält und immer mehr Erfolg hat. Eine neue Freiheit hat sich da durchgesetzt, die alten Kriterien für Gut und Schlecht gelten nicht mehr. Dazu gehört auch der Abbau der „Schwellenangst“, was zur Folge hat, dass man im Louvre kein Bild mehr in Ruhe betrachten kann.
Warhol hat darauf abgezielt!
Ja! Und seine Produkte sind auch oft entsprechend.
In den Anfängen gefielen Ihnen die Werke von Warhol aber ganz gut, oder?
Ja! Es gibt auch sehr gute Bilder von ihm.
Wo haben Sie Pop-Art zum ersten Mal gesehen?
Als ich nach Düsseldorf kam, in Kunstzeitschriften. Konrad Fischer war der Erste, der mit der „Art in America“ ![]() „Art in America“ ist ein monatlich erscheinendes Magazin für zeitgenössische Kunst, das 1913 von Frederic Fairchild Sherman und Wilhelm R. Valentiner in New York gegründet wurde. kam und sagte: „Guck mal da!“ Ich dachte: „Das geht aber zu weit.“ Da war so ein Küchenherd abgebildet, in Comic-Manier gemalt. Aber bald ist man doch beeindruckt, sieht weitere Bilder und findet das schon sehr gut. Später dann lässt das leider wieder nach. Also wenn ich diese typische Pop-Art sehe, auch hier in Köln, wirkt das doch ziemlich verstaubt.
„Art in America“ ist ein monatlich erscheinendes Magazin für zeitgenössische Kunst, das 1913 von Frederic Fairchild Sherman und Wilhelm R. Valentiner in New York gegründet wurde. kam und sagte: „Guck mal da!“ Ich dachte: „Das geht aber zu weit.“ Da war so ein Küchenherd abgebildet, in Comic-Manier gemalt. Aber bald ist man doch beeindruckt, sieht weitere Bilder und findet das schon sehr gut. Später dann lässt das leider wieder nach. Also wenn ich diese typische Pop-Art sehe, auch hier in Köln, wirkt das doch ziemlich verstaubt.
Finden Sie?
Ja! Ich war jetzt in Amsterdam. Ein wunderbares Museum, das Stedelijk. Aber was da hängt, strahlt so eine Arroganz aus, so viele Werke sind völlig nichtssagend. Selbst Sol LeWitt, den ich sehr schätze, ist dort mit einer sehr großen, aber sehr dummen Wandmalerei vertreten.
Sie sind zusammen mit Palermo 1970 nach New York gereist?
Ja.
Was haben Sie dort gemacht?
Ja, New York angesehen – und Ausstellungen, so viel wie möglich. Und auch ein paar Künstler besucht, Malcolm Morlay, Robert Ryman … James Rosenquist hat uns zum Essen eingeladen, mit offenem Verdeck fuhr er uns zu einem Restaurant. Oben in einem dieser Türme, das war schon sehr imponierend. Er hatte so eine lockere Art; die Deutschen wirkten ja eher verklemmt, dagegen. Als ich Rosenquist dann mal in Köln wiedersah – er hatte da eine Ausstellung bei Ricke – und ich ihn fragte: „Wie geht’s?“, sagte er: „Great, I made some money!“ Da war ich fast etwas erschrocken. Man stellt doch nicht aus, um Geld zu verdienen!
Nein, natürlich nicht!
Natürlich nicht. Aber ich fand es wohltuend ehrlich.
Ryman kannten Sie schon aus Deutschland?
Die Bilder kannte ich auf jeden Fall, ob ihn selbst, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Sie wollten aber nie in den USA leben?
Nein, ich bin zu wenig Abenteurer, und mein Englisch ist zu schlecht.
Das kann man ja lernen. Die Pop-Art hatte es Ihnen aber auch nicht so angetan?
Die Minimal Art hat mich mehr beeindruckt, die hat mich richtig ins Herz getroffen, sozusagen. Carl Andre, Sol LeWitt und Dan Flavin und was es da so alles gab.
Diese Künstler hat auch Heiner Friedrich für sich und seine Galerie entdeckt.
Ja, ich kenne sie aber mehr durch Konrad Fischer, da bin ich erst richtig in die Minimal Art eingestiegen. Das fand ich sehr großartig.
Fischer sagte in einem Interview: „Einmal im Jahr verkrache ich mich richtig mit Gerhard Richter.“ Wo hat es dann gekracht?
Das weiß ich nicht. Ich habe mich schnell verkracht mit Leuten. Mit Buchloh habe ich mal über ein Jahr nicht geredet.
Ging es da hauptsächlich um Ihre Arbeiten?
Eher um Meinungen über dies und jenes.
Streiten Sie gerne?
Eigentlich nicht, Harmonie ist mir viel lieber. Aber ein Streit kann schon sehr nützlich sein.
1966 fand bei Schmela – ihm zu Ehren – „Kaffee und Kuchen“ statt. Da gab es eine Woche lang Programm. ![]() „Kaffee und Kuchen“ war Teil der Ausstellungsserie „Hommage à Schmela“, in der vom 09. bis 15. Dezember 1966 sieben jeweils eintägige Einzelausstellungen in der Galerie Schmela präsentiert wurden. Neben Gerhard Richter beteiligten sich Joseph Beuys, John Latham, Konrad Lueg, Heinz Mack, Otto Piene und Sigmar Polke an dieser Aktion.
„Kaffee und Kuchen“ war Teil der Ausstellungsserie „Hommage à Schmela“, in der vom 09. bis 15. Dezember 1966 sieben jeweils eintägige Einzelausstellungen in der Galerie Schmela präsentiert wurden. Neben Gerhard Richter beteiligten sich Joseph Beuys, John Latham, Konrad Lueg, Heinz Mack, Otto Piene und Sigmar Polke an dieser Aktion.
Ah ja, seine Künstler haben ihn geehrt. Ich stellte wohl Fotos und eine Fahne aus, die Volker Bradtke zeigten. Schmela war schon eine Instanz, ein guter Typ. Und außerdem ein guter Händler: Er besuchte mich einmal mit einem Sammler. Schmela wies auf ein Bild hin, das er besonders gut fand. Als dem Sammler aber ein anderes besser gefiel, sagte er sofort, dass dieses natürlich das Beste sei. Er war beeindruckend.
Das ist auch Zwirners Erklärung, warum er kein Galerist sein wollte. Denn als Galerist kann man in der eigenen Galerie nicht sagen: „Das Bild ist besser als das!“
Der Konrad Fischer hat das gemacht, der hat abgeraten: „Das da brauchen Sie nicht zu kaufen, das Bild ist nichts.“ So was hat der gemacht, das hat mir sehr imponiert.
Hat er dadurch schlechter verkauft als andere Galeristen?
Ich glaube nicht.
Es ist natürlich sehr authentisch.
Ja. Man fühlt sich ernst genommen.
Und Heiner Friedrich, hat der gut verkauft?
Denke ich, ja. Der war ein richtiger Machtmensch. Allein so eine Aktion wie „Munich Depression“ ![]() „Michael Heizer. Vague Depression/Munich Depression“, Galerie Heiner Friedrich, München, 15. April – 03. Mai 1969. von Heizer oder „Lightning Field“
„Michael Heizer. Vague Depression/Munich Depression“, Galerie Heiner Friedrich, München, 15. April – 03. Mai 1969. von Heizer oder „Lightning Field“ ![]() Walter De Maria, „The Lightning Field“, 1977.
Walter De Maria, „The Lightning Field“, 1977. 
![]() „Walter De Maria: Dirt Show/The Land Show. Pure Dirt, Pure Earth, Pure Land“, Galerie Heiner Friedrich, München, 28. September – 10. Oktober 1968.
„Walter De Maria: Dirt Show/The Land Show. Pure Dirt, Pure Earth, Pure Land“, Galerie Heiner Friedrich, München, 28. September – 10. Oktober 1968.  von Walter De Maria, die Projekte mit Donald Judd – und dann die Dia Art Foundation: Dazu gehören schon ein ganz außergewöhnlicher Wille und die notwendige Überzeugungsgabe.
von Walter De Maria, die Projekte mit Donald Judd – und dann die Dia Art Foundation: Dazu gehören schon ein ganz außergewöhnlicher Wille und die notwendige Überzeugungsgabe.
Aber es steckt dahinter auch eine große Leidenschaft. Er hat ja wirklich Position bezogen.
Ja, großartig. Und das war der Unterschied zu Schmela oder Fischer, die hatten nicht diese Ambition zum Überdimensionalen, die hatten nur ihre kleine Galerie.
Er sucht und findet permanente Orte für die Kunst. Große Installationen können ja in den Museen häufig allein aus Platzgründen nicht dauerhaft präsentiert werden.
Ja. Das erlebe ich gerade: Das Guggenheim besitzt acht graue Bilder, Glasbilder, die sehr hoch sind, je fünf Meter, und ich bedauere schon, dass diese Serie nach zwei Ausstellungen eingelagert ist. Seit über zehn Jahren. Deshalb versuche ich gerade, für diese Arbeit einen besseren Ort zu finden, eine Art Chapel wäre ideal.
Dafür, solche Erlebnisräume beziehungsweise Begegnungen mit der Kunst möglich zu machen, engagiert sich Heiner Friedrich.
Ja, das ist schon sehr gut.
Erst wurden die Werke aus den Kirchen entfernt und ins Museum überführt, jetzt gehen die Werke zurück in die Kirchen, weil wir die Kirchen nicht mehr brauchen.
Darüber schrieb auch Ellsworth Kelly, der gerade so eine Kapelle baut. ![]() Im Frühjahr 2015 überreichte Ellsworth Kelly dem Blanton Museum of Art in Austin, Texas, das Konzept für den Bau einer Kapelle auf dem Grundstück des Museums. Zum aktuellen Stand des Projekts siehe auch: „Ellsworth Kelly: Austin“, unter: http://blantonmuseum.org/collection/ellsworth-kellys-austin/ (eingesehen am 07.03.2017).
Im Frühjahr 2015 überreichte Ellsworth Kelly dem Blanton Museum of Art in Austin, Texas, das Konzept für den Bau einer Kapelle auf dem Grundstück des Museums. Zum aktuellen Stand des Projekts siehe auch: „Ellsworth Kelly: Austin“, unter: http://blantonmuseum.org/collection/ellsworth-kellys-austin/ (eingesehen am 07.03.2017).
Für sein Werk macht es Sinn!
Ja, hat mir auch gefallen! In Japan mache ich das jetzt, im kleineren Format auf einer Insel, Toyoshima. Dort wird ein Raum für 14 stehende Scheiben gebaut. Sonst nichts.
Das ist wunderbar, nur ist es viel zu weit weg.
Für manche Japaner nicht.
Insofern ist doch das Engagement von Heiner Friedrich, Kunst dauerhaft und nicht nur temporär zugänglich zu machen, sehr wichtig.
Da haben Sie sehr recht, ja.
Und auch Franz Dahlem macht sich für einzelne Positionen sehr stark. Das ist eine Haltung, die beeindruckend ist. Waren Friedrich und Dahlem damals ein richtiges Gespann?
Die Galerie hieß ja Friedrich & Dahlem. Friedrich war aber der Wichtigere.
1967 fand in Köln der erste Kunstmarkt statt. Heiner Friedrich war mit seiner Galerie nicht zugelassen und hat dann eine „Demonstrative“ ![]() Die von Heiner Friedrich initiierte „Demonstrative“ fand vom 12. bis 19. September 1967 im DuMont-Verlagshaus in Köln statt. In der Ausstellung vertretene Künstler waren John Hoyland, Konrad Lueg, Blinky Palermo, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Reiner Ruthenbeck und Cy Twombly. veranstaltet.
Die von Heiner Friedrich initiierte „Demonstrative“ fand vom 12. bis 19. September 1967 im DuMont-Verlagshaus in Köln statt. In der Ausstellung vertretene Künstler waren John Hoyland, Konrad Lueg, Blinky Palermo, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Reiner Ruthenbeck und Cy Twombly. veranstaltet.
Ah ja, da haben wir eine Ausstellung bei DuMont gemacht. Das war ziemlich gut.
Rudolf Zwirner hat den Kunstmarkt mitgegründet und organisiert. Warum war Friedrich nicht zugelassen?
Wie bei jeder Sache gibt’s ein Gremium, das bestimmt: Wer ist dabei? Friedrich war noch zu jung, zu frech, was weiß ich. Es waren ja viele Galerien nicht dabei. Das war nichts Besonderes, bloß Heiner Friedrich war viel aktiver, der machte etwas daraus.
Und das haben Sie auch nicht als Außenseiterposition empfunden?
Überhaupt nicht.
Sie haben damals nicht gedacht: „Wäre ich doch lieber zu Zwirner gegangen“?
Um Gottes willen, nein. Zwirner war ja nett, aber er ist halt ein Händler.
1986 hat er, zusammen mit Barbara Gladstone, Ihre Werke in New York ausgestellt. ![]() „Gerhard Richter. Paintings 1964–1974“, Barbara Gladstone Gallery/Rudolf Zwirner Gallery, New York, 13. Dezember 1986 – 17. Januar 1987. Angeblich wurde nichts verkauft. Viele sind der Meinung, die Malergeneration, die Ihnen nachfolgte, das heißt Ihre Schüler – wie Milan Kunc, Jan Knap, Volker Tannert –, aber eben auch die Maler von der Galerie am Moritzplatz
„Gerhard Richter. Paintings 1964–1974“, Barbara Gladstone Gallery/Rudolf Zwirner Gallery, New York, 13. Dezember 1986 – 17. Januar 1987. Angeblich wurde nichts verkauft. Viele sind der Meinung, die Malergeneration, die Ihnen nachfolgte, das heißt Ihre Schüler – wie Milan Kunc, Jan Knap, Volker Tannert –, aber eben auch die Maler von der Galerie am Moritzplatz ![]() Die Galerie am Moritzplatz eröffnete im Mai 1977 in Berlin-Kreuzberg mit einer Ausstellung des Künstlers Salomé. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten die Künstler Rainer Fetting, Helmut Middendorf, Salomé und Bernd Zimmer. In Gruppen- oder Einzelausstellungen der Mitglieder und ihrer Gäste stellten die jungen Maler ihre neuesten Arbeiten in der Hinterhofgalerie aus. Mit ihren radikal provokanten, figurativen Bildern zogen sie schnell Aufmerksamkeit auf sich, sodass sie auf die selbst organisierten Ausstellungen nicht mehr angewiesen waren. Die Künstler der Galerie am Moritzplatz schafften innerhalb weniger Jahre den Sprung vom Akademieschüler zum international anerkannten Künstler. Siehe auch: Franziska Leuthäußer, „Berlin“, in: „Die 80er. Figurative Malerei in der BRD“, hg. von Martin Engler, Ausst.-Kat. Städel Museum, Frankfurt am Main, Ostfildern 2015, S. 28–34, hier S. 28 ff. in Berlin und die Künstler der Mülheimer Freiheit
Die Galerie am Moritzplatz eröffnete im Mai 1977 in Berlin-Kreuzberg mit einer Ausstellung des Künstlers Salomé. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten die Künstler Rainer Fetting, Helmut Middendorf, Salomé und Bernd Zimmer. In Gruppen- oder Einzelausstellungen der Mitglieder und ihrer Gäste stellten die jungen Maler ihre neuesten Arbeiten in der Hinterhofgalerie aus. Mit ihren radikal provokanten, figurativen Bildern zogen sie schnell Aufmerksamkeit auf sich, sodass sie auf die selbst organisierten Ausstellungen nicht mehr angewiesen waren. Die Künstler der Galerie am Moritzplatz schafften innerhalb weniger Jahre den Sprung vom Akademieschüler zum international anerkannten Künstler. Siehe auch: Franziska Leuthäußer, „Berlin“, in: „Die 80er. Figurative Malerei in der BRD“, hg. von Martin Engler, Ausst.-Kat. Städel Museum, Frankfurt am Main, Ostfildern 2015, S. 28–34, hier S. 28 ff. in Berlin und die Künstler der Mülheimer Freiheit ![]() Die Kölner Künstler Hans Peter Adamski, Peter Bömmels, Walter Dahn, Jiří Georg Dokoupil, Gerard Kever und Gerhard Naschberger zogen im Oktober 1980 gemeinsam in ein Atelier in der Mülheimer Freiheit 110 in Köln-Deutz. Der Name „Mülheimer Freiheit“ fand erstmals Verwendung anlässlich der Gruppenausstellung „Mülheimer Freiheit & Interessante Bilder aus Deutschland“, die vom 13. November bis 20. Dezember 1980 in der Galerie Paul Maenz in Köln stattfand. hätten durch ihren plötzlichen, durchschlagenden internationalen Erfolg letztendlich auch Ihrer Generation den Weg zum Kunstmarkt geebnet. Zwirner dagegen sieht vor allem in der Ausstellung Anselm Kiefers 1984 im Israel Museum in Jerusalem den Befreiungsschlag für die deutsche Kunst im Ausland.
Die Kölner Künstler Hans Peter Adamski, Peter Bömmels, Walter Dahn, Jiří Georg Dokoupil, Gerard Kever und Gerhard Naschberger zogen im Oktober 1980 gemeinsam in ein Atelier in der Mülheimer Freiheit 110 in Köln-Deutz. Der Name „Mülheimer Freiheit“ fand erstmals Verwendung anlässlich der Gruppenausstellung „Mülheimer Freiheit & Interessante Bilder aus Deutschland“, die vom 13. November bis 20. Dezember 1980 in der Galerie Paul Maenz in Köln stattfand. hätten durch ihren plötzlichen, durchschlagenden internationalen Erfolg letztendlich auch Ihrer Generation den Weg zum Kunstmarkt geebnet. Zwirner dagegen sieht vor allem in der Ausstellung Anselm Kiefers 1984 im Israel Museum in Jerusalem den Befreiungsschlag für die deutsche Kunst im Ausland.
Erinnern Sie sich daran? Gab es einen Zeitpunkt, einen Auslöser, der das Interesse an Ihren Werken auf internationaler Ebene deutlich verändert hat? War das eine Bewegung?
Nein, eigentlich nicht. Als Schlüssel sah ich eher die „von hier aus“-Ausstellung ![]() „von hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf“, Halle 13 der Messe Düsseldorf, 29. September – 02. Dezember 1984. . Da hatte ich das Gefühl: „Jetzt bist du angenommen und hast einen gewissen Ruf.“ So schien es mir.
„von hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf“, Halle 13 der Messe Düsseldorf, 29. September – 02. Dezember 1984. . Da hatte ich das Gefühl: „Jetzt bist du angenommen und hast einen gewissen Ruf.“ So schien es mir.
Die Ausstellung hat Kasper König gemacht.
Ja. Die war sehr gut und wichtig.
In der Ausstellung waren auch die jüngeren Maler vertreten: Salomé, Fetting, die Mülheimer Freiheit …
… aber nicht im selben Raum wie ich.
Nein, aber die waren in der Ausstellung. Haben Sie sich für die Malerei der Jüngeren interessiert?
Ja doch, natürlich. Aber ich mochte die ganze Richtung nicht.
1982 erschien das Buch „Hunger nach Bildern“ ![]() Wolfgang Max Faust/Gerd de Vries, „Hunger nach Bildern. Deutsche Malerei der Gegenwart“, Köln 1982. von Gerd de Vries und Wolfgang Max Faust.
Wolfgang Max Faust/Gerd de Vries, „Hunger nach Bildern. Deutsche Malerei der Gegenwart“, Köln 1982. von Gerd de Vries und Wolfgang Max Faust.
Ja. Den Hunger hat es schon gegeben, nach der minimalistischen Strenge und der unsinnlichen Concept-Art.
Gab es irgendeinen unter denen, Kippenberger, Oehlen, Dokoupil, irgendjemanden, dessen Malerei Sie gut fanden?
Das war mir zu viel Provokation. Mehr war es nicht. Das liegt mir gar nicht.
1972 schreiben Sie an Wulf Herzogenrath ![]() Wulf Herzogenrath (* 1944 Rathenow) ist ein Kunsthistoriker und Kurator. Von 1973 bis 1989 war er Direktor des Kölnischen Kunstvereins und organisierte 1976 die erste institutionelle Einzelausstellung des Künstlers Nam June Paik. Von 1989 bis 1994 betreute Herzogenrath als Hauptkustos den Aufbau des Hamburger Bahnhofs in Berlin und wurde 1994 Direktor der Kunsthalle in Bremen. Außerdem war er an der Organisation der „documenta 6“ (1977) und „documenta 8“ (1987) beteiligt. Er gilt als wichtiger Vermittler der Video- und Medienkunst in Deutschland. einen Brief in zwei Versionen. Der eine ist wie eine Wortcollage, die keinen Sinn ergibt. In dem zweiten Brief schreiben Sie: „Jetzt schicke ich Ihnen endlich ein Foto.“
Wulf Herzogenrath (* 1944 Rathenow) ist ein Kunsthistoriker und Kurator. Von 1973 bis 1989 war er Direktor des Kölnischen Kunstvereins und organisierte 1976 die erste institutionelle Einzelausstellung des Künstlers Nam June Paik. Von 1989 bis 1994 betreute Herzogenrath als Hauptkustos den Aufbau des Hamburger Bahnhofs in Berlin und wurde 1994 Direktor der Kunsthalle in Bremen. Außerdem war er an der Organisation der „documenta 6“ (1977) und „documenta 8“ (1987) beteiligt. Er gilt als wichtiger Vermittler der Video- und Medienkunst in Deutschland. einen Brief in zwei Versionen. Der eine ist wie eine Wortcollage, die keinen Sinn ergibt. In dem zweiten Brief schreiben Sie: „Jetzt schicke ich Ihnen endlich ein Foto.“ ![]() Die erste Version des Briefs wurde am 02. November 1972, die zweite Version am 22. Dezember 1972 verfasst. Vgl. Abdruck der Briefe, in: Dietmar Elger/Hans Ulrich Obrist (Hg.), „Gerhard Richter. Text 1961 bis 2007. Schriften, Interviews, Briefe“, Köln 2008, S. 68 f.
Die erste Version des Briefs wurde am 02. November 1972, die zweite Version am 22. Dezember 1972 verfasst. Vgl. Abdruck der Briefe, in: Dietmar Elger/Hans Ulrich Obrist (Hg.), „Gerhard Richter. Text 1961 bis 2007. Schriften, Interviews, Briefe“, Köln 2008, S. 68 f.
Ja. Und ich schickte, anstelle eines Fotos von mir, das Foto, das ich vom Pförtner der Akademie gemacht hatte. Ich hatte keine Lust, ein konventionelles Statement zu liefern. Dieser Pseudobrief ist doch auch in meinem Text-Buch ![]() Dietmar Elger/Hans Ulrich Obrist (Hg.), „Gerhard Richter. Text 1961 bis 2007. Schriften, Interviews, Briefe“, Köln 2008. abgedruckt.
Dietmar Elger/Hans Ulrich Obrist (Hg.), „Gerhard Richter. Text 1961 bis 2007. Schriften, Interviews, Briefe“, Köln 2008. abgedruckt.
Dieses Buch ist eine wunderbare Zusammenstellung.
Damals war es mir unbehaglich, ich habe danach auch nichts mehr geschrieben.
Nachdem das veröffentlicht wurde? Warum?
Es sah so gewichtig aus. Die Idee dazu hatte Hans Ulrich Obrist. Allein wäre ich nicht darauf gekommen.
Haben Sie es bereut?
Das nicht, ich hatte nur das Gefühl, dass es mir nicht zusteht.
Die individualisierte Gesellschaft tendiert dazu, unsere Wurzeln und die Bedeutung unserer Herkunft bisweilen zu ignorieren …
… und zu verdrängen. Daran dachte ich erst kürzlich, dass es mir damals gar nicht bewusst war, als ich als Deutscher – mit unserer Vergangenheit! – nach Holland, Frankreich und in andere Länder fuhr, um dort auszustellen. Das war nie ein Thema, und nie wurde ich darauf angesprochen.
Vielleicht kommt das erst ein paar Generationen später?
Das halte ich auch für möglich, ja. Auch Benjamin Buchloh hat das erst jetzt im Zusammenhang mit den „Birkenau“-Bildern ![]() Gerhard Richter, „Birkenau“ 1-4, 2014.
Gerhard Richter, „Birkenau“ 1-4, 2014. 


 eingehender thematisiert.
eingehender thematisiert. ![]() Vgl. Benjamin H. D. Buchloh, „Gerhard Richters Birkenau-Bilder“, Köln 2016.
Vgl. Benjamin H. D. Buchloh, „Gerhard Richters Birkenau-Bilder“, Köln 2016.
Sie haben sich jüngst mit Ihren „Birkenau“-Bildern dem Thema Holocaust erneut genähert. War das für Sie in den 1960er-Jahren ein Thema?
Ein Thema war das eigentlich immer. Aber erst mit größerem Abstand wurde die Auseinandersetzung damit besser und genauer. Für mich wurde das Thema wieder akut, als das Buch „Bilder trotz allem“ von Didi-Huberman erschien. Das brachte mich zu den vier „Birkenau“-Bildern, die Anfang nächsten Jahres in Baden-Baden gezeigt werden. Dort auch mit Katalog und Texten von Benjamin Buchloh und Helmut Friedel.
Zuletzt würde ich gerne noch mit Ihnen über die Ausstellung „Bilderstreit“ sprechen, die 1989 unter der Leitung von Siegfried Gohr und Johannes Gachnang in den Messehallen in Köln stattfand.
Ach ja. Gachnang und ich, wir hatten nie einen guten Kontakt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich in der Ausstellung dabei war.
Ja, Sie wollten eigentlich nicht. Das Ausstellungsrecht konnten Sie denen aber nicht verweigern, und so haben Sie angeblich entschieden, lieber selbst Bilder zu liefern, um die Auswahl zu bestimmen. ![]() Vgl. Stellungnahme zur Ausstellung „Bilderstreit“, 01.06.1989, abgedruckt in: Dietmar Elger/Hans Ulrich Obrist (Hg.), „Gerhard Richter. Text 1961 bis 2007. Schriften, Interviews, Briefe“, Köln 2008, S. 230.
Vgl. Stellungnahme zur Ausstellung „Bilderstreit“, 01.06.1989, abgedruckt in: Dietmar Elger/Hans Ulrich Obrist (Hg.), „Gerhard Richter. Text 1961 bis 2007. Schriften, Interviews, Briefe“, Köln 2008, S. 230.
Oh. Ich habe die Ausstellung nie gesehen und weiß auch nicht, was da gezeigt wurde. ![]() In der Ausstellung „Bilderstreit“, Rheinhallen, Köln, 1989, waren von Gerhard Richter ausgestellt: „Faltbarer Trockner“ (1962), „Schwimmerinnen“ (1965), „Grau“ (1970), „Grau“ (1973), „Grau“ (1974), „Grau“ (1974), „Geäst“ (1988), „Blau“ (1988), „Stand“ (1988) und „Lot“ (1988). Nur an eine andere Ausstellung kann ich mich erinnern – in der Royal Academy …
In der Ausstellung „Bilderstreit“, Rheinhallen, Köln, 1989, waren von Gerhard Richter ausgestellt: „Faltbarer Trockner“ (1962), „Schwimmerinnen“ (1965), „Grau“ (1970), „Grau“ (1973), „Grau“ (1974), „Grau“ (1974), „Geäst“ (1988), „Blau“ (1988), „Stand“ (1988) und „Lot“ (1988). Nur an eine andere Ausstellung kann ich mich erinnern – in der Royal Academy …
… das war „A New Spirit in Painting“ ![]() „A New Spirit in Painting“, Royal Academy of Arts, London, 15. Januar – 18. März 1981. , 1981.
„A New Spirit in Painting“, Royal Academy of Arts, London, 15. Januar – 18. März 1981. , 1981.
Ja, ich glaube von Rosenthal?
Ja, Norman Rosenthal, Christos Joachimides und Nicholas Serota.
Da zeigte ich die „Verkündigung nach Tizian“ ![]() Gerhard Richter, „Die Verkündigung nach Tizian“, 1973. . Später sagte Baselitz etwas abfällig: „Ach, von dir waren so graue Wolken da.“ Das war so typisch für unser Verhältnis. Wir haben uns nicht leiden können.
Gerhard Richter, „Die Verkündigung nach Tizian“, 1973. . Später sagte Baselitz etwas abfällig: „Ach, von dir waren so graue Wolken da.“ Das war so typisch für unser Verhältnis. Wir haben uns nicht leiden können.
Auch Walter Grasskamp hat einmal über Ihre Arbeiten geschrieben …
… und das war sicher ziemlich negativ.
Jedenfalls haben Sie sich sehr kritisch über seine Interpretationsansätze zu Ihrem Werk geäußert. ![]() Vgl. Gerhard Richter an Walter Grasskamp, 17.10.1989, abgedruckt in: Dietmar Elger/Hans Ulrich Obrist (Hg.), „Gerhard Richter. Text 1961 bis 2007. Schriften, Interviews, Briefe“, Köln 2008, S. 250–252. Dalí sagte einmal: „Ich messe den Erfolg der Zeitungsartikel am Gewicht. Das heißt an der Quantität, nicht an der Qualität.“ Haben Sie sich oft über die Kunstkritik geärgert?
Vgl. Gerhard Richter an Walter Grasskamp, 17.10.1989, abgedruckt in: Dietmar Elger/Hans Ulrich Obrist (Hg.), „Gerhard Richter. Text 1961 bis 2007. Schriften, Interviews, Briefe“, Köln 2008, S. 250–252. Dalí sagte einmal: „Ich messe den Erfolg der Zeitungsartikel am Gewicht. Das heißt an der Quantität, nicht an der Qualität.“ Haben Sie sich oft über die Kunstkritik geärgert?
Nicht anhaltend. Und der letzte Artikel war so blöd, dass ich mich nicht mal mehr geärgert hab.
Welcher war das?
Das war in der „art“, über die „Birkenau“-Bilder. ![]() Vgl. Wolfgang Ullrich, „Finde Bedeutung!“, in: „art“, 5, 2015, S. 130–133. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben, etwas zu entlarven. Der letzte Satz: „Damit entlarvt Richter sich selbst.“
Vgl. Wolfgang Ullrich, „Finde Bedeutung!“, in: „art“, 5, 2015, S. 130–133. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben, etwas zu entlarven. Der letzte Satz: „Damit entlarvt Richter sich selbst.“
Und dazu äußern Sie sich gar nicht mehr?
Nur gesprächsweise, so wie jetzt mit Ihnen.
Im Zusammenhang mit Ihrem Werk wird immer wieder die Beziehung der Malerei zur Fotografie thematisiert. Ihre Kommentare dazu in zahlreichen Interviews lassen erahnen, dass Sie diese Erklärungsansätze für die Rezeption Ihrer Malerei eigentlich für überflüssig oder vielleicht auch einfach für selbstverständlich halten.
Vielleicht hatte ich da nur die im Sinn, die ganz daneben sind. Denn eigentlich ist es ja notwendig, dass kommentiert und interpretiert wird. Ohne das geht es ja gar nicht.
Sind Ihre Werke erklärungsbedürftig?
Alle Werke sind das, das fängt doch schon mit dem Titel an.
Wobei man sagen könnte, die Titel gehören zum Werk. Sie sind ja gewissermaßen der literarische Zusatz, vom Künstler hinzugefügt.
Ja, und die Interpretation doch dann auch.
Die kommt ja nicht vom …
… doch, auch vom Künstler. Er redet doch auch über Bilder, urteilt über Gut und Schlecht wie jeder andere.
Das gehört ja nicht zum Werk, das ist die Rezeption des Werks.
Ja, und ich denke, die beginnt bei dem, der das Werk hergestellt hat, auch wenn sie völlig schiefliegt oder gar nicht artikuliert wird.
Ad Reinhardt hat diese Interpretationsansätze zur modernen Kunst nicht nur karikiert, sondern auch konstatiert: Der Kunst etwas hinzuzufügen, was sich über das Werk nicht mitteilt, wäre so, wie in der Zeitung zwischen den Zeilen nach etwas zu suchen, was nicht dasteht.
Genau das tut man aber, zwischen den Zeilen lesen, weil man sich etwas dabei denkt und damit den Text erst wirksam macht.