Köln, 05. März 2016
Franziska Leuthäußer: Ich bin begeistert, wie groß die Bereitschaft ist, mit uns über diese vergangene Zeit zu sprechen. Wir haben sehr wenige Absagen. Leider häufig von Frauen.
Jürgen Klauke: Frauen sind eben komplizierter.
Ist das so?
Ich weiß es nicht. Auffällig war, dass die Frauen einen selbstverständlicheren Zugang zu meinen frühen Arbeiten, die sich mit Sexualität, Eros und so weiter beschäftigten, hatten als die verklemmten Männer.
Obwohl es den Vorwurf, Sie seien frauenfeindlich gewesen, auch gab?
Ach, das ist lächerlich, dann wäre die ganze Szene frauenfeindlich oder männerfeindlich gewesen. Wir waren gut drauf, sowohl die Frauen als auch die Männer – jedenfalls da, wo ich mich herumtrieb. Als die Pille kam, wurde das Ganze noch entspannter, da nahmen die Frauen das Heft in die Hand und gruben uns an – ich habe das nicht als männerfeindlich empfunden.
Das war die Wirkung der Antibabypille?
Ja, sicher. Das war revolutionär. Absolut. Frauen wurden viel offener. Vorher hatten sie ja immer Angst, dass sie geschwängert würden.
Sie waren von 1964 bis 1970 hier in Köln an den Werkschulen. Ist das richtig?
Wenn Sie die Daten haben, seien Sie froh. Ich vergesse solche Dinge. Dass ich hier studiert habe, ist aber sicher.
Wann sind Sie nach Köln gekommen?
Ich bin ja aus dem Rheinland und bin für das Studium nach Köln gezogen. ![]() Von 1964 bis 1970 studierte Klauke Freie Grafik an der Fachhochschule für Kunst und Design in Köln bei Alfred Will. Vgl. Jochen Poetter (Hg.), „Jürgen Klauke. Sonntagsneurosen“, Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle Baden-Baden/Kunstmuseum Düsseldorf, Ostfildern 1992, S. 156. Ein Jahr lang bin ich gependelt. Das war über eine Stunde Zugfahrt. Da traf ich morgens schon Kollegen im Zug, die auch hier studierten.
Von 1964 bis 1970 studierte Klauke Freie Grafik an der Fachhochschule für Kunst und Design in Köln bei Alfred Will. Vgl. Jochen Poetter (Hg.), „Jürgen Klauke. Sonntagsneurosen“, Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle Baden-Baden/Kunstmuseum Düsseldorf, Ostfildern 1992, S. 156. Ein Jahr lang bin ich gependelt. Das war über eine Stunde Zugfahrt. Da traf ich morgens schon Kollegen im Zug, die auch hier studierten.
Ihre Wahl fiel auf Köln, weil es in der Nähe war?
Das hat sich aus dem bischöflichen Konvikt, in dem ich war, ergeben. Dort entwickelte ich die Idee, dass ich Kunst studieren wollte. Und so viele Möglichkeiten gab es nicht. In der Region gab es Düsseldorf, Köln und Mainz. Für die Hochschule hier in Köln musste man neben den künstlerischen Arbeiten ein Praktikum bei einem Grafiker oder Drucker vorweisen. Grafiker gab es damals nicht so viele und dann habe ich in einer Großdruckerei eine Kurzlehre gemacht. Ich habe noch Handsatz und Bleisatz gelernt – das war sehr lehrreich für mich. Noch währenddessen habe ich die Aufnahmeprüfung in Köln bestanden. In Koblenz, in der nächstgrößeren Stadt, habe ich am Wochenende einen Typografie-Kursus gemacht. Sodass ich weiß, wovon die Rede ist, wenn wir Kataloge machen.
Mit welchem Ziel sind Sie damals an die Werkschulen gegangen?
Es ging zwar auch darum, was ich wollte, es war aber vor allem ein verdecktes Studium meinen Eltern gegenüber. In der damaligen Zeit waren die wenigsten dafür, dass man Kunst studierte. Also habe ich denen gesagt, ich würde Gebrauchsgrafik studieren, was ich nie getan habe. Mein Ziel war die freie Kunst. Ich wollte einer von denen werden, über die ich gelesen und von denen ich gesehen hatte.
Wer war das?
Das, was man um diese Uhrzeit am humanistischen Gymnasium geboten bekam. Ich hatte einen Kunsterzieher, der gerochen hatte, dass ich ein bisschen begabt war, und der brachte mir Verschiedenes mit, sodass ich dann auch Picasso, Monet, Paul Klee, Matisse und andere Künstler kennenlernte. Damals war Picasso ja fast ein Schimpfwort. In der bürgerlichen Wahrnehmung stand er für das Unverständliche. Ich habe mir natürlich auch Literatur besorgt, die mich interessierte. Das war zum Beispiel Freud, Henry Miller oder François Villon und so weiter. Man stöberte überall herum und stieß sehr früh auf Dinge, die ich heute mit „Ästhetisierung des Existenziellen“ beschreibe. Das hat mich schon in der Jugend am meisten interessiert und bewegt.
Das heißt, Ihre Motivation Kunst zu studieren, war eigentlich eher das Bild, das Sie von dem Leben eines Künstlers hatten?
Ja, das war natürlich das romantische Künstlerbild. Der Künstler, das Toxische, die schönen Frauen und so weiter. Das verlockt einen Jüngling natürlich auch. Aber ich hatte in diesem Internat oder Konvikt, in dieser Langeweile und sich dehnenden Zeit auch die Zeit mir Gedanken zu machen, was ich alles nicht machen wollte. Und da blieb die Kunst im Mittelpunkt meines Interesses übrig.
Köln war nach dem Internat wahrscheinlich Ihre erste Station, weg von zu Hause?
Nein, ich war als Schüler schon im deutsch-französischen Jugendaustausch in Frankreich als Wiederannäherung nach dem furchtbaren Krieg, und das ausgerechnet in Dünkirchen, einer Stadt, die deutschen Bomben zum Opfer gefallen war. – Köln war ein Befreiungsschlag der anderen Art und den habe ich sehr genossen. Ich bin nach längerer Wohnungssuche in eine große Halle eingezogen. Das heißt, ich habe nie in meinem Leben in einer Wohnung gewohnt, sondern immer in Hallen. Ich habe mir diese Nachkriegshalle, die keine Fensterscheiben hatte, selbst zurechtgemacht. Dafür habe ich monatlich 150 D-Mark bezahlt, 250 Quadratmeter im Hinterhof, in der Südstadt. Damals war Aufbruchsstimmung. Man sollte auch nicht vergessen: Durch den Rock ’n’ Roll hatten wir Fahrt aufgenommen und wurden noch renitenter – ich jedenfalls –, als ich es ohnehin schon war. Diese Erweckung hatte ja sowohl etwas Aggressives wie auch Erotisches. Der Rock ’n’ Roll und der Vortrag beispielsweise von Elvis Presley oder Jerry Lee Lewis – die Körpersprache, das Performative – waren höchst inspirativ. Diese Stimmung hat sich bei jungen Leuten, die empfänglich dafür waren, breitgemacht. Die Stadt Köln war damals schon so, wie sie heute auch noch beschrieben wird: von der Mentalität her angenehm. Auf einen zukommend oder jedenfalls nicht hanseatisch oder pariserisch, sondern relativ offen und leger. Laisser-faire.
Mit der allmählichen Politisierung – sowohl an der Universität hier in Köln als auch an den Kunstakademien und an den Werkschulen, wo ich studierte – kam für mich die Überlegung, da ich natürlich bei den Demos gegen die Notstandsgesetze und was da alles anfiel, dabei war, ob ich mich mehr politisiere oder meine alltäglicheren „existenziellen“ Probleme in die Kunst einführe, anstatt sie auf der Straße auszuleben. Wäre ich politisch richtig aktiv geworden, hätte ich die Kunst eine Zeit lang vergessen können. Das wollte ich aber nicht und habe die Problematiken daher in die Kunst überführt. Und da tauchte natürlich sehr schnell Sexualität und Eros auf, weil das in der Nachkriegsgesellschaft ein Tabu war. Wir waren von Tabus umzingelt. Der Vorschlag war mehr oder weniger eine Art verordnetes Leben, was noch diese graue, restbraune Gesellschaft und das große Schweigen, was darüber lag, innehatte. Dagegen wehrte ich mich mit meinen Arbeiten. In den Anfängen waren es Zeichnungen, die das, was wir heute als „Gender-Problematik“ bezeichnen, bereits aufzeigten. In den Fotoarbeiten nutzte ich dann meinen Körper als Projektionsfläche, um, sagen wir mal, die Identität, die Sexualität aufzubrechen und zu erweitern. Also faktisch zu expandieren, zu experimentieren über das Reale hinaus bis hin zum „utopischen Körper“.
Gab es für Sie in der Kunstszene Leute, denen Sie sich anschließen konnten, mit denen Sie Ihre Themen besprechen und entwickeln konnten?
An jeder Kunstakademie finden sich ein paar Geister, die besonders motiviert sind und etwas wollen. Die hatten wir natürlich auch. Ich war derjenige, der sich mit den eben genannten Themen beschäftigte. Andere hatten andere Dinge im Kopf, mit denen sie sich beschäftigten. Aber was einen verband, war die Willensbildung und dass man sich wirklich über Kunst und über das Leben austauschte. Man ging auch zusammen aus und feierte zusammen. Auf der anderen Seite bestärkten einen immer auch die Literatur oder die Kunstgeschichte. All das, worin man sich mit den eigenen Interessen wiederfindet. Ich fand das zum Beispiel sehr schnell bei Hans Bellmer, Pierre Molinier, Max Beckmann, Chaïm Soutine, Francis Bacon und so weiter. Die kannte damals kaum jemand. Das sind Geister, die man ruft und die einen in diesem doch etwas schwierigen Metier bestärken. Sie waren sehr provokativ, haben sich mit schwierigen Themata auseinandergesetzt und trotzdem haben sie das Ding durchgesetzt. Das gibt einem Mut und auch Kraft.
War es für Sie eine Notwendigkeit sich mit diesen Themen zu beschäftigen, um sich selbst zu befreien? Oder war es primär ein gesellschaftlicher Anspruch, den Sie formulieren wollten?
Beides. Es gab Dinge, die nahm man gar nicht in den Mund. Ich bin ja in der Eifel in einem kleinen Dorf geboren und war später auch in den Ferien noch oft dort bei einer sehr netten Bauernfamilie. Wenn eine Frau jemanden aus einem anderen Dorf heiraten wollte, war schon Gefahr im Verzug. Und wenn der vielleicht noch eine andere Glaubensrichtung hatte oder gar ein Ausländer war, war es gleich ganz vorbei. An Scheidung war gar nicht zu denken. Und wenn sich jemand das Leben nahm, wurde er nicht begraben, sondern vergraben, so als hätte er keine Identität oder als hätte er nie existiert. Diese Probleme haben wir erst ganz langsam abgebaut. Lange unterschieden wir uns nicht besonders von denjenigen, die wir heute zu Recht bekämpfen – zum Beispiel die fundamentalen Islamisten.
Ich hatte keine Lust mehr auf dieses verordnete Leben. Und hielt Provokation daher auch für notwendig, als ich diese Themen mit den „Rot“-Performances ![]() Jürgen Klauke, „Rot“, 1974.
Jürgen Klauke, „Rot“, 1974. 
![]() Jürgen Klauke, „Masculin/Feminin I“, 1974.
Jürgen Klauke, „Masculin/Feminin I“, 1974. 
![]() Jürgen Klauke, „Transformer“, 1973.
Jürgen Klauke, „Transformer“, 1973. 
Wen wollten Sie provozieren?
Die Gesellschaft. Wir benutzen ja heute noch den Begriff der „bleiernen Zeit“. Dieses Schweigen, die Verordnungen, das – wie ich es manchmal auch nenne – spätwilhelminische Erziehungsmodell, was auch nach dem Krieg noch in den Köpfen der Großeltern war und an die Eltern weitergegeben wurde und an die Kinder und Kindeskinder und was bei den meisten dann auf der Festplatte hängen bleibt. Parolen wie „Hinsetzen!“, „Aufstehen!“, „In die Ecke!“, „Geht nicht“, „Gibt’s nicht“, „Darüber spricht man nicht!“ standen im Zentrum der Erziehung. Davon hatte man die Schnauze voll. Insofern habe ich nicht eine bestimmte Gruppe provozieren wollen, sondern ich wollte es in die Gesellschaft hineintragen. Meine Gedankengänge oder meine bildlichen Vorschläge und Reflexionen zu den genannten Themen. Die Arbeit „Grüße vom Vatikan“ ![]() Jürgen Klauke, „Grüße vom Vatikan“, 1976/77.
Jürgen Klauke, „Grüße vom Vatikan“, 1976/77. 
Ihre Bildsprache ist von Anfang an ziemlich radikal. Ich frage mich: Wer hat das überhaupt gesehen? Wenn Sie sagen: „Mit diesen Themen wende ich mich an die breite Gesellschaft und auch gerade an die, die das überhaupt nicht sehen wollen oder die den Deckel besonders draufhalten.“ Wie hat es diese Leute erreicht? Oder wie hätten Sie sie gerne erreicht?
Gut, das ist bei der Kunst immer schwierig. Sie erreichen mit Kunst nichts flächendeckend. Das erreichen Sie eventuell mit Schlagern oder Popmusik. Aber in der Kunst erreichen Sie erst einmal ein kunstaffines Publikum. Ich konnte damals immerhin im Kunstverein Köln ausstellen, mit fünf weiteren Kölner Künstlern. ![]() „Bernhard Blume, Jürgen Klauke, Falko Marx, Rune Mields, C.O. Paeffgen, H.G. Prager“, Kölnischer Kunstverein, Köln, 09. November 1975 – 11. Januar 1976. Damals habe ich die ersten Tagebuchzeichnungen, die „Transformer“-Fotografien bei Wulf Herzogenrath zeigen können. Es gab Zeitungsberichte und man redete darüber, sodass Leute davon hörten und lasen und das dann auch sahen. Da bewirkte die Provokation auch etwas Positives, wenn man so will. Aber Ihre Frage ist natürlich berechtigt. Man erreicht damit nicht flächendeckend die Gesellschaft. Das tue ich heute auch nicht, das hat Kunst noch nie getan. Wir verändern mit Kunst nicht die Welt. Das tut das Geld, das Militär, die Wirtschaft und auch die Wissenschaft. Kunst hilft die Welt ein wenig zu buchstabieren.
„Bernhard Blume, Jürgen Klauke, Falko Marx, Rune Mields, C.O. Paeffgen, H.G. Prager“, Kölnischer Kunstverein, Köln, 09. November 1975 – 11. Januar 1976. Damals habe ich die ersten Tagebuchzeichnungen, die „Transformer“-Fotografien bei Wulf Herzogenrath zeigen können. Es gab Zeitungsberichte und man redete darüber, sodass Leute davon hörten und lasen und das dann auch sahen. Da bewirkte die Provokation auch etwas Positives, wenn man so will. Aber Ihre Frage ist natürlich berechtigt. Man erreicht damit nicht flächendeckend die Gesellschaft. Das tue ich heute auch nicht, das hat Kunst noch nie getan. Wir verändern mit Kunst nicht die Welt. Das tut das Geld, das Militär, die Wirtschaft und auch die Wissenschaft. Kunst hilft die Welt ein wenig zu buchstabieren.
Es ist natürlich provokant zu fragen, aber warum haben Sie dann nicht Schlager gemacht?
Ziemlich blöde Frage. In meiner Performance „Die Wörter haben ihre Kraft verloren“ ![]() „Aspekt – Die Wörter haben ihre Kraft verloren“, Internationaler Kunstmarkt, Messehallen Köln, 28. Oktober 1977. habe ich Schlager am laufenden Meter gecuttet und zur Disposition gestellt. 1975 habe ich die erste Live-Performance gemacht. Alles davor war inszenierte Fotografie und natürlich Zeichnungen. Die erste Live-Performance war bei De Appel in Amsterdam mit Uwe Laysiepen, heute Ulay.
„Aspekt – Die Wörter haben ihre Kraft verloren“, Internationaler Kunstmarkt, Messehallen Köln, 28. Oktober 1977. habe ich Schlager am laufenden Meter gecuttet und zur Disposition gestellt. 1975 habe ich die erste Live-Performance gemacht. Alles davor war inszenierte Fotografie und natürlich Zeichnungen. Die erste Live-Performance war bei De Appel in Amsterdam mit Uwe Laysiepen, heute Ulay. ![]() De Appel ist ein Zentrum für zeitgenössische Kunst in Amsterdam, das 1975 von Wies Smals (1939–1983) als Stiftung initiiert wurde. Ein besonderer Schwerpunkt des Programms liegt auf installativer und performativer Kunst. Vor der Gründung der De Appel Foundation betrieb Smals von 1968 bis 1975 die Galerie Seriaal in Amsterdam. Am 11., 12. und 14. September 1975 zeigten Jürgen Klauke und Ulay in De Appel „Keine Möglichkeit – Zwei Platzwunden“. Gleichzeitig hatte ich bei Wies Smals in De Appel eine Ausstellung mit den frühen Fotoinszenierungen, männlich-weibliche Aufhebungen – Geschlechterannäherungen. Amsterdam war ein wichtiger Schritt für mich, weil dieses kleine Institut von Frau Smals ein internationaler Hotspot war. Da kamen die Japaner, Chinesen, Amerikaner, alles, was performativ unterwegs war. Auch aus dem slawischen Raum: In Belgrad auf dem Universitätsgelände gab es auch so einen Ort, auch während der Ausgangssperre haben wir uns da austoben dürfen.
De Appel ist ein Zentrum für zeitgenössische Kunst in Amsterdam, das 1975 von Wies Smals (1939–1983) als Stiftung initiiert wurde. Ein besonderer Schwerpunkt des Programms liegt auf installativer und performativer Kunst. Vor der Gründung der De Appel Foundation betrieb Smals von 1968 bis 1975 die Galerie Seriaal in Amsterdam. Am 11., 12. und 14. September 1975 zeigten Jürgen Klauke und Ulay in De Appel „Keine Möglichkeit – Zwei Platzwunden“. Gleichzeitig hatte ich bei Wies Smals in De Appel eine Ausstellung mit den frühen Fotoinszenierungen, männlich-weibliche Aufhebungen – Geschlechterannäherungen. Amsterdam war ein wichtiger Schritt für mich, weil dieses kleine Institut von Frau Smals ein internationaler Hotspot war. Da kamen die Japaner, Chinesen, Amerikaner, alles, was performativ unterwegs war. Auch aus dem slawischen Raum: In Belgrad auf dem Universitätsgelände gab es auch so einen Ort, auch während der Ausgangssperre haben wir uns da austoben dürfen.
Amsterdam war zu der Zeit ein schöner Platz, an dem viel experimentiert wurde, von Drogen bis hin zum experimentellen Theater. Es kamen viele von außen, unter anderem amerikanische Soldaten, die aus Vietnam flohen und über Schweden nach Holland kamen. Amsterdam war ein Platz, an dem kiloweise Haschisch geraucht wurde, wo es viele schöne Frauen gab, die Models waren oder sein wollten, während die Jungs alle Modefotografen werden wollten. Die Künstler kassierten alle beim König und bei sonstigen Stiftungen ab. Die mussten drei Bilder im Jahr malen und bekamen dann sehr schöne Gratifikationen, sodass sie angenehm dahinsiechen konnten. Insofern war Amsterdam für mich auch irgendwann erledigt. Obwohl ich eine Zeit lang schon überlegt habe, ganz dorthin zu gehen. Damals gab es da die politischen Gruppen, die Provos, die auch in die Institutionen drängten, in die Politik. Damals war Holland eines der freiesten europäischen Länder. Das gilt für Amsterdam. Wenn man langhaarig, wie wir damals waren, aufs Land fuhr, war in Holland auch Feierabend. Eine Zeit lang war das für mich sehr ergiebig, aber dann habe ich gemerkt, dass es zu angenehm wurde. Es war mir nicht mehr heavy genug.
Der Widerstand war nicht groß genug?
Ja, es war mir zu sanft. Das war eine Zeit lang schön. Das kann man ja auch mal genießen, aber es gab zu wenig Widerstand. Und den braucht man, wenn man jung ist. Um sein Ding weiterzutreiben.
Wie kam es zu Ihrer ersten Performance mit Ulay?
Es gab Fluxus und es gab Happening. Das war mir überwiegend zu lustig. Daneben gab es den Aktionismus ![]() Der Wiener Aktionismus war eine Kunstbewegung, die ab den frühen 60er-Jahren in Wien entstand. Traditionelle Gattungsgrenzen wurden unter Einsatz des menschlichen Körpers als Teil des Kunstwerks – häufig traten die Künstler selbst in Aktion – aufgebrochen. Mit ihren zum Teil durchaus provokanten Arbeiten zielten die Künstler aus dem Umfeld des Wiener Aktionismus auf direkte Konfrontation mit ihrer Umwelt. Zu den bekanntesten Vertretern des Wiener Aktionismus zählen Günter Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch und Rudolf Schwarzkogler. Siehe auch: Eva Badura-Triska, Hubert Klocker (Hg.), „Wiener Aktionismus. Kunst und Aufbruch im Wien der 1960er-Jahre“, Köln 2012. in Österreich, die beiden stärksten Figuren waren für mich Günter Brus und Rudolf Schwarzkogler, der sich ja leider umgebracht hat. Die projizierten nicht nur dieses Ausufernde, sondern da spielten auch formale Aspekte in den Aktionen und in dem, was davon übrig blieb, eine Rolle. Das hat mich interessiert. Bei der Performance wird das Publikum ja nicht mit einbezogen, wie das bei Fluxus und Happening der Fall war. Bei der Performance ist die Distanz gegeben. Hier der Künstler, der etwas anbietet, da das Publikum, das später im besten Fall leicht verstört den Raum wieder verlässt. Ich denke, dass die Musik da schon eine anregende Rolle gespielt hat. Die wurde in der Zeit immer lauter und experimenteller und erreichte eine große Öffentlichkeit, während wir im Kunstraum verharrten. Die Suche nach einer Öffnung war wohl der Hauptwunsch und so auch der Hauptgrund für die erste Performance.
Der Wiener Aktionismus war eine Kunstbewegung, die ab den frühen 60er-Jahren in Wien entstand. Traditionelle Gattungsgrenzen wurden unter Einsatz des menschlichen Körpers als Teil des Kunstwerks – häufig traten die Künstler selbst in Aktion – aufgebrochen. Mit ihren zum Teil durchaus provokanten Arbeiten zielten die Künstler aus dem Umfeld des Wiener Aktionismus auf direkte Konfrontation mit ihrer Umwelt. Zu den bekanntesten Vertretern des Wiener Aktionismus zählen Günter Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch und Rudolf Schwarzkogler. Siehe auch: Eva Badura-Triska, Hubert Klocker (Hg.), „Wiener Aktionismus. Kunst und Aufbruch im Wien der 1960er-Jahre“, Köln 2012. in Österreich, die beiden stärksten Figuren waren für mich Günter Brus und Rudolf Schwarzkogler, der sich ja leider umgebracht hat. Die projizierten nicht nur dieses Ausufernde, sondern da spielten auch formale Aspekte in den Aktionen und in dem, was davon übrig blieb, eine Rolle. Das hat mich interessiert. Bei der Performance wird das Publikum ja nicht mit einbezogen, wie das bei Fluxus und Happening der Fall war. Bei der Performance ist die Distanz gegeben. Hier der Künstler, der etwas anbietet, da das Publikum, das später im besten Fall leicht verstört den Raum wieder verlässt. Ich denke, dass die Musik da schon eine anregende Rolle gespielt hat. Die wurde in der Zeit immer lauter und experimenteller und erreichte eine große Öffentlichkeit, während wir im Kunstraum verharrten. Die Suche nach einer Öffnung war wohl der Hauptwunsch und so auch der Hauptgrund für die erste Performance.
Das erste Mal ist ja immer ein Experiment mit offenem Ende. Ulay und ich haben damals eine Art Identitätswechsel vorgenommen, ein Thema, an dem ich mich in den Medien Zeichnung und Foto schon erprobt hatte. Wir spielten mit Masken und Accessoires und arbeiteten auch schon mit Projektionen: Sprengungen von großen Schornsteinen, die zusammenbrachen wie Riesenpenisse. Das in Zeitlupe und in der Wiederholung. Am Ende gab es eine Art russisches Roulette. Uwe, der ja Autodidakt war und durch mich an die Kunst herangeführt wurde, hatte dann Lust auf mehr Performances und wollte so richtig loslegen. Da er mit anderen künstlerischen Medien nicht vertraut war, konnte ich das nachvollziehen, war aber nicht bereit, mich nur auf Performance zu fokussieren.
Es gab Künstler, die ihre Performances häufig wiederholten, die von Beruf Performer wurden, auch um sich ein bisschen etwas zu verdienen. Da merkte man aber sehr schnell, wie sich die Sache verflüchtigte oder zum Theater wurde. Und das war ja genau das, was die Performance nicht sein sollte. Ich habe meine Performances generell maximal dreimal aufgeführt. Das war eine Regel, die ich mir selbst gegeben habe, als Korrektiv für mich und die jeweilige Arbeit.
Unterschieden sich die Reaktionen auf Ihre Performances abhängig von dem Ort, an dem Sie diese zeigten?
Nein. Das Publikum hat es einfach hingenommen, war ruhig und konzentriert. Hier und da gab es vielleicht mal einen Zwischenruf. Allerdings bei der Arbeit „Hinsetzen/Aufsteh’n/Ich liebe Dich“ ![]() Jürgen Klauke zeigte die Arbeit „Hinsetzen/Aufsteh’n/Ich liebe Dich. Ein Dialog“ erstmals am 07. Februar 1979 in der Ausstellung „Performances 79“ in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus in München. Im April desselben Jahrs war er mit der Arbeit auf der „3rd Biennale of Sydney“ vertreten. Ein letztes Mal war die Arbeit im Goethe-Institut in Ankara am 25. November 1981 zu sehen.
Jürgen Klauke zeigte die Arbeit „Hinsetzen/Aufsteh’n/Ich liebe Dich. Ein Dialog“ erstmals am 07. Februar 1979 in der Ausstellung „Performances 79“ in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus in München. Im April desselben Jahrs war er mit der Arbeit auf der „3rd Biennale of Sydney“ vertreten. Ein letztes Mal war die Arbeit im Goethe-Institut in Ankara am 25. November 1981 zu sehen.  , die ich im Lenbachhaus in München zum ersten Mal gemacht habe, gab es richtig Radau. In München war bis dahin performativ nicht viel geschehen. Das war ein Festival und wurde von dem bayerischen Publikum sehr gut angenommen. Es war so voll, dass die Leute in den Gängen saßen. Mir gegenüber auf dem Stuhl stand ein Tonband, von dem sich folgender Dialog 20 bis 25 Minuten ohne Unterbrechung ans Publikum wandte: Ein Mann sagte: „Hinsetzen! Aufsteh’n!“, eine Frau antwortete: „Ich liebe dich.“ Und ich antworte live: „Ich liebe dich.“ Das beginnt relativ normal, in normaler Lautstärke. Nach einigen Minuten wurde es unruhig und aus dem Publikum regte sich ein Chor, wie in der Südkurve: „H-i-n-s-e-t-z-e-n! A-u-f-s-t-e-h’-n!“ – überwiegend Frauen, die damals laut wurden. Nach circa acht bis zehn Minuten steigert sich die Lautstärke, das „Hinsetzen! Aufsteh’n!“ bekommt einen Befehlston und wird immer aggressiver, während die Frauenstimme mit „Ich liebe dich“ immer im gleichen Sound bleibt. Auch ich werde bei meiner Antwort „Ich liebe dich“ immer militanter und aggressiver und mit zunehmender Geschwindigkeit des Befehls und meiner Antwort nimmt auch meine körperliche Reaktion des Hinsetzens und Aufstehens an Dynamik zu. Irgendwann ist dann Ruhe im Karton – absolute Stille im Saal. Zwischenzeitlich war ich kurz davor aufzuhören, weil ich das so noch nicht erlebt hatte. Auch meine Intensität hat durch die Teilnahme des Publikums zugenommen. Am Ende haue ich das Mikrofon weg, schlage den Stuhl zu Sägemehl und verschwinde. Es wurde ganz still und dann gab es einen großen Applaus. In Ankara habe ich die Arbeit während der Militärdiktatur noch einmal gemacht. Und dann ein drittes Mal in Australien bei der Sydney-Biennale.
, die ich im Lenbachhaus in München zum ersten Mal gemacht habe, gab es richtig Radau. In München war bis dahin performativ nicht viel geschehen. Das war ein Festival und wurde von dem bayerischen Publikum sehr gut angenommen. Es war so voll, dass die Leute in den Gängen saßen. Mir gegenüber auf dem Stuhl stand ein Tonband, von dem sich folgender Dialog 20 bis 25 Minuten ohne Unterbrechung ans Publikum wandte: Ein Mann sagte: „Hinsetzen! Aufsteh’n!“, eine Frau antwortete: „Ich liebe dich.“ Und ich antworte live: „Ich liebe dich.“ Das beginnt relativ normal, in normaler Lautstärke. Nach einigen Minuten wurde es unruhig und aus dem Publikum regte sich ein Chor, wie in der Südkurve: „H-i-n-s-e-t-z-e-n! A-u-f-s-t-e-h’-n!“ – überwiegend Frauen, die damals laut wurden. Nach circa acht bis zehn Minuten steigert sich die Lautstärke, das „Hinsetzen! Aufsteh’n!“ bekommt einen Befehlston und wird immer aggressiver, während die Frauenstimme mit „Ich liebe dich“ immer im gleichen Sound bleibt. Auch ich werde bei meiner Antwort „Ich liebe dich“ immer militanter und aggressiver und mit zunehmender Geschwindigkeit des Befehls und meiner Antwort nimmt auch meine körperliche Reaktion des Hinsetzens und Aufstehens an Dynamik zu. Irgendwann ist dann Ruhe im Karton – absolute Stille im Saal. Zwischenzeitlich war ich kurz davor aufzuhören, weil ich das so noch nicht erlebt hatte. Auch meine Intensität hat durch die Teilnahme des Publikums zugenommen. Am Ende haue ich das Mikrofon weg, schlage den Stuhl zu Sägemehl und verschwinde. Es wurde ganz still und dann gab es einen großen Applaus. In Ankara habe ich die Arbeit während der Militärdiktatur noch einmal gemacht. Und dann ein drittes Mal in Australien bei der Sydney-Biennale.
Mit der Performance kann ich demonstrativer agieren als in den Bildern, in denen ich über ästhetische Probleme oder Bildmagie und solche Dinge nachdenke. Bei meinen Performances hatte ich immer den Wunsch aus Arbeitserfahrungen bestimmter Werkgruppen zu schöpfen und es in etwas anderes zu transformieren. Und zwar demonstrativer, aggressiver, mit anderen Materialien und mit dem Einsatz meines Körpers.
Zwischenrufe und Attacken gab es noch einmal bei der Trilogie „Postmoderne – Hab’ Mich Gerne“, „In der Tat“ und „Zweitgeist“, die ich auch in Kasper Königs Großausstellung, „von hier aus“ zeigte. ![]() Jürgen Klauke/Arno Steffen, „Postmoderne – Hab’ Mich Gerne“, in der Ausstellung „von hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf“, Düsseldorf, 09./11. November 1984; „In der Tat – Kultur“, Bonner Kunstwoche, Kunstzelt im Hofgarten, Bonn, 23. September 1984; „Zweitgeist. Ein Dialog“, Domplatte Köln, 18. Mai 1986.
Jürgen Klauke/Arno Steffen, „Postmoderne – Hab’ Mich Gerne“, in der Ausstellung „von hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf“, Düsseldorf, 09./11. November 1984; „In der Tat – Kultur“, Bonner Kunstwoche, Kunstzelt im Hofgarten, Bonn, 23. September 1984; „Zweitgeist. Ein Dialog“, Domplatte Köln, 18. Mai 1986. 

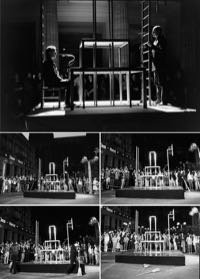 Da schlage ich mich mit meinem Partner, also wir ohrfeigen uns, und zwar mit Anlauf, das ist kein Fake. Anschließend küssen wir uns. Und da kam damals ein junger Mann dazwischengesprungen, der das nicht mehr ertragen konnte und uns stoppen wollte. Dem habe ich dann auch eine gewischt. Man darf sich während der Aktion nicht stören lassen. Es muss weitergehen.
Da schlage ich mich mit meinem Partner, also wir ohrfeigen uns, und zwar mit Anlauf, das ist kein Fake. Anschließend küssen wir uns. Und da kam damals ein junger Mann dazwischengesprungen, der das nicht mehr ertragen konnte und uns stoppen wollte. Dem habe ich dann auch eine gewischt. Man darf sich während der Aktion nicht stören lassen. Es muss weitergehen.
Wo sehen Sie Ihre Gleichgesinnten oder Ihre Gruppe bei so einem provokativen Werk?
Also eines kann man feststellen: Ich bin gruppenungeeignet. Das Einzige, was ich mal mitgemacht habe, war nach dem Studium eine Art Kooperative. Das war mir aber auch eine Lehre. Uns stand im Belgischen Viertel ein Raum zur Verfügung und dort haben wir mit drei, vier Kollegen Ausstellungen gemacht. Ich hatte ja Freie Grafik studiert, also Radierung, Lithografie und Serigrafie. Wir haben unsere Plakate selbst entworfen und gedruckt, an die Presse geschrieben und so weiter. Das heißt, wir haben uns in Öffentlichkeitsarbeit geübt. Eine Aktion war eine 24-Stunden-Ausstellung. Allerdings ohne Bilder – womit das Publikum natürlich nicht gerechnet hatte. Es wurden gesellschaftliche und kulturpolitische Parolen an die Wände geschrieben und die hatten dann die gewünschte Diskussion mit dem Publikum zur Folge. In der Summe eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
Wer war damals dabei?
Bis auf Eusebius Wirdeier ![]() Eusebius Wirdeier (* 1950 Dormagen) ist Fotograf, Grafiker, Bildhauer und Herausgeber zahlreicher Bücher. Er arbeitete unter anderem über das soziale und gesellschaftliche Leben in Köln und dem Rheinland. sind die alle mehr oder weniger verschwunden.
Eusebius Wirdeier (* 1950 Dormagen) ist Fotograf, Grafiker, Bildhauer und Herausgeber zahlreicher Bücher. Er arbeitete unter anderem über das soziale und gesellschaftliche Leben in Köln und dem Rheinland. sind die alle mehr oder weniger verschwunden.
Und die Gäste?
Das speiste sich aus Subkultur und neugierigem Kunstpublikum sowie unserem gewachsenen Bekanntenkreis – Plakate und besonders Mundpropaganda sorgten für regen Verkehr.
Kamen auch Galeristen?
Es gibt immer wichtige Galerien, die kommen nicht unbedingt zu solchen Veranstaltungen. Das wäre in dem Fall Hein Stünke gewesen, Rudolf Zwirner eventuell und noch ein paar andere. Die kamen nicht. Aber Ingo Kümmel ![]() Ingo Kümmel (1937 Fulda – 1990 Köln) eröffnete 1967 die Galerie Kümmels Spirit and Art Shop. Neben dem Verkauf von Spirituosen zeigte Kümmel auch Arbeiten junger Künstler und organisierte diverse Abendveranstaltungen. Vgl. Wulf Herzogenrath/Gabriele Lueg (Hg.), „Die 60er Jahre. Kölns Weg zur Kunstmetropole. Vom Happening zum Kunstmarkt“, Köln 1986, S. 441 f. zum Beispiel – das war eine wichtige Figur, der die Neumärkte der Künste machte und eine Schnapsgalerie betrieb. Das wäre ja heute auch nicht mehr denkbar, bei so viel politischer Korrektheit. Das waren Figuren, die auf allen Szenen Tag und Nacht zu finden waren und Kunst liebten, und die kamen auch zu uns.
Ingo Kümmel (1937 Fulda – 1990 Köln) eröffnete 1967 die Galerie Kümmels Spirit and Art Shop. Neben dem Verkauf von Spirituosen zeigte Kümmel auch Arbeiten junger Künstler und organisierte diverse Abendveranstaltungen. Vgl. Wulf Herzogenrath/Gabriele Lueg (Hg.), „Die 60er Jahre. Kölns Weg zur Kunstmetropole. Vom Happening zum Kunstmarkt“, Köln 1986, S. 441 f. zum Beispiel – das war eine wichtige Figur, der die Neumärkte der Künste machte und eine Schnapsgalerie betrieb. Das wäre ja heute auch nicht mehr denkbar, bei so viel politischer Korrektheit. Das waren Figuren, die auf allen Szenen Tag und Nacht zu finden waren und Kunst liebten, und die kamen auch zu uns.
Ende der 60er-Jahre wird das Rheinland mit dem ersten Kunstmarkt 1967 in Köln Mittelpunkt der deutschen Kunstszene. Viele Galerien siedeln in dieser Zeit nach Köln über, unter anderen Michael Werner ![]() Michael Werner (* 1939 Nauen) eröffnete 1963 mit Benjamin Katz eine Galerie in Berlin und zog 1968 nach Köln, wo er die Galerie Hake übernahm, die er ab Oktober 1969 unter seinem Namen weiterführte. In den 70er- und 80er-Jahren vertrat die Galerie Michael Werner unter anderen die Künstler Georg Baselitz, Antonius Höckelmann, Jörg Immendorff, Anselm Kiefer, Per Kirkeby, Markus Lüpertz und A.R. Penck. Die Galerie ist heute in Berlin, London und New York vertreten. 2011 wurde Werner mit dem Preis der Art Cologne ausgezeichnet mit seinen Berliner Malern.
Michael Werner (* 1939 Nauen) eröffnete 1963 mit Benjamin Katz eine Galerie in Berlin und zog 1968 nach Köln, wo er die Galerie Hake übernahm, die er ab Oktober 1969 unter seinem Namen weiterführte. In den 70er- und 80er-Jahren vertrat die Galerie Michael Werner unter anderen die Künstler Georg Baselitz, Antonius Höckelmann, Jörg Immendorff, Anselm Kiefer, Per Kirkeby, Markus Lüpertz und A.R. Penck. Die Galerie ist heute in Berlin, London und New York vertreten. 2011 wurde Werner mit dem Preis der Art Cologne ausgezeichnet mit seinen Berliner Malern.
Damals war Markus Lüpertz noch nicht so elegant gekleidet. Er stand im Parka bei uns im Roxy ![]() Das Roxy ist ein Nachtklub und Künstlerlokal in Köln. Es wurde ab 1974 von dem Fotografen Horst Leichenich betrieben. Vgl. Anne Richter, „Roxy. Von der Künstlerkneipe zum Kult-Club“, unter: http://www.rundschau-online.de/region/koeln/-roxy--von-der-kuenstlerkneipe-zum-kult-club-2907476 (eingesehen am 07.06.2016). an der Theke, äußerte aber schon den Wunsch, sobald er Geld hätte, sich sehr gut einkleiden zu wollen. Dieses Gruppendynamische, was sich um Michael Werner zeigte, der eine kleine Galerie am Waidmarkt hatte, gab es in der Form hier im Rheinland selten, das gab es eher in Berlin. Günther Uecker, Otto Piene, Heinz Mack, das war eventuell eine Gruppe, die gemeinsame Interessen hatte.
Das Roxy ist ein Nachtklub und Künstlerlokal in Köln. Es wurde ab 1974 von dem Fotografen Horst Leichenich betrieben. Vgl. Anne Richter, „Roxy. Von der Künstlerkneipe zum Kult-Club“, unter: http://www.rundschau-online.de/region/koeln/-roxy--von-der-kuenstlerkneipe-zum-kult-club-2907476 (eingesehen am 07.06.2016). an der Theke, äußerte aber schon den Wunsch, sobald er Geld hätte, sich sehr gut einkleiden zu wollen. Dieses Gruppendynamische, was sich um Michael Werner zeigte, der eine kleine Galerie am Waidmarkt hatte, gab es in der Form hier im Rheinland selten, das gab es eher in Berlin. Günther Uecker, Otto Piene, Heinz Mack, das war eventuell eine Gruppe, die gemeinsame Interessen hatte.
Wie war das mit Sigmar Polke, Manfred Kuttner, Konrad Lueg und Gerhard Richter?
Ich glaube, das stellt man sich im Nachhinein als Gruppe vor. Konrad Fischer ![]() Konrad Fischer (1939 Düsseldorf – 1996 Düsseldorf) war ein deutscher Künstler und Galerist. In seiner 1967 in der Düsseldorfer Altstadt eröffneten Galerie stellte er frühe Vertreter der Minimal Art und der Konzeptkunst vor, darunter Carl Andre, Hanne Darboven, Bruce Nauman und Lawrence Weiner. Als Konrad Lueg war Fischer vor Gründung seiner Galerie als Künstler tätig und stellte mehrfach unter anderen mit Gerhard Richter aus. Die bekannteste künstlerische Aktion, an der Lueg beteiligt war, fand im Oktober 1963 im Düsseldorfer Möbelhaus Berges unter dem Titel „Leben mit Pop. Eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus“ statt. war der Galerist, der auch malte. Polke war kein Gruppenmensch und Richter schon gar nicht. Wenn man um Polke eine Gruppe zimmern wollte, wären das: Polke, Christof Kohlhöfer und Achim Duchow. Eventuell noch Memphis Schulze. Mit ihrer Behausung draußen auf dem flachen Lande war das schon eher ein bisschen gruppendynamisch-zeitgeistig, kommuneartig bis hippiesk.
Konrad Fischer (1939 Düsseldorf – 1996 Düsseldorf) war ein deutscher Künstler und Galerist. In seiner 1967 in der Düsseldorfer Altstadt eröffneten Galerie stellte er frühe Vertreter der Minimal Art und der Konzeptkunst vor, darunter Carl Andre, Hanne Darboven, Bruce Nauman und Lawrence Weiner. Als Konrad Lueg war Fischer vor Gründung seiner Galerie als Künstler tätig und stellte mehrfach unter anderen mit Gerhard Richter aus. Die bekannteste künstlerische Aktion, an der Lueg beteiligt war, fand im Oktober 1963 im Düsseldorfer Möbelhaus Berges unter dem Titel „Leben mit Pop. Eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus“ statt. war der Galerist, der auch malte. Polke war kein Gruppenmensch und Richter schon gar nicht. Wenn man um Polke eine Gruppe zimmern wollte, wären das: Polke, Christof Kohlhöfer und Achim Duchow. Eventuell noch Memphis Schulze. Mit ihrer Behausung draußen auf dem flachen Lande war das schon eher ein bisschen gruppendynamisch-zeitgeistig, kommuneartig bis hippiesk. ![]() Von 1972 bis 1978 lebte Sigmar Polke zeitweilig mit Freunden und Kollegen auf dem Gaspelshof im niederrheinischen Willich. Vgl. Kathrin Rottmann, „Polke im Kontext. Eine Chronologie“, in: „Alibis. Sigmar Polke 1963–2010“, hg. von Kathy Halbreich, Ausst.-Kat. u. a. Museum Ludwig, Köln, London/München/New York 2014, S. 26–69, hier S. 39. Polke wohnte eine Zeit lang auch hier in Köln und ich fuhr hin und wieder auch nach Düsseldorf in den Ratinger Hof und verbrachte da schöne Nächte. Wenn Polke und Duchow mit Erhard Klein
Von 1972 bis 1978 lebte Sigmar Polke zeitweilig mit Freunden und Kollegen auf dem Gaspelshof im niederrheinischen Willich. Vgl. Kathrin Rottmann, „Polke im Kontext. Eine Chronologie“, in: „Alibis. Sigmar Polke 1963–2010“, hg. von Kathy Halbreich, Ausst.-Kat. u. a. Museum Ludwig, Köln, London/München/New York 2014, S. 26–69, hier S. 39. Polke wohnte eine Zeit lang auch hier in Köln und ich fuhr hin und wieder auch nach Düsseldorf in den Ratinger Hof und verbrachte da schöne Nächte. Wenn Polke und Duchow mit Erhard Klein ![]() Erhard Klein (* 1938 Krefeld) ist ein deutscher Galerist, der von 1970 bis 2006 eine Galerie in Bonn betrieb und seit 1992 in Bad Münstereifel eine Filiale führt. Mit Joseph Beuys, Walter Dahn, Gotthard Graubner, Jürgen Klauke, Sigmar Polke und Katharina Sieverding vertritt Klein vor allem Künstler aus dem Rheinland. in Bonn versackt waren, klopften sie morgens in Köln an meine Tür und dann ging es weiter. Das waren alles Nähen, aber nie ideologisch verbrämte Gruppierungen. Auch mit Michael Buthe, Rune Mields, Astrid Klein, C.O. Paeffgen, Dieter Krieg und Ulrich Rückriem oder Anna Oppermann aus dem Norden hatte ich einen sehr netten Kontakt, auch wenn man sich manchmal zwei Monate lang überhaupt nicht gesehen hat. Der Schmelztiegel war das Roxy hier in Köln, das mein Freund Horst Leichenich machte. Da traf sich die ganze Mischpoke. Es gab ja auch noch nicht diese ausgewiesenen Lokale für Schwule, für Lesben, für Künstler, für Bankbeamte, Drogisten und so weiter. Sondern es gab eben diese Mestizen-Treffpunkte der besonderen Art.
Erhard Klein (* 1938 Krefeld) ist ein deutscher Galerist, der von 1970 bis 2006 eine Galerie in Bonn betrieb und seit 1992 in Bad Münstereifel eine Filiale führt. Mit Joseph Beuys, Walter Dahn, Gotthard Graubner, Jürgen Klauke, Sigmar Polke und Katharina Sieverding vertritt Klein vor allem Künstler aus dem Rheinland. in Bonn versackt waren, klopften sie morgens in Köln an meine Tür und dann ging es weiter. Das waren alles Nähen, aber nie ideologisch verbrämte Gruppierungen. Auch mit Michael Buthe, Rune Mields, Astrid Klein, C.O. Paeffgen, Dieter Krieg und Ulrich Rückriem oder Anna Oppermann aus dem Norden hatte ich einen sehr netten Kontakt, auch wenn man sich manchmal zwei Monate lang überhaupt nicht gesehen hat. Der Schmelztiegel war das Roxy hier in Köln, das mein Freund Horst Leichenich machte. Da traf sich die ganze Mischpoke. Es gab ja auch noch nicht diese ausgewiesenen Lokale für Schwule, für Lesben, für Künstler, für Bankbeamte, Drogisten und so weiter. Sondern es gab eben diese Mestizen-Treffpunkte der besonderen Art.
Hätten Sie sich manchmal eine Gruppe gewünscht?
Nein – das sagte ich schon. Ich bin kein Gruppenmensch. Ich war und bin alleine gut aufgehoben. Obwohl der Kontakt zu den anderen Künstlern natürlich wichtig war. Ulrich Rückriem ![]() Ulrich Rückriem (* 1938, Düsseldorf) ist ein deutscher Künstler, der für seine gespaltenen Steinblöcke bekannt ist. Der gelernte Steinmetz arbeitete von 1959 bis 1961 an der Dombauhütte in Köln und studierte zeitgleich in der Klasse von Ludwig Gies an der Kölner Werkschule. 1969 zeigte er seine minimalen Skulpturen erstmals bei Konrad Fischer in Düsseldorf. Seit 1970 war Rückriem vielfach auf internationalen Ausstellungen vertreten, darunter auf der Venedig-Biennale (1978) sowie den documenta-Ausstellungen 5 (1972), 7 (1982), 8 (1987) und 9 (1992). Er war Professor an der Hochschule für bildende Künste Hamburg (1974–1984), der Kunstakademie in Düsseldorf (1984–1988) und der Städelschule in Frankfurt am Main (1988). , der mich zum Beispiel bei Erhard Klein vorgeschlagen hatte und der mir eine Arbeit abkaufte, als ich mal wieder keine Kohle hatte, mochte mich und ich mochte ihn, obwohl wir sehr unterschiedlich arbeiten.
Ulrich Rückriem (* 1938, Düsseldorf) ist ein deutscher Künstler, der für seine gespaltenen Steinblöcke bekannt ist. Der gelernte Steinmetz arbeitete von 1959 bis 1961 an der Dombauhütte in Köln und studierte zeitgleich in der Klasse von Ludwig Gies an der Kölner Werkschule. 1969 zeigte er seine minimalen Skulpturen erstmals bei Konrad Fischer in Düsseldorf. Seit 1970 war Rückriem vielfach auf internationalen Ausstellungen vertreten, darunter auf der Venedig-Biennale (1978) sowie den documenta-Ausstellungen 5 (1972), 7 (1982), 8 (1987) und 9 (1992). Er war Professor an der Hochschule für bildende Künste Hamburg (1974–1984), der Kunstakademie in Düsseldorf (1984–1988) und der Städelschule in Frankfurt am Main (1988). , der mich zum Beispiel bei Erhard Klein vorgeschlagen hatte und der mir eine Arbeit abkaufte, als ich mal wieder keine Kohle hatte, mochte mich und ich mochte ihn, obwohl wir sehr unterschiedlich arbeiten.
Gab es einen Galeristen oder Kunsthistoriker, einen Vermittler oder Promoter, mit dem Sie über Ihre Arbeiten sprechen konnten? Oder anders gefragt: Woher nahmen Sie in der Zeit zwischen Minimal und Pop-Art die Sicherheit oder das Selbstbewusstsein, dass Sie mit Ihren Themen richtig lagen?
Kunst ist auch eine bestimmte Form von Selbst- und Weltvergewisserung. Natürlich gab es ein paar Geister, die mich besuchten. Das war zum Beispiel Georg Jappe ![]() Georg Jappe (1936 Köln – 2007 Kleve) war ein Kunst- und Literaturkritiker, der seit 1962 regelmäßig Beiträge in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, der „Zeit“ und dem „Merkur“ veröffentlichte. Von 1979 bis 2001 lehrte er als Professor für Kunsttheorie an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. , der ein Denker und Schreiber war und in der Südstadt nicht weit von mir wohnte. Oder der Kulturphilosoph Gerhard Johann Lischka in Bern, der auch über mich schrieb, sowie Klaus Honnef, ein früher Liebhaber, Evelyn Weiss, Manfred Schneckenburger und der tolle Charlie Ruhrberg. Auch mit Kollegen und Kolleginnen, auch wenn sie ganz anders unterwegs waren, gab es immer spannende Gespräche oder Verwerfungen. Rolf Dieter Brinkmann und Ralf-Rainer Rygulla führten die amerikanische Underground-Lyrik ein, unter anderem mit dem Band „ACID“. Brinkmann ist leider auch zu früh gestorben. Rygulla besuchte ich noch ab und an in Frankfurt, wo er eine Disco betrieb. Die heute legendäre Musikgruppe „Can“ feierte damals erste Erfolge und auch da gab es intensive Berührungspunkte.
Georg Jappe (1936 Köln – 2007 Kleve) war ein Kunst- und Literaturkritiker, der seit 1962 regelmäßig Beiträge in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, der „Zeit“ und dem „Merkur“ veröffentlichte. Von 1979 bis 2001 lehrte er als Professor für Kunsttheorie an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. , der ein Denker und Schreiber war und in der Südstadt nicht weit von mir wohnte. Oder der Kulturphilosoph Gerhard Johann Lischka in Bern, der auch über mich schrieb, sowie Klaus Honnef, ein früher Liebhaber, Evelyn Weiss, Manfred Schneckenburger und der tolle Charlie Ruhrberg. Auch mit Kollegen und Kolleginnen, auch wenn sie ganz anders unterwegs waren, gab es immer spannende Gespräche oder Verwerfungen. Rolf Dieter Brinkmann und Ralf-Rainer Rygulla führten die amerikanische Underground-Lyrik ein, unter anderem mit dem Band „ACID“. Brinkmann ist leider auch zu früh gestorben. Rygulla besuchte ich noch ab und an in Frankfurt, wo er eine Disco betrieb. Die heute legendäre Musikgruppe „Can“ feierte damals erste Erfolge und auch da gab es intensive Berührungspunkte.
Eine andere wichtige Figur für die Selbstbehauptung war der Sexual- und Kunstwissenschaftler Peter Gorsen ![]() Peter Gorsen (* 1933 Danzig, Pommern, heute Polen) ist ein Kunstwissenschaftler, der nach Lehraufträgen in Frankfurt am Main und Gießen von 1977 bis 2002 als Professor für Kunstgeschichte an der Universität für angewandte Kunst in Wien tätig war. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Themen der Sexualästhetik sowie das Verhältnis von Kunst und Krankheit. , der damals in Frankfurt mit Volkmar Sigusch
Peter Gorsen (* 1933 Danzig, Pommern, heute Polen) ist ein Kunstwissenschaftler, der nach Lehraufträgen in Frankfurt am Main und Gießen von 1977 bis 2002 als Professor für Kunstgeschichte an der Universität für angewandte Kunst in Wien tätig war. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Themen der Sexualästhetik sowie das Verhältnis von Kunst und Krankheit. , der damals in Frankfurt mit Volkmar Sigusch ![]() Volkmar Sigusch (* 1940 Bad Freienwalde) ist ein deutscher Sexualwissenschaftler, der als Begründer der Sexualmedizin im deutschsprachigen Raum gilt. Von 1972 bis 2006 war er Professor und später Direktor am Institut für Sexualwissenschaft der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. an der Uni für Sexualforschung unterwegs war. Er hat bei Rogner & Bernhard eines der schönsten Bücher über Molinier herausgegeben.
Volkmar Sigusch (* 1940 Bad Freienwalde) ist ein deutscher Sexualwissenschaftler, der als Begründer der Sexualmedizin im deutschsprachigen Raum gilt. Von 1972 bis 2006 war er Professor und später Direktor am Institut für Sexualwissenschaft der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. an der Uni für Sexualforschung unterwegs war. Er hat bei Rogner & Bernhard eines der schönsten Bücher über Molinier herausgegeben. ![]() Peter Gorsen, „Molinier. lui-même“, München 1972. Durch ihn bin ich überhaupt erst auf Molinier aufmerksam geworden. Also im ganzen Umfang. Ich hatte in einem Buch über den Surrealismus vorher schon mal ein paar kleine Abbildungen gesehen. Und dann gibt es natürlich immer tolle Zufälle: In Stuttgart hatte ich einmal eine Ausstellung in der legendären Buchhandlung Niedlich, und dort traf ich an einem Abend auf die Verleger Rogner – Rogner & Bernhard –, Matthes – Matthes & Seits –, HA Glaser, Literaturwissenschaftler, und Michael Krüger vom Hanser Verlag, also richtig tolle Leute. Das wurde ein schöner und langer Abend mit interessanten Gesprächen und viel Alkohol. Kommerziell waren meine Arbeiten wie gesagt kein Schlager, aber von der Journaille, und zum Teil und auch von der Kunstwissenschaft, wurde das ernst genommen und polarisierte heftig.
Peter Gorsen, „Molinier. lui-même“, München 1972. Durch ihn bin ich überhaupt erst auf Molinier aufmerksam geworden. Also im ganzen Umfang. Ich hatte in einem Buch über den Surrealismus vorher schon mal ein paar kleine Abbildungen gesehen. Und dann gibt es natürlich immer tolle Zufälle: In Stuttgart hatte ich einmal eine Ausstellung in der legendären Buchhandlung Niedlich, und dort traf ich an einem Abend auf die Verleger Rogner – Rogner & Bernhard –, Matthes – Matthes & Seits –, HA Glaser, Literaturwissenschaftler, und Michael Krüger vom Hanser Verlag, also richtig tolle Leute. Das wurde ein schöner und langer Abend mit interessanten Gesprächen und viel Alkohol. Kommerziell waren meine Arbeiten wie gesagt kein Schlager, aber von der Journaille, und zum Teil und auch von der Kunstwissenschaft, wurde das ernst genommen und polarisierte heftig.
Sie haben eben den Feminismus angesprochen. Es gibt ein Tableau aus der Serie der „Formalisierung der Langeweile“ ![]() Jürgen Klauke, „Formalisierung der Langeweile“, 1980/81. , das heißt „Das ewig männliche – als ewig langweiliges“
Jürgen Klauke, „Formalisierung der Langeweile“, 1980/81. , das heißt „Das ewig männliche – als ewig langweiliges“ ![]() Jürgen Klauke, „Das ewig männliche – als ewig langweiliges“ (Tafel IV der Serie „Formalisierung der Langeweile“), 1980/81.
Jürgen Klauke, „Das ewig männliche – als ewig langweiliges“ (Tafel IV der Serie „Formalisierung der Langeweile“), 1980/81. 
![]() Alice Schwarzer (* 1942 Wuppertal) ist eine Journalistin und Publizistin, die vor allem für ihre führende Rolle innerhalb der Frauenbewegung bekannt ist. Von 1970 bis 1974 studierte sie unter anderem bei Michel Foucault an der Universität Vincennes in Paris und begann dort eine fortlaufende Interview-Serie mit Simone de Beauvoir. 1975 veröffentlichte sie das Buch „Der kleine Unterschied und seine großen Folgen“, das als wegweisender Impuls für die feministische Emanzipationsbewegung in Deutschland gilt. Seit 1977 ist Schwarzer Verlegerin und Chefredakteurin der Zeitschrift „Emma“, die sich auf übergreifende Fragen der gesellschaftlichen Gleichstellung und Unabhängigkeit der Frau konzentriert. in der Zeit arbeitete. Es gab an den Werkschulen damals die Veranstaltung „Sexualität und Gewalt in der Kunst“, organisiert von zwei Jungphilosophen der Uni Köln. Auf dem Podium saß unter anderem Alice Schwarzer. Ich hatte Karl Marx, den damaligen Direktor, im Vorfeld gewarnt: „Nehmen Sie sich Frau Schwarzer einmal zur Seite. Ich weiß, dass sie rücksichtslos agieren kann, und dann geht alles in Scherben. Das ist ein so sensibles Thema – Gewalt, Sexualität in der Kunst –, das kann man sehr schnell kaputt machen.“ Die beiden haben sich also vorher unterhalten – sie war lammfromm –, aber es kam, wie es kommen musste: Sie hatte circa 20 geprügelte Mädchen aus dem Frauenhaus von der anderen Rheinseite mitgebracht und die schmissen irgendwann mit Würstchen und brüllten irgendeinen Käse vor sich hin, sodass junge Wissenschaftlerinnen die Schwarzer dann ins Gebet nehmen mussten. Es war eine denkwürdige Veranstaltung.
Alice Schwarzer (* 1942 Wuppertal) ist eine Journalistin und Publizistin, die vor allem für ihre führende Rolle innerhalb der Frauenbewegung bekannt ist. Von 1970 bis 1974 studierte sie unter anderem bei Michel Foucault an der Universität Vincennes in Paris und begann dort eine fortlaufende Interview-Serie mit Simone de Beauvoir. 1975 veröffentlichte sie das Buch „Der kleine Unterschied und seine großen Folgen“, das als wegweisender Impuls für die feministische Emanzipationsbewegung in Deutschland gilt. Seit 1977 ist Schwarzer Verlegerin und Chefredakteurin der Zeitschrift „Emma“, die sich auf übergreifende Fragen der gesellschaftlichen Gleichstellung und Unabhängigkeit der Frau konzentriert. in der Zeit arbeitete. Es gab an den Werkschulen damals die Veranstaltung „Sexualität und Gewalt in der Kunst“, organisiert von zwei Jungphilosophen der Uni Köln. Auf dem Podium saß unter anderem Alice Schwarzer. Ich hatte Karl Marx, den damaligen Direktor, im Vorfeld gewarnt: „Nehmen Sie sich Frau Schwarzer einmal zur Seite. Ich weiß, dass sie rücksichtslos agieren kann, und dann geht alles in Scherben. Das ist ein so sensibles Thema – Gewalt, Sexualität in der Kunst –, das kann man sehr schnell kaputt machen.“ Die beiden haben sich also vorher unterhalten – sie war lammfromm –, aber es kam, wie es kommen musste: Sie hatte circa 20 geprügelte Mädchen aus dem Frauenhaus von der anderen Rheinseite mitgebracht und die schmissen irgendwann mit Würstchen und brüllten irgendeinen Käse vor sich hin, sodass junge Wissenschaftlerinnen die Schwarzer dann ins Gebet nehmen mussten. Es war eine denkwürdige Veranstaltung.
Wie sind Sie damals mit den Institutionen in Kontakt getreten?
Meine ersten Ausstellungen fanden in Holland oder in der Schweiz statt. Kleine Galerieausstellungen. ![]() Die ersten Einzelausstellungen Jürgen Klaukes fanden in der Galerie Kochs (Köln, 1973), der Galerie De Appel (Amsterdam, 1975), der Galerie Venster (Rotterdam, 1975) sowie der Galerie Li Tobler (Zürich, 1975) statt. Die erste institutionelle Ausstellung, die Wirkung zeigte, war die bereits genannte mit den sechs Künstlern aus Köln, im Kölner Kunstverein.
Die ersten Einzelausstellungen Jürgen Klaukes fanden in der Galerie Kochs (Köln, 1973), der Galerie De Appel (Amsterdam, 1975), der Galerie Venster (Rotterdam, 1975) sowie der Galerie Li Tobler (Zürich, 1975) statt. Die erste institutionelle Ausstellung, die Wirkung zeigte, war die bereits genannte mit den sechs Künstlern aus Köln, im Kölner Kunstverein. ![]() „Bernhard Blume, Jürgen Klauke, Falko Marx, Rune Mields, C.O. Paeffgen, H.G. Prager“, Kölnischer Kunstverein, Köln, 09. November 1975 – 11. Januar 1976. Uwe Schneede, der damals den Hamburger Kunstverein leitete, wurde dadurch auf mich aufmerksam und nahm später meine Fotoarbeiten in seine Ausstellung „Sequenzen“. Den wunderbaren Ernst Brücher, den Chef des Kunstbuchverlags DuMont, lernte ich bei dieser Gelegenheit auch kennen. Er unterstützte mich auf seine lässige, selbstverständliche Art. Wir wurden „Tag und Nacht“-Freunde, bis zu seinem Tod. Zeitgleich mit den ersten Galeriekontakten gab ich mit dem ehemaligen Studienkollegen Rudolf Bonvie eine Reihe mit dem Namen „Kunststoff“ heraus. Wir haben immerhin sechs Publikationen herausgegeben. Sie dienten uns selbst als Schaufenster oder Öffentlichkeitsarbeit, und wir luden außerdem Gleichgesinnte ein mitzumachen. Da wir zu dieser Zeit zeichnerisch sowie fotografisch sehr sequenziell arbeiteten, bot sich die Buchform als alternativer Ausstellungsort gewissermaßen an.
„Bernhard Blume, Jürgen Klauke, Falko Marx, Rune Mields, C.O. Paeffgen, H.G. Prager“, Kölnischer Kunstverein, Köln, 09. November 1975 – 11. Januar 1976. Uwe Schneede, der damals den Hamburger Kunstverein leitete, wurde dadurch auf mich aufmerksam und nahm später meine Fotoarbeiten in seine Ausstellung „Sequenzen“. Den wunderbaren Ernst Brücher, den Chef des Kunstbuchverlags DuMont, lernte ich bei dieser Gelegenheit auch kennen. Er unterstützte mich auf seine lässige, selbstverständliche Art. Wir wurden „Tag und Nacht“-Freunde, bis zu seinem Tod. Zeitgleich mit den ersten Galeriekontakten gab ich mit dem ehemaligen Studienkollegen Rudolf Bonvie eine Reihe mit dem Namen „Kunststoff“ heraus. Wir haben immerhin sechs Publikationen herausgegeben. Sie dienten uns selbst als Schaufenster oder Öffentlichkeitsarbeit, und wir luden außerdem Gleichgesinnte ein mitzumachen. Da wir zu dieser Zeit zeichnerisch sowie fotografisch sehr sequenziell arbeiteten, bot sich die Buchform als alternativer Ausstellungsort gewissermaßen an.
Der Frankfurter Jumbo-Pilot Gunter Göring schrieb damals Gedichte und Romane, die er „Flugmüll“ nannte und selbst verlegte. Ein großartiger Typ. Ich glaube, er geriet über den Frankfurter Künstler Vollrad Kutscher in mein Umfeld. Er hat zwei wichtige Bücher von mir verlegt: „Die Schwarz-Weiß-Sequenzen 1972 – 1980“ sowie „Sekunden. Tageszeichnungen 1975–1976“. Lischka wiederum gab in Bern die Reihe „Der Löwe“ heraus, wo er die Kunst und Kunstwissenschaft der Zeit abbildete. Jedes Heft bündelte ein Thema – ich erinnere mich an eine Ausgabe, etwa Mitte der 70er-Jahre, darin waren Klauke, Blume, Friederike Pezold, Jochen Gerz und Peter Weibel sowie ein Essay des Semiotikers Umberto Eco versammelt. Und Fritz Heubach verlegte in Köln die legendären „Interfunktionen“, in denen ich zum Beispiel die ersten Zeichnungen von Günter Brus sah. Ich halte das für erwähnenswert, da es eine weitere Möglichkeit der Sichtbarmachung war und auch ein Phänomen dieser Zeit.
Wie kamen Galerien aus der Schweiz oder aus Holland auf Sie?
In der Zeit bin ich fast jedes Wochenende nach Holland gefahren und war auch mal länger dort. Laysiepen arbeitete ja für Polaroid, er machte Stadtreportagen, das war sein Job. Manfred Heiting, damals ein junger Mann, war der Manager für Europa. Der fütterte uns mit Polaroidfilmen. Sonst hätten wir uns das gar nicht leisten können. Die waren damals noch ziemlich teuer. Über Polaroid bin ich überhaupt erst zur Fotoarbeit gekommen. Mein erstes Buch „Ich+Ich“ ![]() Jürgen Klauke, „Ich+Ich“, 1970/2000.
Jürgen Klauke, „Ich+Ich“, 1970/2000.  , das waren alles Polaroidfotos. Da machte ich später Zwischennegative, um auf ein 50 x 60-Format zu kommen.
, das waren alles Polaroidfotos. Da machte ich später Zwischennegative, um auf ein 50 x 60-Format zu kommen.
Eine weitere wichtige Ausstellung war in Luzern die berühmte, legendäre Ausstellung „Transformer“ von Jean-Christophe Ammann, die anschließend hier in Bochum gezeigt wurde. ![]() „Transformer. Aspekte der Travestie“, Kunstmuseum Luzern, 17. März – 15. April 1974. Damals habe ich Lischka kennengelernt. Das ist eine Freundschaft, die heute noch besteht. Harry Szeemann
„Transformer. Aspekte der Travestie“, Kunstmuseum Luzern, 17. März – 15. April 1974. Damals habe ich Lischka kennengelernt. Das ist eine Freundschaft, die heute noch besteht. Harry Szeemann ![]() Harald Szeemann (1933 Bern – 2005 Tegna im Tessin, Schweiz) war von 1961 bis 1969 als Direktor an der Kunsthalle Bern tätig. Dort zeigte er 1969 die wegweisende Ausstellung „Live in Your Head. When Attitudes Become Form“. Szeemann leitete 1972 die „documenta 5“ und organisierte die Ausstellung „Junggesellenmaschinen“, die ab 1975 an neun Ausstellungsorten in Europa, darunter in der Kunsthalle Bern, der Kunsthalle Düsseldorf, der Kunsthalle Malmö und dem Stedelijk Museum Amsterdam, zu sehen war. 1983 folgte die Ausstellung „Der Hang zum Gesamtkunstwerk“, die für das Kunsthaus Zürich konzipiert war und anschließend nach Wien, Düsseldorf und Berlin reiste. 1999 und 2001 kuratierte Szeemann die Themenausstellungen der Biennale von Venedig. Mit seinen innovativen Ausstellungsformaten zählt er zu den wichtigsten Vermittlern der Kunst seiner Zeit. war natürlich unübersehbar und dann habe ich in Bern noch Toni Gerber kennengelernt. Er spielte damals eine große Rolle und hat unter anderem Achim Duchow, Polke, Buthe und so weiter ausgestellt. In der Schweiz habe ich mir die Nächte um die Ohren geschlagen. Das war ja damals Timothy-Leary
Harald Szeemann (1933 Bern – 2005 Tegna im Tessin, Schweiz) war von 1961 bis 1969 als Direktor an der Kunsthalle Bern tätig. Dort zeigte er 1969 die wegweisende Ausstellung „Live in Your Head. When Attitudes Become Form“. Szeemann leitete 1972 die „documenta 5“ und organisierte die Ausstellung „Junggesellenmaschinen“, die ab 1975 an neun Ausstellungsorten in Europa, darunter in der Kunsthalle Bern, der Kunsthalle Düsseldorf, der Kunsthalle Malmö und dem Stedelijk Museum Amsterdam, zu sehen war. 1983 folgte die Ausstellung „Der Hang zum Gesamtkunstwerk“, die für das Kunsthaus Zürich konzipiert war und anschließend nach Wien, Düsseldorf und Berlin reiste. 1999 und 2001 kuratierte Szeemann die Themenausstellungen der Biennale von Venedig. Mit seinen innovativen Ausstellungsformaten zählt er zu den wichtigsten Vermittlern der Kunst seiner Zeit. war natürlich unübersehbar und dann habe ich in Bern noch Toni Gerber kennengelernt. Er spielte damals eine große Rolle und hat unter anderem Achim Duchow, Polke, Buthe und so weiter ausgestellt. In der Schweiz habe ich mir die Nächte um die Ohren geschlagen. Das war ja damals Timothy-Leary ![]() Timothy Francis Leary (1920 Springfield, Massachusetts – 1996 Beverly Hills, CA) war ein US-amerikanischer Psychologe, der Anfang der 60er-Jahre durch seine wissenschaftlichen Experimente mit bewusstseinserweiternden Substanzen international bekannt wurde. Leary trat öffentlich für den freien Zugang zu psychedelischen Drogen ein. -Gebiet, also gab es auch schöne Trips. Es war hochtoxisch und wunderbar, exotisch – eben die Schweiz.
Timothy Francis Leary (1920 Springfield, Massachusetts – 1996 Beverly Hills, CA) war ein US-amerikanischer Psychologe, der Anfang der 60er-Jahre durch seine wissenschaftlichen Experimente mit bewusstseinserweiternden Substanzen international bekannt wurde. Leary trat öffentlich für den freien Zugang zu psychedelischen Drogen ein. -Gebiet, also gab es auch schöne Trips. Es war hochtoxisch und wunderbar, exotisch – eben die Schweiz.
Warum war das in der Schweiz eigentlich so?
So genau kann ich Ihnen das auch nicht sagen. Das Allerschärfste war, als Zürich die Fixer-Belagerungen hatte. Das fand ich großartig. Die vergoldete Schweiz hatte plötzlich diesen Ausnahmezustand. Das war ja unübersehbar, welch ein Kontrast zu dem Luxus. Die Schweiz ist so ein verwöhntes Land mit sehr verwöhnten Kindern, die ihre Konsumgewohnheiten dann sehr geradlinig auf den Drogenkonsum ausdehnten – die Folgen sind bekannt.
Drogen, überhaupt das Toxische, Alkohol – wie sehr ist das in den Arbeitsprozess mit eingeflossen?
Es gab in der Zeit aus Amerika Bücher über LSD-Kunst. Buntes, überbordendes Zeug, das mehr als schwachsinnig daherkam – sozusagen negativer Ausfluss. Man spürt im Werk eines Künstlers ja auch den Niederschlag anderer intensiver Lebenserfahrungen, LSD kann eine Erfahrung sein – nicht mehr und nicht weniger.
Inwiefern wurde die Bewusstseinsveränderung oder -erweiterung zur Voraussetzung für das kreative Arbeiten?
Das sind Begleitumstände, keine Voraussetzung. Ich war ja nicht bewusstseinserweitert und habe plötzlich ganz tolle Sachen gemacht. Es gab diese blöden LSD-Experimente mit Künstlern in München – ich glaube in der Galerie Hartman – unter ärztlicher Aufsicht. Das ist aber wirklich Quatsch. Ich habe in einem Lokal ein Pärchen beobachtet, die saßen dort ungefähr ein Jahr lang und grinsten. So etwas ist mir nie gelungen. Auch auf LSD nicht. Die waren so doof, da gab es kein Bewusstsein, was verändert werden konnte, die fühlten sich einfach nur gut. Vielleicht haben sie auch ein paar Spektralfarben gesehen. Aber ich war immer eher mit meiner Existenz beschäftigt. Ich hatte Horrortrips, gigantisch! Wenn man die überlebt hat, ist das schon was! Das sind Erfahrungen in einer anderen Dimension. Oder zum Beispiel Sexualität auf LSD, da könnten Sie sich Sexualität ohne LSD fast abgewöhnen. Das ist ein körperliches Ausdehnen, das ist nicht zu fassen! LSD oder Peyote haben ja eine ganze Reihe von Kulturen beglückt, warum nicht ab und an auch uns?
Wenn Sie diese Erfahrung machen und darauf aufbauend mit Ihrem Werk einen gesellschaftlichen Anspruch formulieren, der sich an die graue Gesellschaft richtet, kann es dann überhaupt verstanden werden? Von einer Gruppe, die diese Erfahrungen gar nicht gemacht hat? Gibt es da nicht eine Diskrepanz?
Nein, wieso? Ich habe doch nicht ein Plakat vor mir hergetragen, dass ich dies oder jenes zu mir nehme. Und die Gesellschaft, von der Sie sprechen – Sie sind ja in Frankfurt: Die Banker und die Börse sind dermaßen zugekokst ... Wenn Sie die Kilos schleppen müssten, hätten Sie viel zu tun. Es ist nicht so, dass die Kunstszene mit dem Konsum von bewusstseinserweiternden Drogen eine Ausnahme ist. Die haben andere Leute auch genommen. Als Erfahrungswert, wie andere Lebenserfahrungen oder sinnliche Erfahrungen auch, können sie für einen Künstler zusätzlich hilfreich und erkenntnisreich sein. Das Ganze kann aber auch großartig in die Hose gehen.
Sie haben sich in Ihren Arbeiten mit Ihrer Existenz und mit persönlichen Erfahrungen beschäftigt. Viele deutsche Künstler haben sich zur gleichen Zeit mit der unmittelbaren politischen Vergangenheit auseinandergesetzt. Georg Baselitz und Eugen Schönebeck, genauso wie Anselm Kiefer oder auch die ZERO-Künstler. Joseph Beuys sowieso. Inwiefern hat die Nachkriegszeit Sie damals beschäftigt?
Ist mir bei ZERO nicht bewusst oder ist mir da etwas entgangen? Die Nachkriegszeit beschäftigt mich heute noch, aber nicht als Illustration in meinem Werk, auch tagespolitische Statements werden Sie dort vergeblich suchen. Und trotzdem haben bestimmte Aspekte meiner Arbeit etwas Politisches. Das Grauen, das wir angerichtet haben, sollte immer wieder in unser Bewusstsein zurückgeholt werden. Ich arbeite aber auf andere Art und Weise: über die Wiederholung des ewig Gleichen. Obwohl wir uns technisch oder geistig anscheinend weiterentwickeln, bleiben bestimmte Dinge konstant. Unsere Hoffnungen, unser Begehren, die Nichterfüllung derselben. Diese Leerstellen, die kurzen Glücksmomente, das Wissen um unsere Endlichkeit, die Kältezonen, die dazwischen lauern – das fasziniert mich. Dazu möchte ich Bilder schöpfen. Wenn man meine Arbeit genauer betrachtet, erkennt man auch das Gesellschaftspolitische darin. Das Umgehen mit der Geschichte in der Kunst kann sehr illustrativ sein. Die Ästhetisierung des Grauens benötigt mehr. Was Baselitz angeht, so sehe ich da immer eher die malerische Geste im Vordergrund. Es war die Zeit, als Abstraktion und Informel im Mittelpunkt standen. Erst allmählich, mit der Studentenbewegung, begannen auch die Bewegungen in der Kunst und in der Literatur. Politik wurde ein Thema der Kunst. Ein Beispiel dafür ist Wolf Vostell, der sehr politisch agierte und arbeitete. Beuys ist dagegen an manchen Stellen fast pseudoreligiös und manchmal auch esoterisch. Aber immer etwas geheimnisvoll. Beuys war eine Figur, die einen anregte. Bei seinen ersten Performances fragte man sich: „Was macht der Mann da?“ Diese Verunsicherung war inspirierend.
Wo haben Sie Beuys in Aktion gesehen?
In Venedig haben wir mit ihm Spaß gehabt. Ein sehr fröhlicher Mann. Was man ihm gar nicht zutraut. 1980 hat Harry Szeemann die Biennale in Venedig gemacht. Von mir war der Werkblock „Viva España“ ![]() Jürgen Klauke, „Viva España“, 1976/1979. , 14 Großformate, bei der „Aperto“ ausgestellt. Beuys hatte eine Rieseninstallation gebaut, die wie ein großes Gemälde war.
Jürgen Klauke, „Viva España“, 1976/1979. , 14 Großformate, bei der „Aperto“ ausgestellt. Beuys hatte eine Rieseninstallation gebaut, die wie ein großes Gemälde war. ![]() Joseph Beuys zeigte auf der Biennale von Venedig 1980 „Das Kapital Raum 1970–1977“. Die Arbeit besteht aus 50 beschriebenen Schultafeln sowie 30 weiteren Objekten, darunter Projektoren, Mikrofone und ein Konzertflügel. Und als wir da so herumstanden, sagte er: „Komm, wir gehen mal dort an die Mauer und lecken daran.“ Wie an einem Salzstollen. Er wollte ein bisschen Aufmerksamkeit erregen und wir fanden es lustig. Für solche Aktionen war er immer zu haben. Er war ja in jeglicher Form ein Selbstdarsteller: die Fußwaschungen, der Boxkampf, die Kanufahrt … Das war ja mehr als religiös.
Joseph Beuys zeigte auf der Biennale von Venedig 1980 „Das Kapital Raum 1970–1977“. Die Arbeit besteht aus 50 beschriebenen Schultafeln sowie 30 weiteren Objekten, darunter Projektoren, Mikrofone und ein Konzertflügel. Und als wir da so herumstanden, sagte er: „Komm, wir gehen mal dort an die Mauer und lecken daran.“ Wie an einem Salzstollen. Er wollte ein bisschen Aufmerksamkeit erregen und wir fanden es lustig. Für solche Aktionen war er immer zu haben. Er war ja in jeglicher Form ein Selbstdarsteller: die Fußwaschungen, der Boxkampf, die Kanufahrt … Das war ja mehr als religiös. ![]() Die Aktion „Celtic+“, die am 06. April 1971 in Zivilschutzräumen in Basel stattfand, begann Joseph Beuys mit einer Fußwaschung an sieben Personen. Am 08. Oktober 1972, dem letzten Tag der „documenta 5“, trat Beuys im Fridericianum gegen seinen Schüler Abraham David Christian zum Boxkampf „für die Demokratie durch Volksabstimmung“ an und gewann. Am 20. Oktober 1973 überquerte Beuys in einem Einbaum, von seinem Schüler Anatol Herzfeld gefertigt, den Rhein. Die „Heimholung“ war eine symbolische Aktion der Studenten, um Beuys an die Akademie Düsseldorf zurückzuholen.
Die Aktion „Celtic+“, die am 06. April 1971 in Zivilschutzräumen in Basel stattfand, begann Joseph Beuys mit einer Fußwaschung an sieben Personen. Am 08. Oktober 1972, dem letzten Tag der „documenta 5“, trat Beuys im Fridericianum gegen seinen Schüler Abraham David Christian zum Boxkampf „für die Demokratie durch Volksabstimmung“ an und gewann. Am 20. Oktober 1973 überquerte Beuys in einem Einbaum, von seinem Schüler Anatol Herzfeld gefertigt, den Rhein. Die „Heimholung“ war eine symbolische Aktion der Studenten, um Beuys an die Akademie Düsseldorf zurückzuholen.
Inwiefern waren die Aktionen von Beuys inszeniert und wie authentisch war er wirklich?
Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ist mir das egal. Für mich ist entscheidend, was er gemacht hat. Das ist ähnlich aber noch mal ein ganz anderes Thema wie mit Knut Hamsun oder Louis-Ferdinand Céline, die ganz böse Jungs waren, wenn es um Faschismus und Rassismus ging. ![]() Mit ihren Romanen „Reise ans Ende der Nacht“ (Paris, 1932) und „Hunger“ (Kopenhagen, 1890) zählen die Schriftsteller Louis-Ferdinand Céline (1894 Courbevoie, Frankreich – 1961 Meudon, Frankreich) und Knut Hamsun (1859 Garmo, Norwegen – 1952 Nørholm, Norwegen) zu den bedeutendsten Romanciers des frühen 20. Jahrhunderts. Beide Autoren engagierten sich ab den 30er-Jahren aktiv für Adolf Hitler und die Ziele des nationalsozialistischen Regimes. Siehe auch: Philipp Wascher, „Louis-Ferdinand Céline und Deutschland. Rezeptionsgeschichte der Jahre 1932–1961“, Berlin 2005, sowie Sten Sparre Nilson, „Knut Hamsun und die Politik“, Düsseldorf 1964. Aber die „Reise ans Ende der Nacht“ oder „Hunger“ sind Bücher, da fliegt Ihnen das Gehirn weg. Das sind Literaturbereicherungen der Sonderklasse. Und da muss ich sagen: „Drecksack“, aber wirklich erste Sahne. Ich kann das sehr gut trennen. Im Fall von Beuys kann mal jemand, der viel Zeit hat, nachforschen und mal nach Sibirien fahren und schauen, ob er noch Zeugen findet. Natürlich kann es sein, dass er die Legende selbst gebildet hat. Aber was soll’s? Es ist keine moralische Veranstaltung.
Mit ihren Romanen „Reise ans Ende der Nacht“ (Paris, 1932) und „Hunger“ (Kopenhagen, 1890) zählen die Schriftsteller Louis-Ferdinand Céline (1894 Courbevoie, Frankreich – 1961 Meudon, Frankreich) und Knut Hamsun (1859 Garmo, Norwegen – 1952 Nørholm, Norwegen) zu den bedeutendsten Romanciers des frühen 20. Jahrhunderts. Beide Autoren engagierten sich ab den 30er-Jahren aktiv für Adolf Hitler und die Ziele des nationalsozialistischen Regimes. Siehe auch: Philipp Wascher, „Louis-Ferdinand Céline und Deutschland. Rezeptionsgeschichte der Jahre 1932–1961“, Berlin 2005, sowie Sten Sparre Nilson, „Knut Hamsun und die Politik“, Düsseldorf 1964. Aber die „Reise ans Ende der Nacht“ oder „Hunger“ sind Bücher, da fliegt Ihnen das Gehirn weg. Das sind Literaturbereicherungen der Sonderklasse. Und da muss ich sagen: „Drecksack“, aber wirklich erste Sahne. Ich kann das sehr gut trennen. Im Fall von Beuys kann mal jemand, der viel Zeit hat, nachforschen und mal nach Sibirien fahren und schauen, ob er noch Zeugen findet. Natürlich kann es sein, dass er die Legende selbst gebildet hat. Aber was soll’s? Es ist keine moralische Veranstaltung.
Die Amerikaner haben ihn auch lange nicht verstanden. Das Mythische war für sie schwer nachvollziehbar. Das arme Material, die vielen Geschichten, die er da eingebaut hat – ich glaube Amerika hatte damit ein bisschen Probleme.
Waren Sie in den 70er-Jahren in den USA?
Ich war ein paar Mal in New York, klar. Aber mehr im CBGB und Max’s Kansas City. ![]() Das Max’s Kansas City (1965–1981) und das CBGB (1973–2006) waren Nachtklubs in Manhattan, New York. Sie galten als populärer Treffpunkt der Kunst- und Musikszene. Musik hören. Dead Boys, Iggy Pop, Suicide et cetera.
Das Max’s Kansas City (1965–1981) und das CBGB (1973–2006) waren Nachtklubs in Manhattan, New York. Sie galten als populärer Treffpunkt der Kunst- und Musikszene. Musik hören. Dead Boys, Iggy Pop, Suicide et cetera.
Dafür sind Sie mehrere Wochen nach New York gefahren?
Ja, unter anderem.
Hatten Sie dort auch Kontakte?
Ja, klar. Ich kannte zum Beispiel Colette. Oder Ruth Marten, die in Los Angeles war und mit Tattoos arbeitete. Die habe ich bei der „Biennale de Jeune“ in Paris kennengelernt. ![]() Colette (eigtl. Colette Justine, * 1952 Tunis) ist eine Schauspielerin und Künstlerin, die ab 1970 zu den frühen Vertreterinnen der Performance Art in New York zählte. Ruth Marten (* 1949 New York) wurde zur selben Zeit vor allem durch ihre Arbeit als Tätowiererin der New Yorker Disco- und Punkszene bekannt. 1977 nahm Marten an der „10. Biennale von Paris“ teil. Dann gab es Alan Vega, den Musiker, und Diego Cortez, das war so ein Zwischending, der war auch hier auf den Performance-Meetings des Kölner Kunstmarkts.
Colette (eigtl. Colette Justine, * 1952 Tunis) ist eine Schauspielerin und Künstlerin, die ab 1970 zu den frühen Vertreterinnen der Performance Art in New York zählte. Ruth Marten (* 1949 New York) wurde zur selben Zeit vor allem durch ihre Arbeit als Tätowiererin der New Yorker Disco- und Punkszene bekannt. 1977 nahm Marten an der „10. Biennale von Paris“ teil. Dann gab es Alan Vega, den Musiker, und Diego Cortez, das war so ein Zwischending, der war auch hier auf den Performance-Meetings des Kölner Kunstmarkts. ![]() Im Rahmen des Internationalen Kunstmarkts Köln 1977 fand das Performancfestival „Concept in Performance“, kuratiert von Elisabeth Jappe, statt; vgl.: Günter Herzog, „Internationaler Kunstmarkt Köln, Messegelände Köln-Deutz, Rheinhallen (Hallen 1–3, Obergeschosse), 26. Oktober bis 31. Oktober 1977“, in: ders./Brigitte Jacobs van Renswou, „Art Cologne 1967–2016. Die Erste aller Kunstmessen/The First Art Fair“, Ausst.-Kat. Art Cologne, 50. Internationaler Kunstmarkt/Zentralarchiv des internationalen Kunsthandels ZADIK Köln, Köln 2016, S. 126. Da waren dann auch wieder Colette und Ruth Marten sowie Jack Smith, Gordon Matta-Clark und Ulay/Abramović. Abends waren alle bei mir in der Elsaßstraße, wo Jack Smith nach dem Essen eine Spühl-Performance zum Besten gab.
Im Rahmen des Internationalen Kunstmarkts Köln 1977 fand das Performancfestival „Concept in Performance“, kuratiert von Elisabeth Jappe, statt; vgl.: Günter Herzog, „Internationaler Kunstmarkt Köln, Messegelände Köln-Deutz, Rheinhallen (Hallen 1–3, Obergeschosse), 26. Oktober bis 31. Oktober 1977“, in: ders./Brigitte Jacobs van Renswou, „Art Cologne 1967–2016. Die Erste aller Kunstmessen/The First Art Fair“, Ausst.-Kat. Art Cologne, 50. Internationaler Kunstmarkt/Zentralarchiv des internationalen Kunsthandels ZADIK Köln, Köln 2016, S. 126. Da waren dann auch wieder Colette und Ruth Marten sowie Jack Smith, Gordon Matta-Clark und Ulay/Abramović. Abends waren alle bei mir in der Elsaßstraße, wo Jack Smith nach dem Essen eine Spühl-Performance zum Besten gab.
Wer war damals noch in New York? René Block mit seiner kleinen Galerie und der Beuys-Aktion mit dem Kojoten. ![]() Von 1974 bis 1977 betrieb René Block im New Yorker Stadtteil SoHo eine Galerie, wo Joseph Beuys vom 20. bis 25. Mai 1974 eine Aktion unter dem Titel „Joseph Beuys. I Like America and America Likes Me“ zeigte. Damals verbrachte er mehrere Tage mit dem Kojoten Little John in einem Käfig innerhalb der Galerie. Und Rebecca Horn
Von 1974 bis 1977 betrieb René Block im New Yorker Stadtteil SoHo eine Galerie, wo Joseph Beuys vom 20. bis 25. Mai 1974 eine Aktion unter dem Titel „Joseph Beuys. I Like America and America Likes Me“ zeigte. Damals verbrachte er mehrere Tage mit dem Kojoten Little John in einem Käfig innerhalb der Galerie. Und Rebecca Horn ![]() Rebecca Horn (* 1944 Michelstadt) studierte zwischen 1963 und 1972 an der Hochschule für bildende Künste Hamburg und der Saint Martin’s School of Art in London. Seit den frühen 70er-Jahren arbeitet sie vor allem im Bereich der Performance- und Medienkunst. Ihre erste Einzelausstellung fand 1973 in der Galerie René Block in Berlin statt. Sie nahm an zahlreichen internationalen Ausstellungen teil, darunter der Biennale von Venedig (1980, 1986, 1997) und den documenta-Ausstellungen 5 (1972), 6 (1977), 7 (1982) und 9 (1992). Von 1989 bis 2004 war Horn Professorin an der Universität der Künste Berlin. . Die habe ich dort kennengelernt, nicht hier.
Rebecca Horn (* 1944 Michelstadt) studierte zwischen 1963 und 1972 an der Hochschule für bildende Künste Hamburg und der Saint Martin’s School of Art in London. Seit den frühen 70er-Jahren arbeitet sie vor allem im Bereich der Performance- und Medienkunst. Ihre erste Einzelausstellung fand 1973 in der Galerie René Block in Berlin statt. Sie nahm an zahlreichen internationalen Ausstellungen teil, darunter der Biennale von Venedig (1980, 1986, 1997) und den documenta-Ausstellungen 5 (1972), 6 (1977), 7 (1982) und 9 (1992). Von 1989 bis 2004 war Horn Professorin an der Universität der Künste Berlin. . Die habe ich dort kennengelernt, nicht hier.
Wann haben Sie Ihre ersten Arbeiten verkauft?
Das weiß ich nicht so genau. Ich habe immer wieder mal etwas verkauft. Mit den Medien zu arbeiten war ja auch teuer. Das hat sich so peu à peu gefestigt. Ich würde sagen, mit der ersten großen musealen Reihe, „Formalisierung der Langeweile“, die in Luzern, in Graz und hier im Landesmuseum Bonn gezeigt wurde, ![]() Die Ausstellung „Formalisierung der Langweile“ wurde 1981 im Kunstmuseum Luzern und im Rheinischen Landesmuseum in Bonn präsentiert. 1982 folgte eine Präsentation von Klaukes Werken in der Neuen Galerie am Landesmuseum Johanneum, Graz. Vgl. Hans-Michael Herzog „Jürgen Klauke. Prosecuritas“, Ausst.-Kat. Kunsthalle Bielefeld, Bielefeld 1994, S. 115. fing das an. Dann haben auch Museen mal etwas gekauft oder irgendwelche profunden Sammler. Ingvild Goetz
Die Ausstellung „Formalisierung der Langweile“ wurde 1981 im Kunstmuseum Luzern und im Rheinischen Landesmuseum in Bonn präsentiert. 1982 folgte eine Präsentation von Klaukes Werken in der Neuen Galerie am Landesmuseum Johanneum, Graz. Vgl. Hans-Michael Herzog „Jürgen Klauke. Prosecuritas“, Ausst.-Kat. Kunsthalle Bielefeld, Bielefeld 1994, S. 115. fing das an. Dann haben auch Museen mal etwas gekauft oder irgendwelche profunden Sammler. Ingvild Goetz ![]() Ingvild Goetz (* 1941 Kulm, Westpreußen) führte von 1973 bis 1984 die Galerie art in progress in München. Im Anschluss an ihre Galerietätigkeit baute sie weltweit eine der umfangreichsten Sammlungen zur zeitgenössischen Kunst auf, in der die Positionen der Arte Povera, der Young British Artists und der konzeptuellen Fotografie zentrale Schwerpunkte sind. Seit 1993 werden die Sammlungsbestände in einem neu errichteten Museumsgebäude im Münchener Stadtteil Oberföhring präsentiert. hat sehr früh zugeschlagen, ebenso die egozentrische Ingrid Oppenheim, die zeitweilig eine Galerie in Köln betrieb und eine tolle Arbeit machte – ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann ging das so poco a poco.
Ingvild Goetz (* 1941 Kulm, Westpreußen) führte von 1973 bis 1984 die Galerie art in progress in München. Im Anschluss an ihre Galerietätigkeit baute sie weltweit eine der umfangreichsten Sammlungen zur zeitgenössischen Kunst auf, in der die Positionen der Arte Povera, der Young British Artists und der konzeptuellen Fotografie zentrale Schwerpunkte sind. Seit 1993 werden die Sammlungsbestände in einem neu errichteten Museumsgebäude im Münchener Stadtteil Oberföhring präsentiert. hat sehr früh zugeschlagen, ebenso die egozentrische Ingrid Oppenheim, die zeitweilig eine Galerie in Köln betrieb und eine tolle Arbeit machte – ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann ging das so poco a poco.
Hatten Sie je mit einer Galerie einen Vertrag?
Nein, nie. Erhard Klein hat sehr viel für mich getan. Er ist eine tolle Figur und hatte einige der besten deutschen Künstler um sich vereint. Ein toller Mann: „Hier hast du schon mal 5.000 D-Mark, dann ist Ruhe im Karton. Dann bist du erst mal zufrieden.“ Er wollte nie Ärger. Klein haben wir auch zweimal mit auf Reisen genommen, nach Indonesien und Costa Rica. Das war eine richtige Freundschaft, auch heute noch. Später habe ich mit Hans Mayer gearbeitet, der kann natürlich etwas platzieren. Und auch Helga de Alvear in Madrid und nicht zu vergessen Anita Beckers, die bewegte Frau, und Freund Guido Baudach.
Ab wann konnten Sie von Ihrer Kunst leben? Beziehungsweise wie haben Sie sich überhaupt am Anfang finanziert?
Am Anfang habe ich mir eine Druckmaschine angeschafft, weil ich selbst Spaß daran hatte. Darauf habe ich unter anderem die „Tageszeichnungen und Polaroids“ mit Radierungen realisiert sowie einige Mappenwerke. ![]() Jürgen Klauke, „Tageszeichnungen, Zeichnungen und Polaroids (als Originalradierung gedruckt)“, Selbstverlag/Constantin Post, Köln 1975; Jürgen Klauke, „FAG – HAG. Tageszeichnungen 1974“, Verlag Galerie ak, Frankfurt 1976; vgl. ebd., S. 117. Und dann schleppte mir Hannes Jähn, ein berühmter Buchgestalter hier aus Köln, mit dem ich befreundet war, Herrn Wewerka, den schrägen Stefan, ins Atelier. Ich glaube, für den habe ich das gesamte grafische Œuvre, Radierungen, gedruckt. Damit habe ich das Geld verdient, um zu überleben und mich künstlerisch zu realisieren. Uwe Laysiepen hat das Papier aufgelegt und ich habe die Platten ausgerieben. Stefan saß vorn und war am „radieren“. Der brachte dann auch mal Dieter Roth mit oder schleppte den Fluxus-Künstler Al Hansen an, der zeitweilig auch bei mir wohnte.
Jürgen Klauke, „Tageszeichnungen, Zeichnungen und Polaroids (als Originalradierung gedruckt)“, Selbstverlag/Constantin Post, Köln 1975; Jürgen Klauke, „FAG – HAG. Tageszeichnungen 1974“, Verlag Galerie ak, Frankfurt 1976; vgl. ebd., S. 117. Und dann schleppte mir Hannes Jähn, ein berühmter Buchgestalter hier aus Köln, mit dem ich befreundet war, Herrn Wewerka, den schrägen Stefan, ins Atelier. Ich glaube, für den habe ich das gesamte grafische Œuvre, Radierungen, gedruckt. Damit habe ich das Geld verdient, um zu überleben und mich künstlerisch zu realisieren. Uwe Laysiepen hat das Papier aufgelegt und ich habe die Platten ausgerieben. Stefan saß vorn und war am „radieren“. Der brachte dann auch mal Dieter Roth mit oder schleppte den Fluxus-Künstler Al Hansen an, der zeitweilig auch bei mir wohnte.
Es kamen immer mehr Leute nach Köln. Die kamen und schauten, was wir machten, und wohnten dann zum Teil bei meinem Freund, Dietmar Werle ![]() Dietmar Werle war von 1970 bis 1973 als Assistent in der Kölner Galerie Ingo Kümmel beschäftigt. Er übernahm die Galerie Möllenhof/Greve, bis er Anfang der 80er-Jahre die Galerie Moderne Kunst Dietmar Werle in Köln gründete. Bis zur Schließung der Galerie im Jahr 1996 zeigte er vor allem Gegenwartskunst rheinländischer Künstler, darunter Joseph Beuys, Michael Buthe, Jürgen Klauke und Sigmar Polke. , der eine Galerie hatte und mit uns arbeitete, aber auch Beuys, Bruce Nauman und andere ausstellte. Julian Schnabel, Cindy Sherman und andere amerikanische Künstler kamen nach Köln und schauten, was hier so passierte. Es war ein gegenseitiges Geben und Nehmen, und dann wuchs Köln zu einer Art Hotspot der Kunst. Köln, dieses kleine Städtchen, war plötzlich Weltstadt.
Dietmar Werle war von 1970 bis 1973 als Assistent in der Kölner Galerie Ingo Kümmel beschäftigt. Er übernahm die Galerie Möllenhof/Greve, bis er Anfang der 80er-Jahre die Galerie Moderne Kunst Dietmar Werle in Köln gründete. Bis zur Schließung der Galerie im Jahr 1996 zeigte er vor allem Gegenwartskunst rheinländischer Künstler, darunter Joseph Beuys, Michael Buthe, Jürgen Klauke und Sigmar Polke. , der eine Galerie hatte und mit uns arbeitete, aber auch Beuys, Bruce Nauman und andere ausstellte. Julian Schnabel, Cindy Sherman und andere amerikanische Künstler kamen nach Köln und schauten, was hier so passierte. Es war ein gegenseitiges Geben und Nehmen, und dann wuchs Köln zu einer Art Hotspot der Kunst. Köln, dieses kleine Städtchen, war plötzlich Weltstadt.
In den 70er-Jahren kann man vielleicht schon von einem sogenannten Markt für die Kunst in Deutschland sprechen. Ende der 70er-Jahre weitet sich dieser Markt auf das Ausland aus, vor allem auf die USA.
Sie sprechen jetzt die wilde Malerei an? Das war, glaube ich, auch zum Teil ein Händlerspiel. Man hat denen ja gewissermaßen auf die Sprünge geholfen. In Italien hatte Arte Cifra oder die Transavanguardia gezeigt, wie es geht, und dank Giancarlo Politi den Kurator neu definiert. Da ging die Post ab. Das hieß pinseln, trocken föhnen und verkaufen. Oft hieß es, in den Galerien ist alles verkauft, was auch nicht immer stimmte, aber es heizte den Markt an. In Köln gehörten unter anderem Adamski, Dokoupil und Dahn dazu. In Berlin Salomé, Rainer Fetting und die Hamburger, Albert Oehlen, Werner Büttner und Kippi [Martin Kippenberger], der zwar kein Hamburger war, aber mit denen befreundet. Für viele Galerien war diese Bewegung wie eine Frischzellenkur. Sie hatten ja in ihren Asservatenkammern noch den ganzen Spätexpressionismus, Informel, Abstraktion und alles Mögliche stehen. Und dadurch, dass plötzlich Malerei wieder aktuell war, konnten diese Schätze aus den Kellern auch wieder gehoben werden.
Gab es damals Vorbehalte gegenüber der deutschen Kunst?
Ich habe zum Beispiel in Paris bei Xiane Germain ausgestellt und bei Bama ![]() „Jürgen Klauke“, Galerie Bama, Paris, 21. März – 09. Mai 1987. . Sie wurde in Paris die „Rote Kapelle“ genannt, weil sie so deutschfreundlich war. Sie zeigte damals Polke, Buthe und meine Wenigkeit. Ich glaube sogar Charly Banana. Ich habe Vorbehalte der deutschen Kunst gegenüber nicht feststellen können. Das liegt ja häufig an einem selbst oder an den Galerien, mit denen man arbeitet. Ich habe in der Schweiz noch mit verschiedenen Leuten, STAMPA, Li Tobler oder Pablo Stähli, gearbeitet, und in Österreich wurde die „Formalisierung der Langeweile“ bei Grita Insam in Wien gezeigt. Der Markt wurde internationaler – auch durch die ersten Kunstmärkte. Und das Interesse an meiner Arbeit hat peu à peu zugenommen.
„Jürgen Klauke“, Galerie Bama, Paris, 21. März – 09. Mai 1987. . Sie wurde in Paris die „Rote Kapelle“ genannt, weil sie so deutschfreundlich war. Sie zeigte damals Polke, Buthe und meine Wenigkeit. Ich glaube sogar Charly Banana. Ich habe Vorbehalte der deutschen Kunst gegenüber nicht feststellen können. Das liegt ja häufig an einem selbst oder an den Galerien, mit denen man arbeitet. Ich habe in der Schweiz noch mit verschiedenen Leuten, STAMPA, Li Tobler oder Pablo Stähli, gearbeitet, und in Österreich wurde die „Formalisierung der Langeweile“ bei Grita Insam in Wien gezeigt. Der Markt wurde internationaler – auch durch die ersten Kunstmärkte. Und das Interesse an meiner Arbeit hat peu à peu zugenommen.
Ein französischer Kritiker sagte einmal, meine Kunst sei nicht sehr deutsch. Der meinte vor allem meine Zeichnungen, meine Gouachen. Das war positiv gemeint. Mit „deutsch“ meint man vielleicht eher Baselitz, Kiefer, Lüpertz. Es gibt natürlich deutsche Themen, bei all den eben genannten. Und bei Kiefer sind sie ja ganz exemplarisch. Da wird es mir dann auch schon mal ein bisschen zu viel Bildungskunst.
Wie veränderte sich mit dem aufstrebenden Kunstmarkt die Kunstszene? Die Galeristen hatten nach dem Krieg die Funktion der Institutionen übernommen, Avantgarde-Kunst gezeigt und Netzwerke geschaffen, während die Museen noch dabei waren sich zu restituieren.
Die Galerien waren Schmela, Fischer, Strelow und Mayer in Düsseldorf und in Köln waren es Zwirner, Stünke, Nickel & Jöllenbeck sowie Reckermann und Werner, die den Ton angaben.
Wobei Zwirner von Anfang an mehr auf den Kunsthandel konzentriert war als auf die Förderung einzelner Künstler, oder?
Schmela hat auch Kunsthandel gemacht. Und wie! Schmela war der Verkäufer! Davon schwärmen sie bis heute: „Hier, dat musste mit nach Haus nehmen. Tu mal die Kohle rüber.“ Der sprach ja so düsseldorferisch. Er hat natürlich in seiner Galerie die Avantgarde gefördert. Und das tat Zwirner ebenso, wenn vielleicht auch nicht in dem Maße. Dafür hat er Kunst aus den USA nach Köln geholt und schließlich auch mich und andere ausgestellt. Er ist also ein Guter.
Wann veränderte sich die Rolle des Galeristen Ihrer Meinung nach?
Der Galerist ist immer Händler, sonst kann er nicht existieren. Es haben aber auch viele auf intellektueller Ebene mit ihrem Publikum kommuniziert und Veranstaltungen gemacht. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine erfolgreicher, der andere weniger erfolgreich. Das ist dann durch die Kunstmärkte natürlich befeuert worden. Es wurde immer deutlicher, dass es ein Geschäft ist, was mit Konkurrenz und mit Ausschluss betrieben wird: Der darf, der darf nicht. Heute sind die Preise auf einem Niveau, das ist nicht mehr nachzuvollziehen. Und ich beharre darauf: Nichts ist 180 Millionen wert. Ich kann mir aber vorstellen, dass irgendwann 200 oder 300 Millionen geboten werden, schließlich will das viele Geld ja ausgegeben oder gewaschen werden. Irgendwann ist der Spuk aber sicher auch vorbei. Für die Museen ist das Ding schon lange gelaufen. Die machen sich jetzt von Sammlern abhängig, die ihnen Dinge anbieten oder reinschieben und ihre Sammlungen in den Museen in Form der Leihgabe veredeln lassen. Alles ist doch mehr oder weniger zu einem knallharten Geschäft geworden. Das wird natürlich zum Teil auch gefeatured. Da tauchen irgendwelche jungen Künstler aus dem Nichts auf und kosten 300.000 oder 400.000 Dollar. Die werden gemacht. Das gab es früher im amerikanischen Galeriebetrieb auch schon. Da stehen ein paar Figuren hinter der Galerie, die das mitfinanzieren, ungefähr so: „Wir geben jetzt mal ein Bild in die Auktion, heben alle die Flossen und schauen, dass es bei zwei Millionen landet. Die zahlen wir selber und dann schieben wir nach.“ Denn dann kommen die Scheichs und die Chinesen und die Russen und wollen das auch haben und dann kann es richtig teuer werden. Als die „Frischware“ zu den Auktionen kam, begann sich der ganze Betrieb desaströs zu verflüssigen.
Gab es das in Deutschland nicht?
Im Kleinen gab es das immer. Das ist ein System, wie man auf Auktionen was hochpuschen kann. Aber das hat natürlich mittlerweile Züge angenommen, die aberwitzig sind.
In den 80er-Jahren florierten die Großausstellungen „Westkunst“, „von hier aus“, in Berlin „Zeitgeist“. ![]() „Westkunst. Zeitgenössische Kunst seit 1939“, Rheinhallen, Köln, 30. Mai – 16. August 1981; „von hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf“, Halle 13 der Messe Düsseldorf, 29. September – 02. Dezember 1984; „Zeitgeist. Internationale Kunstausstellung Berlin 1982“, Martin-Gropius-Bau, Berlin, 16. Oktober 1982 – 16. Januar 1983. Wie haben Sie diese Übersichtsschauen damals wahrgenommen?
„Westkunst. Zeitgenössische Kunst seit 1939“, Rheinhallen, Köln, 30. Mai – 16. August 1981; „von hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf“, Halle 13 der Messe Düsseldorf, 29. September – 02. Dezember 1984; „Zeitgeist. Internationale Kunstausstellung Berlin 1982“, Martin-Gropius-Bau, Berlin, 16. Oktober 1982 – 16. Januar 1983. Wie haben Sie diese Übersichtsschauen damals wahrgenommen?
Diese großen Zusammenfassungen fand ich an sich sehr schön. Da entdeckt man immer noch Dinge, die man verschlafen oder nicht gesehen hat. Bei der „Westkunst“ hatte ich aus der „Langeweile“-Serie eine große Koje und fand es sehr schön zu sehen, wie die sich im Kontext mit den anderen Schwergewichten behaupten konnte.
Eskaliert ist es beim „Bilderstreit“ ![]() „Bilderstreit. Widerspruch, Einheit und Fragment in der Kunst seit 1960“, Museum Ludwig in den Rheinhallen, Köln, 08. April – 28. Juni 1989. 1989. Der Vorwurf war, dass die Ausstellungsmacher sich maßgeblich vom Kunstmarkt haben beeinflussen lassen.
„Bilderstreit. Widerspruch, Einheit und Fragment in der Kunst seit 1960“, Museum Ludwig in den Rheinhallen, Köln, 08. April – 28. Juni 1989. 1989. Der Vorwurf war, dass die Ausstellungsmacher sich maßgeblich vom Kunstmarkt haben beeinflussen lassen.
Diese Vorwürfe gab es bei der documenta ebenso.
Natürlich, gerade bei der documenta von Rudi Fuchs ![]() Rudi Fuchs war künstlerischer Leiter der „documenta 7“ (1982). .
Rudi Fuchs war künstlerischer Leiter der „documenta 7“ (1982). .
Da ist zum Teil auch was dran. Natürlich nimmt der Markt Einfluss. Heute mehr denn je. Davon ist die Kunst nun mal nicht frei. Da setzen bestimmte Leute bestimmte Schwerpunkte und dafür setzen sie sich dann ein. Der Markt spielt unterschwellig immer mit. Aber ebenso Kuratoren, Wissenschaftler, Sammler und alle, die mit dem Betriebssystem Kunst zu tun haben.
Sie wurden von diesen Einfluss nehmenden Galeristen nicht vertreten. Trotzdem hatten Sie Ihre Beteiligung auf der documenta, Sie waren auf der Biennale in Venedig, in der „Westkunst“ und so weiter. Sie haben es ohne diese Art der Unterstützung geschafft. War das ein Grund, dass die Machenschaften anderer Sie relativ kalt gelassen haben?
Nein, das lässt mich überhaupt nicht kalt und natürlich hatte und habe ich eine ganze Reihe von Unterstützern: Museumsleute, Galeristen, Wissenschaftler, Sammler et cetera, sonst gäbe es mich ja nicht. Ich beobachte das und reflektiere es. Ich unterhalte mich mit Kollegen und Galeristen darüber. Aber ich kann es nicht ändern. Ich kann nur meine Souveränität behaupten, und auf die habe ich immer großen Wert gelegt. Daher habe ich mit Galerien nie Verträge gemacht. Manchmal dauert es bei mir auch eine Weile. Hans Mayer hatte mich früher schon einmal gefragt. Da sagte ich: „Ach, nein. Ich bin bei Bugdahn & Kaimer, da bin ich ganz gut aufgehoben.“ Beim zweiten Anlauf habe ich es dann gemacht. Das war wie ein Neuanfang, noch mal mit einem stärkeren Mann. Aber das braucht Zeit. Der erste Blick ist immer: Welche Künstler werden da ausgestellt? Wie sieht das aus? In Köln habe ich schon ewig keine Galerie mehr, bin aber mit Thomas Zander im Gespräch. Diese sogenannte Souveränität hat möglicherweise etwas mehr Arbeit zur Folge, die wird einem mit einer festen Galerie etwas abgenommen. Obwohl es zum Beispiel bei Michael Werner auch ständig Komplikationen gab. Immer Zänkereien. Trotzdem hat man die auch eine Zeit lang beneidet, weil das so ein starker Auftritt war. Die geschlossene Gruppe, die überall zusammen auftauchte. Dagegen muss man sich als Einzelner immer wieder selbst behaupten. Aber mir ist es gelungen, große museale Präsentationen in Japan ![]() Klauke stellte erstmals 1984 im Rahmen der Ausstellung „Toyama Now ’84“ im Museum of Modern Art in Toyama, Japan, aus. 1992 war er in der Ausstellung „Adam & Eve“ im Museum of Modern Art in Saitama vertreten, wo er 1997 erneut in der Einzelausstellung „Phantomempfindung/Phantom Sensation“ sein Werk zeigte. , Russland, Frankreich und vielen anderen Orten zu realisieren. Für mich ist es so, wie es ist, richtig.
Klauke stellte erstmals 1984 im Rahmen der Ausstellung „Toyama Now ’84“ im Museum of Modern Art in Toyama, Japan, aus. 1992 war er in der Ausstellung „Adam & Eve“ im Museum of Modern Art in Saitama vertreten, wo er 1997 erneut in der Einzelausstellung „Phantomempfindung/Phantom Sensation“ sein Werk zeigte. , Russland, Frankreich und vielen anderen Orten zu realisieren. Für mich ist es so, wie es ist, richtig.
1980/81 waren Sie als Gastprofessor in Hamburg. Waren Sie damals vor Ort?
Ja, natürlich! Das war die Vertretung für Polke. Der hat ja immer Freunde für sich arbeiten lassen. Selbst war er nur ein Semester da, glaube ich. Man kam da an einen sehr verwaisten Ort, wo vereinzelt zwei, drei Leute herumsaßen. Es kamen auch noch ein paar Figuren hinzu, mit denen ich gearbeitet habe und auch mal um die Häuser gezogen bin. Damals habe ich in der Akademie geschlafen. Mike Hentz hatte vorher in dem Atelier, wo ich war, Flöhe oder Läuse gezüchtet und ich war von oben bis unten zerstochen. Also ging ich zum Rektor Carl Vogel und habe gesagt: „Ich bin erst mal wieder in Köln. Rufen Sie mich an, wenn Sie die Bude da oben sauber haben.“
Waren Sie gleichzeitig mit Franz Erhard Walther in Hamburg?
Auch, ja. Er war der „Zuckerbäcker“. Ich habe ihn in Hamburg mitbekommen. Ein durch und durch organisierter Künstler. Morgens früh stand er schon am Kopierer. An seinen Projektzeichnungen kann man sehr gut sehen, wie durchorganisiert er ist. Mit Anwendungsbereichen, die auch einen performativen Charakter haben, hatte er in gewisser Weise auch eine Außenseiterrolle.
Ihre Werkserie „Formalisierung der Langeweile“ entstand Anfang der 80er-Jahre. Etwa zur gleichen Zeit sagten auch die jungen Maler wie etwa Dokoupil: „Die Langeweile damals war schon ziemlich präsent.“ War das die Stimmung in der Gesellschaft Anfang der 80er-Jahre?
In den 70er-Jahren ist ja noch eine ganze Reihe anderer Arbeiten von mir entstanden, wie „Schlussfolge/Schlussfolge“ ![]() Jürgen Klauke, „Schussfolge/Schlussfolge“, 1976.
Jürgen Klauke, „Schussfolge/Schlussfolge“, 1976.  , „Philosophie der Sekunde“
, „Philosophie der Sekunde“ ![]() Jürgen Klauke, „Philosophie der Sekunde“, 1976.
Jürgen Klauke, „Philosophie der Sekunde“, 1976. 
![]() Jürgen Klauke, „Viva España“, 1976/1979.
Jürgen Klauke, „Viva España“, 1976/1979. 
Das war also rein autobiografisch?
Erst einmal ja. Ich habe die Zeit wie einen Klumpen unter den Stuhl fallen gehört und habe Tage und Wochen ziemlich gefährdet dort herumgesessen. Dann habe ich überlegt, dass ich darüber arbeiten sollte, über genau diesen Zustand. Das wurde ja öfter schon gesagt, dass Langeweile sehr inspirierend sein kann. In dem Fall war die Langeweile sehr anstrengend und gleichermaßen inspirierend genug, um darüber zu arbeiten. Damals habe ich zum ersten Mal eine Art Drehbuch, also Entwurfszeichnungen gemacht, wie das werden könnte. Ich habe nach Begrifflichkeiten gesucht und dazu auch andere Geister hinzugezogen. Bei Søren Kierkegaard habe ich über Langeweile nachgelesen und über die Unterschiede zwischen La Noia und des Flaneurs nachgedacht, also den eher luxuriösen Zeitvertreib im Verhältnis zur wirklich erbarmungslosen Langeweile, nämlich zu der Zeit, die nicht vergehen will – dem Stillstand. Alles Mögliche … bis eben zu dem zeitlichen Phänomen, der Zeit, die nicht vergehen will.
Wäre damals draußen vor der Tür Tohuwabohu gewesen, hätte sich diese Langeweile vielleicht gar nicht erst eingestellt.
Ich hatte Tohuwabohu im Überfluss. Neben all diesen Reiz-Reaktions-Spielen waren die 70er-Jahre Aufbruch und Experiment schlechthin. Und höchstens mit den 20er-, 30er-Jahren zu vergleichen.
Und was war in den 80er-Jahren?
Wie gesagt, ein sehr aufwendiger Betrieb, der sehr schön war, war irgendwann gelebt. Es war unerhört viel auf den Weg gebracht worden. Experimenteller geht es kaum: Arte povera, Land-Art, Sprache, Performance, neue Medien, Fotografie, Video – das wurde alles Ende der 60er-, Anfang der 70er-Jahre eingeführt. Und dann kam die Ruhe nach dem Sturm. Mit der „Formalisierung der Langeweile“ ist ein Block entstanden und mir persönlich ein Wurf über ein komplexes Thema gelungen, über das wenig gearbeitet wurde. Für mich war das nicht weniger spannend als das, was ich davor gemacht habe.
Meine Frage geht auch eher in eine andere Richtung: Wenn man die 80er-Jahre-Malerei betrachtet, scheint es, als seien die Themen erschöpft, als seien die Experimente in unterschiedlichen Medien ausgereizt. Alles scheint in dieser Zeit möglich, weil nichts „gemacht werden muss“. Die gesellschaftspolitische Situation hat die Kunst und die Künstler in den 80er-Jahren scheinbar nicht herausgefordert.
Ich widerspreche Ihnen da nicht. Das hat aber weniger mit der Gesellschaft als mit den Künstlern selbst zu tun. Das konnte ich etwas später hier an der Kunsthochschule für Medien gut beobachten. Die Studenten kamen aus Düsseldorf oder von anderen Akademien und haben sich für ein Postgraduiertenstudium eingeschrieben, weil sie sich medial aufrüsten wollten und die Medienkunst angesagt war. In einer Zeit, in der die Malerei dominierte, kam keiner darauf sich in der Medienkunst zu betätigen. Und sobald die Malerei schwächer wurde und das Geld etwas aus den Köpfen schwand oder es darauf keinen garantierten Erfolg gab, haben sich die Leute von den klassischen Akademien wie Berlin oder Düsseldorf wieder für den medialen Postgraduiertenstudiengang beworben. Das war als Wellenbewegung zu erkennen.
Waren Sie damals öfter in Berlin?
In den 70er-Jahren habe ich öfter bei Jes Petersen ausgestellt. Der zeigte unter anderem die Wiener Aktionisten, Johannes Blume hier aus Köln oder Tomas Schmit aus Berlin. Also Konzept, Foto und eher polarisierende Künste. Davor hatte er – den ich auch immer gern mochte – Friedrich Schröder-Sonnenstern ![]() Friedrich Schröder-Sonnenstern (eigtl. Emil Friedrich Schröder, 1892 Kaukehmen, Ostpreußen, heute Russland – 1982 Berlin) war ein Autodidakt. In seinen Arbeiten entwarf er surrealistisch anmutende Fantasie- und Traumwelten. 1972 gehörte er zu den Mitbegründern der Berliner Malerpoeten. Während der 70er-Jahre beschäftigte Sonnenstern den späteren Galeristen Jes Petersen als Gehilfen in seinem Atelier. . Petersen hat auch an den Fälschungen noch mitgearbeitet. Das war eine sehr interessante Figur. Später hat er sich durch Kokainhandel selbst vernichtet und ist für mehrere Jahre im Knast gelandet. Das war Jes Petersen am Savignyplatz, da, wo im berühmten Zwiebelfisch
Friedrich Schröder-Sonnenstern (eigtl. Emil Friedrich Schröder, 1892 Kaukehmen, Ostpreußen, heute Russland – 1982 Berlin) war ein Autodidakt. In seinen Arbeiten entwarf er surrealistisch anmutende Fantasie- und Traumwelten. 1972 gehörte er zu den Mitbegründern der Berliner Malerpoeten. Während der 70er-Jahre beschäftigte Sonnenstern den späteren Galeristen Jes Petersen als Gehilfen in seinem Atelier. . Petersen hat auch an den Fälschungen noch mitgearbeitet. Das war eine sehr interessante Figur. Später hat er sich durch Kokainhandel selbst vernichtet und ist für mehrere Jahre im Knast gelandet. Das war Jes Petersen am Savignyplatz, da, wo im berühmten Zwiebelfisch ![]() Zwiebelfisch, Savignyplatz 7, 10623 Berlin. Die Kneipe wurde 1967 in Berlin-Charlottenburg eröffnet. die Berliner Maler Hof hielten. Ich fand immer hinten in der Ecke Herrn Wagenbach
Zwiebelfisch, Savignyplatz 7, 10623 Berlin. Die Kneipe wurde 1967 in Berlin-Charlottenburg eröffnet. die Berliner Maler Hof hielten. Ich fand immer hinten in der Ecke Herrn Wagenbach ![]() Der Verleger Klaus Wagenbach (* 1930 Berlin) führte von 1964 bis 2002 den Wagenbach-Verlag in Berlin. Das Programm seines Verlags umfasst Bücher aus dem Bereich der Belletristik sowie zu historischen, kulturgeschichtlichen und politischen Themengebieten. Während der 60er-Jahre gehörte Wagenbach zu den zentralen Figuren der Außerparlamentarischen Opposition (APO). Von 1979 bis 1999 war er Mitherausgeber der linksintellektuellen Zeitschrift „Freibeuter“. von dem Literaturverlag besonders nett. Der schluckte auch wie ein Buntspecht.
Der Verleger Klaus Wagenbach (* 1930 Berlin) führte von 1964 bis 2002 den Wagenbach-Verlag in Berlin. Das Programm seines Verlags umfasst Bücher aus dem Bereich der Belletristik sowie zu historischen, kulturgeschichtlichen und politischen Themengebieten. Während der 60er-Jahre gehörte Wagenbach zu den zentralen Figuren der Außerparlamentarischen Opposition (APO). Von 1979 bis 1999 war er Mitherausgeber der linksintellektuellen Zeitschrift „Freibeuter“. von dem Literaturverlag besonders nett. Der schluckte auch wie ein Buntspecht.
Waren Sie damals auch mal in der DDR?
Ich war damals auch mal in der DDR, zusammen mit dem Sohn ![]() René Böll (* 1948 Köln) ist ein Künstler und Verleger, der von 1975 bis 1988 den Lamuv Verlag in Köln leitete. Seit dem Tod seines Vaters, des Schriftstellers und Nobelpreisträgers Heinrich Böll (1917 Köln – 1985 Kreuzau-Langenbroich), verwaltet er dessen Nachlass. von Heinrich Böll, ein Studienfreund und heftiger Bildhauer. Er holte die Tantiemen seines Vaters dort ab, die wir dann versoffen haben. Die Grenzbeamten sagten immer: „Nu, findste das schön mit den langen Haaren da? Wie siehst’n du aus?“ Das sind meine Erinnerungen.
René Böll (* 1948 Köln) ist ein Künstler und Verleger, der von 1975 bis 1988 den Lamuv Verlag in Köln leitete. Seit dem Tod seines Vaters, des Schriftstellers und Nobelpreisträgers Heinrich Böll (1917 Köln – 1985 Kreuzau-Langenbroich), verwaltet er dessen Nachlass. von Heinrich Böll, ein Studienfreund und heftiger Bildhauer. Er holte die Tantiemen seines Vaters dort ab, die wir dann versoffen haben. Die Grenzbeamten sagten immer: „Nu, findste das schön mit den langen Haaren da? Wie siehst’n du aus?“ Das sind meine Erinnerungen.
Sehen Sie Parallelen Ihres Werks zu dem von Anna und Bernhard Blume?
Bei Blume darf ja schon mehr gelacht werden als bei mir. Wir waren aber einander sehr nah, auch mit seinem Hausphilosophen Günter Schulte. Meine Thematiken sind aber völlig andere als seine. Die größte Gemeinsamkeit ist vielleicht das Selbstdarstellende und intermediäre Arbeiten. Aber das sind äußerliche Ähnlichkeiten. Die Entwicklung geht bei Blume in eine völlig andere Richtung, dieser kaputte Konstruktivismus.
Ich sehe die Parallelen eher in der Verwendung von Alltagsgegenständen und der Bearbeitung von Banalitäten.
Wenn man es so betrachtet, kann man vielleicht Gemeinsamkeiten beobachten. Aber die Blumes spielen doch mehr mit der Banalität. Sie spielen auch mehr mit den Zeitgeistern der 50er- und 60er-Jahre. Die Nierentische, die durch die Gegend sausen, oder die Großmutter, die vom Sofa geschmissen wird, und dergleichen. Da wird auf eine ganz andere Art und Weise gearbeitet und gedacht. Wenn ich mit trivialen Gegenständen arbeite – nehmen wir einmal den Eimer –, dann ist der Eimer einmal eine Maske und einmal steht er für das Formlose, für den Müll, für den Tod. Also der wird bei mir nicht wie beim Karneval durch die Gegend geschmissen. Und das ist der Unterschied. Bei mir bekommt das Triviale doch häufig erhabene Züge. Der Ausgangspunkt ist ein anderer und auch die Requisiten, die vielleicht eine äußere Ähnlichkeit haben, aber etwas völlig anderes meinen und sagen. Es gab da aber überhaupt keine Rivalitäten, sondern eher Nähen.
Wie ist Ihr Verhältnis zu Kasper König?
Als der hier auftauchte, haben wir im EWG ![]() EWG ist eine Kneipe in der Aachener Straße 59 in der Kölner Neustadt-Süd. viel zusammen Billard gespielt. Der ist ja auch so ein Vitaler, der auch nachts gut unterwegs war. Wenn ich mich nicht irre, hat er mir auch das Stipendium PS1 in New York zugeschanzt. Ich konnte es nicht antreten, weil ich da gerade mit den Großausstellungen der „Langeweile“
EWG ist eine Kneipe in der Aachener Straße 59 in der Kölner Neustadt-Süd. viel zusammen Billard gespielt. Der ist ja auch so ein Vitaler, der auch nachts gut unterwegs war. Wenn ich mich nicht irre, hat er mir auch das Stipendium PS1 in New York zugeschanzt. Ich konnte es nicht antreten, weil ich da gerade mit den Großausstellungen der „Langeweile“ ![]() „Formalisierung der Langeweile“, Rheinisches Landesmuseum Bonn/Kunstmuseum Luzern/Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Bonn/Luzern/Graz, 1981/82. zugange war. Ich wollte etwas mehr Geld haben, weil ich viel hin und her hätte fliegen müssen. Das konnte man mir aber nicht zugestehen und dann habe ich es an jemand anderen weitergegeben. Mit König hatte ich immer wieder zu tun, auch mit seinem Bruder Walther und dessen legendärer Buchhandlung, und bei Kaspers Sohn habe ich gerade in New York ausgestellt. Er ist eine sehr einflussreiche Figur. Auch für andere Kuratoren. Viele Jungkuratoren berufen sich auf ihn.
„Formalisierung der Langeweile“, Rheinisches Landesmuseum Bonn/Kunstmuseum Luzern/Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Bonn/Luzern/Graz, 1981/82. zugange war. Ich wollte etwas mehr Geld haben, weil ich viel hin und her hätte fliegen müssen. Das konnte man mir aber nicht zugestehen und dann habe ich es an jemand anderen weitergegeben. Mit König hatte ich immer wieder zu tun, auch mit seinem Bruder Walther und dessen legendärer Buchhandlung, und bei Kaspers Sohn habe ich gerade in New York ausgestellt. Er ist eine sehr einflussreiche Figur. Auch für andere Kuratoren. Viele Jungkuratoren berufen sich auf ihn.
Was genau kann er?
Machen! Der fällt unter die Macher und Netzwerker und das kann er noch immer, wie sein Münster-Projekt jetzt wieder beweist. Und wie vergangene Projekte gezeigt haben – auch seine Zeit am Frankfurter Städel. Und von diesem Typus haben wir so einige, zum Beispiel den, der gar nicht mehr schläft, Hans Ulrich Obrist ![]() Hans Ulrich Obrist (* 1968 Weinfelden, Schweiz) ist ein Kurator, der durch seine fortlaufende Publikationsreihe der „Conversation Series“ (Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln) bekannt wurde. Seit 2016 ist er Direktor der Serpentine Galleries in London. in London. Und da ist Kasper König, glaube ich, einer der frühen gewesen. Wobei natürlich eine Figur wie Harry Szeemann, den ich auch früh kennenlernte, noch mal ein anderes Kaliber war. Er war schon sehr besonders. Diese Großausstellungen, die er wirklich erdacht und selbst inszeniert hat.
Hans Ulrich Obrist (* 1968 Weinfelden, Schweiz) ist ein Kurator, der durch seine fortlaufende Publikationsreihe der „Conversation Series“ (Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln) bekannt wurde. Seit 2016 ist er Direktor der Serpentine Galleries in London. in London. Und da ist Kasper König, glaube ich, einer der frühen gewesen. Wobei natürlich eine Figur wie Harry Szeemann, den ich auch früh kennenlernte, noch mal ein anderes Kaliber war. Er war schon sehr besonders. Diese Großausstellungen, die er wirklich erdacht und selbst inszeniert hat. ![]() Harald Szeemann (1933 Bern – 2005 Tegna im Tessin, Schweiz) war von 1961 bis 1969 als Direktor an der Kunsthalle Bern tätig. Dort zeigte er 1969 die wegweisende Ausstellung „Live in Your Head. When Attitudes Become Form“. Szeemann leitete 1972 die „documenta 5“ und organisierte die Ausstellung „Junggesellenmaschinen“, die ab 1975 an neun Ausstellungsorten in Europa, darunter in der Kunsthalle Bern, der Kunsthalle Düsseldorf, der Kunsthalle Malmö und dem Stedelijk Museum Amsterdam, zu sehen war. 1983 folgte die Ausstellung „Der Hang zum Gesamtkunstwerk“, die für das Kunsthaus Zürich konzipiert war und anschließend nach Wien, Düsseldorf und Berlin reiste. 1999 und 2001 kuratierte Szeemann die Themenausstellungen der Biennale von Venedig. Mit seinen innovativen Ausstellungsformaten zählt er zu den wichtigsten Vermittlern der Kunst seiner Zeit. Das ist noch mal ein anderer Gestus. Und auch seine große Liebe und Nähe zu den Künstlern. Kasper ist nicht unbedingt derjenige, der Ausstellungen erfindet. Vielleicht sollte er mal die documenta machen – das würde ich ihm wünschen.
Harald Szeemann (1933 Bern – 2005 Tegna im Tessin, Schweiz) war von 1961 bis 1969 als Direktor an der Kunsthalle Bern tätig. Dort zeigte er 1969 die wegweisende Ausstellung „Live in Your Head. When Attitudes Become Form“. Szeemann leitete 1972 die „documenta 5“ und organisierte die Ausstellung „Junggesellenmaschinen“, die ab 1975 an neun Ausstellungsorten in Europa, darunter in der Kunsthalle Bern, der Kunsthalle Düsseldorf, der Kunsthalle Malmö und dem Stedelijk Museum Amsterdam, zu sehen war. 1983 folgte die Ausstellung „Der Hang zum Gesamtkunstwerk“, die für das Kunsthaus Zürich konzipiert war und anschließend nach Wien, Düsseldorf und Berlin reiste. 1999 und 2001 kuratierte Szeemann die Themenausstellungen der Biennale von Venedig. Mit seinen innovativen Ausstellungsformaten zählt er zu den wichtigsten Vermittlern der Kunst seiner Zeit. Das ist noch mal ein anderer Gestus. Und auch seine große Liebe und Nähe zu den Künstlern. Kasper ist nicht unbedingt derjenige, der Ausstellungen erfindet. Vielleicht sollte er mal die documenta machen – das würde ich ihm wünschen.
Was sagen Sie zu der Theorie, dass die Künstlerinnen sich in der Medienkunst erstmalig gegenüber den Männern behaupten konnten, weil das Medium noch nicht – wie die klassischen Gattungen Malerei und Skulptur – von den Männern besetzt war?
Das halte ich für Blödsinn. Natürlich gibt es die Malerei und die Skulptur schon länger als die Medien. Aber die neuen Medien wurden – ich weiß nicht, ob es dazu eine wissenschaftliche Erhebung gibt – von Männern wie von Frauen benutzt. Frauen sind in den letzten Jahrzehnten häufiger an den Kunsthochschulen zu finden als früher. Darüber gibt es Erhebungen. Aber dass die traditionellen Medien besetzt waren, dass eine Frau sich als Malerin nicht behaupten könne, das ist nicht richtig. Rune Mields ![]() Rune Mields (* 1935 Münster) ist eine Künstlerin, die sich in ihren Arbeiten mit dem Verhältnis von logischem Wissen und Zeichen beschäftigt. Gemeinsam mit Klaus Honnef, Will Kranenpohl und Benno Werth gründete sie 1968 den Gegenverkehr – Zentrum für aktuelle Kunst in Aachen. malt seit 80 Jahren, Frau Lassnig und andere ebenso. Das Patriarchat ist natürlich im Kunsthandel, in der Kunstwissenschaft und überall zu finden gewesen und das gibt es sicher bei vereinzelten Knurrhähnen auch heute noch. Dennoch kann ich mit dieser Theorie nicht viel anfangen. Ich denke auch an Petzold, Anna Oppermann, Annegret Soltau, Rebecca Horn, Windheim und andere – das sind alles keine Malerinnen, aber tolle Künstlerinnen. Warum weniger Frauen gemalt haben, weiß ich nicht. Im Großen und Ganzen dürfte die Pille und die Frauenbewegung zu einem neuen Frauenbild und dadurch zur Öffnung beigetragen haben. Ich denke, dass das Feld heute relativ ausgewogen ist. Es verhält sich in der Kunst also nicht anders als in anderen männerdominierten Berufszweigen – wo sich das ja auch sehr zäh entwickelte und dann Gott sei Dank geöffnet hat.
Rune Mields (* 1935 Münster) ist eine Künstlerin, die sich in ihren Arbeiten mit dem Verhältnis von logischem Wissen und Zeichen beschäftigt. Gemeinsam mit Klaus Honnef, Will Kranenpohl und Benno Werth gründete sie 1968 den Gegenverkehr – Zentrum für aktuelle Kunst in Aachen. malt seit 80 Jahren, Frau Lassnig und andere ebenso. Das Patriarchat ist natürlich im Kunsthandel, in der Kunstwissenschaft und überall zu finden gewesen und das gibt es sicher bei vereinzelten Knurrhähnen auch heute noch. Dennoch kann ich mit dieser Theorie nicht viel anfangen. Ich denke auch an Petzold, Anna Oppermann, Annegret Soltau, Rebecca Horn, Windheim und andere – das sind alles keine Malerinnen, aber tolle Künstlerinnen. Warum weniger Frauen gemalt haben, weiß ich nicht. Im Großen und Ganzen dürfte die Pille und die Frauenbewegung zu einem neuen Frauenbild und dadurch zur Öffnung beigetragen haben. Ich denke, dass das Feld heute relativ ausgewogen ist. Es verhält sich in der Kunst also nicht anders als in anderen männerdominierten Berufszweigen – wo sich das ja auch sehr zäh entwickelte und dann Gott sei Dank geöffnet hat.
Diese These stammt nicht von mir. Das sagen die Künstlerinnen, die dabei waren, zum Beispiel Ulrike Rosenbach ![]() Vgl. Ulrike Rosenbach. .
Vgl. Ulrike Rosenbach. .
Ulrike Rosenbach hat früh mit den Medien gearbeitet. Sie ist nicht eingestiegen, als das durch war, sondern sie hat es mitbegründet. Das ist für sie ehrenhaft und prima. Sie hätte aber genauso gut wie Isa Genzken Skulpturen machen oder Bilder malen können. Bevor man so etwas behauptet, müsste man eine Untersuchung durchführen: Wie viele Frauen haben um die Uhrzeit wirklich heftig gemalt und wie viele sind davon verschwunden und warum? Es gab eine Zeit lang einfach weniger Frauen, weil sie in den klassischen Modellen lebten oder so leben mussten und von der Männerwelt domestiziert wurden.
Das Thema wurde oft behandelt. Und ich habe mich auch mit Ulrike Rosenbach des Öfteren darüber unterhalten. Zum Beispiel als wir 1979 in Australien zur Sydney Biennale waren. Auf den Fidschi-Inseln hatten wir Zeit über solche Dinge zu reden. Das, was Sie beschreiben, war die offizielle Wahrnehmung. Aber heute stellen wir fest, dass an den Akademien stellenweise sogar mehr Frauen studieren als Männer. Laut Erhebung. Damals war es für Frauen schwieriger. Frauen bekamen Kinder, Frauen hatten dies und das und Männer wollten dies nicht und jenes nicht. Und dann kam die Bewegung, die doch ein paritätischeres Bild zur Folge hatte. Ich hatte immer Probleme mit Frauen-Kunst/Männer-Kunst – entscheidend ist, ob die Kunst gut oder schlecht ist.
Es ist bekannt, dass Lüpertz, Baselitz und später die Truppe um Martin Kippenberger, Albert Oehlen und Werner Büttner sich den Künstlerinnen gegenüber nicht gerade ehrenhaft verhalten hat.
Kippenberger, Büttner, Oehlen, Max Hetzler – das war ein Männerverband der Sonderklasse. Die konnten einem schon auf die Nerven gehen. Mit ihren Liedern, die sie grölten. Es sind ja auch auf den frühen Bildern Sprüche zu finden, die relativ sinnfrei sind. Wir haben damals viel rumgegrölt. Das gehört alles in die Zeit. Das war eine Ruhrpott-Mentalität, die eigentlich von Kippenberger kam: „Der Berchmann kommt.“ ![]() „Frisch auf Frisch auf / der Bergmann kommt / er hat sein helles Licht schon angezünd“, in: Ludwig Erk/Franz Magnus Böhme (Hg.), „Deutscher Liederhort“, Bd. 1–3, Leipzig 1893–94. In dieser Art. Und auch das Dritte Reich wurde noch einmal ein bisschen bemüht. Ich dachte eigentlich, das sei mit Polke und seinen Züricher Kumpels abgehandelt gewesen. Also das war ein bisschen Machogehabe und Männergedöns, aber das hat sich ja dann wohltuend geändert. In der Nachkriegszeit sind wir alle noch in diesen Modellen erzogen worden: der Mann als Soldat und die Frau als Hausfrau und Gebärerin. In der Zeit, in der ich Kind war und so langsam vor mich hinreifte, wurde das Modell noch eingehalten. Das musste aus den Gehirnen erst einmal verschwinden. Das geht nicht von heute auf morgen. Grundsätzlich bin ich gegen politische Korrektheit, weil sie mich zu Tode langweilt. Das gilt im Besonderen für die Kunst, politische Korrektheit gehört da nicht hin.
„Frisch auf Frisch auf / der Bergmann kommt / er hat sein helles Licht schon angezünd“, in: Ludwig Erk/Franz Magnus Böhme (Hg.), „Deutscher Liederhort“, Bd. 1–3, Leipzig 1893–94. In dieser Art. Und auch das Dritte Reich wurde noch einmal ein bisschen bemüht. Ich dachte eigentlich, das sei mit Polke und seinen Züricher Kumpels abgehandelt gewesen. Also das war ein bisschen Machogehabe und Männergedöns, aber das hat sich ja dann wohltuend geändert. In der Nachkriegszeit sind wir alle noch in diesen Modellen erzogen worden: der Mann als Soldat und die Frau als Hausfrau und Gebärerin. In der Zeit, in der ich Kind war und so langsam vor mich hinreifte, wurde das Modell noch eingehalten. Das musste aus den Gehirnen erst einmal verschwinden. Das geht nicht von heute auf morgen. Grundsätzlich bin ich gegen politische Korrektheit, weil sie mich zu Tode langweilt. Das gilt im Besonderen für die Kunst, politische Korrektheit gehört da nicht hin.
Sie sagten Ende der 70er-Jahre, nachdem Sie viele Themen behandelt hatten, musste etwas Neues her. Jean-Christophe Ammann sagte während eines Gesprächs, das wir im Rahmen unserer 80er-Jahre-Malerei-Ausstellung geführt haben, damals hätten die Bilder einen geschockt und heute schockt einen gar nichts mehr. ![]() Das Symposium fand am 24. Januar 2015 anlässlich der Ausstellung „Die 80er. Figurative Malerei in der BRD" im Städel Museum statt. Die Aufzeichnung ist abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=sLDL5wxSBZ8. Ich sehe das nicht so. Vor allem sind diese Bilder heute im musealen oder institutionellen Kontext kaum noch zu finden.
Das Symposium fand am 24. Januar 2015 anlässlich der Ausstellung „Die 80er. Figurative Malerei in der BRD" im Städel Museum statt. Die Aufzeichnung ist abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=sLDL5wxSBZ8. Ich sehe das nicht so. Vor allem sind diese Bilder heute im musealen oder institutionellen Kontext kaum noch zu finden.
Da würde ich Jean-Christophe Ammann auch widersprechen. Das mag für einen Teil der Arbeiten gelten, nämlich die, die nur des Schocks wegen schockieren wollten. Das war aber nie mein Anliegen, sondern ich habe ein Thema vertieft und auf verschiedene Arten und Weisen untersucht. Natürlich immer wieder durch Bilder, das war sehr wichtig. Ich habe jetzt gerade in New York erlebt, wie frisch diese 70er-Jahre Arbeiten heute noch auf das Publikum, auf ein junges Publikum, das die Arbeiten zum großen Teil nicht kannte, wirken.
Was die Institutionen oder Museen angeht würde ich sagen, dass sich da immer auch ein Gesellschaftsbild widerspiegelt. Ich erinnere an die Balthus-Ausstellung, die 2014 im Museum Folkwang in Essen stattfinden sollte und dann kurzfristig wegen des Vorwurfs der Pädophilie abgesagt wurde. Die geplante Ausstellung fiel der politischen Korrektheit, von der ich eben schon sprach, zum Opfer. Es gibt Arbeiten, die ernst gemeint sind, das spürt der Betrachter und das hat er nicht unbedingt gerne. Solche Arbeiten polarisieren und spalten. Und genau das sollen sie auch. Ich erwarte von guter Kunst, dass sie beunruhigt. Die Schönheit muss es sicher auch geben. Das allein reicht aber nicht. Kunst stellt unter anderem Fragen und liefert keine Antworten.
Ich denke oft, heute wird weniger gewagt als in den 70er-Jahren.
Das stimmt! Die End-60er waren nicht nur im künstlerischen Labor radikal und experimentell, haben geöffnet und diese Meta-Sprachen in eine festgelegtere Kunst hineingebracht, sondern auch die Museen und Institutionen waren experimenteller und haben – Sie haben es eben gesagt – mehr gewagt. Das hängt alles mit unserem kapitalistischen System und der Effizienz-Süchtelei zusammen. Die Museen müssen sich rentieren, sie müssen Besucherzahlen vorweisen. Und es gibt auch nicht mehr so viele Radikalinskis im Kunstbetrieb. Weder in der Kunst noch in den Museen. Die haben alle den Lernprozess der Marktwirtschaft vor Augen. Insofern hechelt heute alles dem Markt und dem Wohlgefallen hinterher. Da hat es so manche Kunst ein bisschen schwerer.
Kunst, wie ich sie verstehe, ist der Gegenspieler der Institutionen und Systeme, die auf zweckorientiertes und effizientes Handeln sowie schnelle Verständigung zielen. Kunst erzeugt im besten Falle Irritationen und Bewusstseinskrisen – Kunst weicht ab und schafft Widersprüche und Konflikte. Sie vertieft und erweitert die Weltwahrnehmung. Damit wird das nutzlose, von den Gesetzen der Logik befreite Projekt Kunst nutzbar. Im geglückten Fall wird die Sisyphusarbeit umgewandelt in Erkenntnisartiges.
Das Gros aber ist heute angepasst; wir wollten damals gerade weg von der Anpassung. Deswegen versuche ich auch immer diese Selbstbehauptung der Kunst aufrechtzuerhalten und nicht irgendwelchen Ideologien oder Marktgesetzen zu folgen. Ich mache das, wozu ich Lust habe. Und das ist großartig. Wenn ich im Atelier sitze und zeichne, bis mir der Ellenbogen fast abfällt, denke ich: Welch ein Luxus! Keiner interessiert sich dafür und ich mache es trotzdem.

