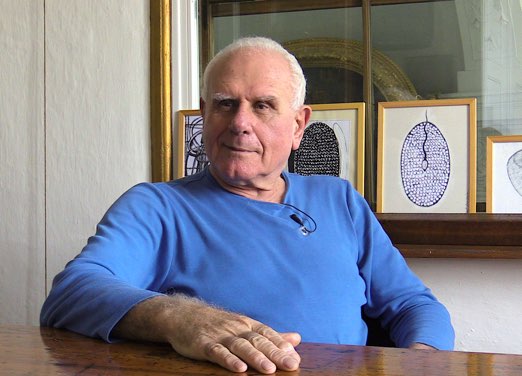Neuhaus an der Donau, 29. September 2016
Franziska Leuthäußer: Wie sind Sie hier in Österreich gelandet?
Klaus Rinke: 2006 bin ich vom Rhein an die Donau gezogen, da hat sich nur die Fließrichtung geändert. Ich bin Hagen zuvorgekommen! Mit der alpinen Kultur komme ich gut zurecht, denn von 1952 bis 53 war ich Kuhjunge im Allgäu am Bodensee, um mir mein Essen zu erarbeiten. Das Voralpenland mit seinen heißen Südwinden versetzt mich permanent in einen kreativen Fön. Künstlerisch war ich in Österreich sehr aktiv: in Linz, in der Wiener Secession, in Innsbruck und beim Steirischen Herbst in Graz. Dort habe ich 1976 meine letzten Vorführungen als „modern dancer“ gemacht. 2006 habe ich dann im Mühlviertel ein 4,500 Quadratmeter großes Atelier – eine Fabrik – gefunden und später eine Wohnung im Schloss Neuhaus an der Donau. Wer würde Deutschland unter diesen Umständen, als Professor im Ruhestand, nicht verlassen?
Die 70er-Jahre waren politisch und aggressiv – im Gegensatz zu heute. Wenn wir nicht jeden Tag in der Akademie gewesen wären, hätten die Studenten dort einen sozialistischen Kindergarten gemacht. Man musste damals Farbe bekennen. Lüpertz machte dann die Maler-Akademie. ![]() Markus Lüpertz (* 1941 Liberec, Böhmen, heute Tschechische Republik) lehrte von 1986 bis 1988 als Professor an der Kunstakademie Düsseldorf und war im Anschluss bis 2009 dort Rektor. Das war genau das Gegenteil von dem, was wir wollten. Die Avantgarde-Akademie nach dem Krieg waren wir, die Bildhauer, jetzt geht sie langsam den Bach runter …
Markus Lüpertz (* 1941 Liberec, Böhmen, heute Tschechische Republik) lehrte von 1986 bis 1988 als Professor an der Kunstakademie Düsseldorf und war im Anschluss bis 2009 dort Rektor. Das war genau das Gegenteil von dem, was wir wollten. Die Avantgarde-Akademie nach dem Krieg waren wir, die Bildhauer, jetzt geht sie langsam den Bach runter …
Mit Rita McBride ![]() Rita McBride (* 1960 Des Moines, Iowa) ist eine Künstlerin, die sich in ihren installativen Arbeiten mit den Schnittstellen zwischen Skulptur, Design und Architektur beschäftigt. Von 1982 bis 1987 studierte sie bei John Baldessari am California Institute of the Arts. McBride wurde 2003 Professorin an der Kunstakademie in Düsseldorf, 2013 übernahm sie das Amt der Rektorin. ?
Rita McBride (* 1960 Des Moines, Iowa) ist eine Künstlerin, die sich in ihren installativen Arbeiten mit den Schnittstellen zwischen Skulptur, Design und Architektur beschäftigt. Von 1982 bis 1987 studierte sie bei John Baldessari am California Institute of the Arts. McBride wurde 2003 Professorin an der Kunstakademie in Düsseldorf, 2013 übernahm sie das Amt der Rektorin. ?
Sie ist die Direktatorin.
Ist das so?
Habe ich schon erlebt. Frauen sind oft härter als Männer. Wir Männer hatten eine andere Art miteinander umzugehen, aber ihr Frauen wolltet doch etwas vollkommen anderes machen, oder?
Ihr?
Ja! Ihr Frauen. Frauen übernehmen die Posten und machen dann dasselbe wie die Männer. Wo ist denn das weibliche Einfühlungsvermögen? Als Margarethe Jochimsen und Philomene Magers damals die Ausstellung „Typisch Frau“ veranstalteten, ![]() Margarethe Jochimsen (1931–2016) war eine Kunsthistorikerin und Kuratorin, die von 1978 bis 1986 den Bonner Kunstverein leitete. Gemeinsam mit der Galeristin Philomene Magers organisierte sie 1981 die Ausstellung „Typisch Frau“ im Bonner Kunstverein und der Galerie Magers. Zwischen 1991 und 2002 arbeitete Jochimsen als Gründungsdirektorin des Bonner August Macke Hauses. sind meine Studentinnen ohne mein Wissen mit Transparenten herumgelaufen: „Wir lassen uns nicht von den Männern trennen!“ Mensch, war ich stolz auf meine Frauen!
Margarethe Jochimsen (1931–2016) war eine Kunsthistorikerin und Kuratorin, die von 1978 bis 1986 den Bonner Kunstverein leitete. Gemeinsam mit der Galeristin Philomene Magers organisierte sie 1981 die Ausstellung „Typisch Frau“ im Bonner Kunstverein und der Galerie Magers. Zwischen 1991 und 2002 arbeitete Jochimsen als Gründungsdirektorin des Bonner August Macke Hauses. sind meine Studentinnen ohne mein Wissen mit Transparenten herumgelaufen: „Wir lassen uns nicht von den Männern trennen!“ Mensch, war ich stolz auf meine Frauen!
Beat Wismer, der Generaldirektor des Museums Kunstpalast in Düsseldorf, fragte mich vor einiger Zeit, warum 1968/69 bei der Luzerner Ausstellung zur Düsseldorfer Szene ![]() „Düsseldorfer Szene“, Kunstmuseum Luzern, 15. Juni – 13. Juli 1969. keine Frau dabei war. Es gab damals in Düsseldorf in der Avantgarde keine Frauen! Die Frauen haben wir erst erzogen. Aus unseren Klassen sind die Frauen hervorgekommen. Jochimsen, eine Emanze, die den Bonner Kunstverein gemacht hat, sagte damals: „Rinke kann doch keine Frau erziehen.“ Darauf habe ich geantwortet: „Ich liebe Frauen, also kann ich sie auch erziehen.“
„Düsseldorfer Szene“, Kunstmuseum Luzern, 15. Juni – 13. Juli 1969. keine Frau dabei war. Es gab damals in Düsseldorf in der Avantgarde keine Frauen! Die Frauen haben wir erst erzogen. Aus unseren Klassen sind die Frauen hervorgekommen. Jochimsen, eine Emanze, die den Bonner Kunstverein gemacht hat, sagte damals: „Rinke kann doch keine Frau erziehen.“ Darauf habe ich geantwortet: „Ich liebe Frauen, also kann ich sie auch erziehen.“
Wie ging das mit dem Erziehen?
Indem ich ihnen klarmachte, dass sie ihre weiblichen Probleme hervorholen müssen und nicht versuchen sollten, Kunst so zu machen wie die Männer. Frauen haben eine ganz andere Vorstellung von der Welt als wir. Wir sind penisorientiert. Die sind anders.
Bei wem hat das funktioniert?
Ich habe ein Haufen Frauen hervorgebracht – weltweit. Das war neben den Bildhauermännern nicht einfach. Asta Gröting ![]() Asta Gröting (* 1961 Herford) ist eine Künstlerin, die zwischen 1981 und 1986 bei Klaus Rinke an der Kunstakademie Düsseldorf studierte. Bekannt ist sie vor allem für ihre bildhauerische Arbeit, in der sie mit figurativen Motiven und industriellen Materialien experimentiert. Seit Beginn der 1990er-Jahre zeigte sie ihre Werke unter anderem im Neuen Berliner Kunstverein (2010), dem Museum MARTa Herford (2006) und der Galerie Bärbel Grässlin (2002, 1998, 1995, 1993, 1992). haben sie zum Beispiel nie in den Raum gelassen. Sie rief dann immer: „Klaus, die lassen mich nicht in den Raum.“ Und ich antwortete ihr: „Da musst du durch. Ich kann dir nicht helfen. Es ist nicht gut, wenn ich dir helfe. Du musst da alleine durch.“ Sie ist ja berühmter geworden als all die Männer, die sie nicht in den Raum gelassen haben.
Asta Gröting (* 1961 Herford) ist eine Künstlerin, die zwischen 1981 und 1986 bei Klaus Rinke an der Kunstakademie Düsseldorf studierte. Bekannt ist sie vor allem für ihre bildhauerische Arbeit, in der sie mit figurativen Motiven und industriellen Materialien experimentiert. Seit Beginn der 1990er-Jahre zeigte sie ihre Werke unter anderem im Neuen Berliner Kunstverein (2010), dem Museum MARTa Herford (2006) und der Galerie Bärbel Grässlin (2002, 1998, 1995, 1993, 1992). haben sie zum Beispiel nie in den Raum gelassen. Sie rief dann immer: „Klaus, die lassen mich nicht in den Raum.“ Und ich antwortete ihr: „Da musst du durch. Ich kann dir nicht helfen. Es ist nicht gut, wenn ich dir helfe. Du musst da alleine durch.“ Sie ist ja berühmter geworden als all die Männer, die sie nicht in den Raum gelassen haben.
Zum Beispiel?
Ich kann endlos viele Namen nennen, aber dann werden wir nie fertig. Sie müssen mir sagen, was Sie wissen wollen.
Unsere Untersuchung betrachtet die erste Nachkriegsgeneration, also im Prinzip die Kriegskinder. Da hat sich eine große Lücke aufgetan. Vom Alter her ist das eigentlich ein Großeltern-Enkelkinder-Verhältnis. Zwischen den Generationen findet sehr wenig Austausch statt. Von den jungen Kuratorinnen und Kuratoren wird zum großen Teil ignoriert, was in den letzten 60 Jahren entstanden ist. Alles wird neu erfunden.
Wir haben hart an der Freiheit gearbeitet, schließlich sind wir ja im Dritten Reich groß geworden.
Das Erbe wird heute von der jüngsten Generation kaum mehr berücksichtigt. Mit unserem Projekt stellen wir genau die Frage, die sich ein junger Student heute vielleicht gar nicht mehr zu stellen traut: Wie war das eigentlich damals nach dem Krieg?
Meine Vergangenheit spielt in meinen Werken eine große Rolle, es finden sich immer Rückschlüsse darin. Aber als Kinder haben wir diese Gräuel gar nicht so gespürt. Ich bin direkt neben der Zeche Zollverein in Essen-Katernberg groß geworden. Bei meinem Großvater in der Kirche – an der Kirche komme ich gar nicht vorbei, Jesus ist immer im Hintergrund – habe ich mit russischen Kriegsgefangenen die ganzen Bombenangriffe auf Essen erlebt. Manchmal gab es dreimal am Tag Bombenalarm. Wir sind nachts in den Bunker gegangen, da flogen die Bomben wie Erdbeben. Das war ein Lebens- und Todeslotto. Meine Großmutter hat dann immer gesagt: „Die Rinkes und die Hahns sterben nicht.“ Daran haben wir geglaubt und sind nicht gestorben. Mein Großvater war freiwilliger Feuerwehrmann und rannte während der Bombenangriffe draußen herum. Ich habe meine Großmutter dann gefragt: „Oma, wo ist denn der Opa?“ – „Der ist draußen.“ – „Hat der keine Angst?“ – „Nein, der ist kriegserprobt, er hat den Ersten Weltkrieg mitgemacht.“
Ist aus Ihrer Familie niemand im Krieg gefallen?
Doch, Onkel Paul. Er hat bei Krupp in der Rüstungsindustrie gearbeitet und war sauer, dass alle an die Front gehen durften, nur er nicht. In der letzten Phase ist er doch noch eingezogen worden. Da war ich sogar dabei und habe das gesehen! Onkel Paul war der Jüngste. Er war dann ganz glücklich, endlich – wie die anderen – an die Front gehen zu können. Nach einer Woche, meine Großmutter bügelte gerade auf dem Küchentisch, schellte es an der Haustür und der Postbote überbrachte die Nachricht, dass Onkel Paul gefallen war. Er hat nur eine Woche überlebt. Meine Großmutter hatte vergessen, das Bügeleisen vom Tisch zu nehmen, sodass es tief in den Tisch eingebrannt ist. Wenn wir in den 50er-Jahren bei ihr Kaffee trinken waren, war es das eingebrannte Bügeleisen, das uns in Erinnerung blieb. Als ich größer wurde, habe ich die Klamotten von Onkel Paul anziehen müssen und damit war Onkel Paul auch ein Stück von mir. Joseph Beuys hat mir einmal gesagt: „Klaus, als ich jung war, war es Avantgarde vor dem Feind zu sein.“ Er war die Generation von Onkel Paul und das war die Stimmung: SA, Bombenangriffe, Scheinwerfer und russische Kriegsgefangene. Ich habe ein bisschen Russisch gelernt, weil sie bei uns in der Nachbarschaft in der Kirche Tausende von russischen Kriegsgefangenen, die bei Krupp arbeiten sollten, untergebracht haben. Die hatten Hunger und haben durch den Zaun um etwas zu Essen gebettelt. Die Männer der SS ließen mich dort spielen, weil ich da wohnte. Irgendwann kam ein SS-General in einem glänzenden Mercedes angefahren – ich hatte noch nie so glänzende Stiefel gesehen. Er schrie: „Was macht der Junge da? Er soll verschwinden.“ Die Russen hatten braune, erdige Uniformen an. Verdreckt standen sie da und baten um „хлеб mit ма́сло“. Ich sollte ihnen ein Butterbrot bringen. „хлеб“ bedeutet Brot und „ма́сло“ ist die Butter – das habe ich als kleines Kind gelernt.
Ich habe Tote in ihrem eigenen Blut gesehen. Als Kind nimmt man das natürlich nicht so wahr, sondern sieht das als Bild. Den Schrecken, die Gerüche … Ich erinnere mich an Gerüche. Man wird damit groß und sieht das als einen großen Spielplatz an. Ich bin 39 geboren, damals war ich vier oder fünf Jahre alt. Nach Oktober 45 bin ich mit der Hitlerjugend in die Schule gekommen.
Wann wird einem als Kind oder Jugendlicher bewusst, was da im Krieg wirklich passiert ist? Gab es so etwas wie ein Schuldbewusstsein oder ein Schulderbe?
Schuld hatte ich nicht, weil ich nichts verbrochen habe. Wir waren ja Kinder. Wir haben die Soldaten, die SS und auch die Züge in Essen erlebt. Wenn die Züge kamen und die Schranken am Bahnübergang runtergingen, machte es ting-ting und mein Großvater wusste immer, wie spät es war. Man brauchte keine Uhr, weil die Züge im Dritten Reich immer pünktlich waren. Das war nicht wie heute. Das war pünktlich. Disziplin. Die Wehrmachtszüge fuhren von der West- an die Ostfront oder umgekehrt. Wie viele da in den Viehwagen standen und langsam vorbeifuhren …! Das haben wir alles gesehen, aber uns war nicht bewusst, dass sie in die Todeslager kamen. Meine Schwester ist in Marienbad geboren, und ich war eine Zeit lang – ich glaube, es war 44 – in der Tschechoslowakei. Deswegen habe ich Erinnerungen an die böhmische Kultur, vor allem an das Essen. Topfen mit Paprika ist typisch tschechisch. Das haben wir dort gegessen. Die Sudetendeutschen waren zweihundertprozentig Nazis! Das habe ich mitgekriegt, weil ich im Hitlerkindergarten war und mit den Tschechen nicht spielen durfte. Jetzt waren aber im Nachbarhaus tschechische Kinder und natürlich haben wir miteinander gespielt, obwohl es gefährlich war. Wenn sie mich sahen, wurde ich im Kindergarten dafür bestraft. Die Tschechen waren rasiert und hatten Läuse und Wanzen – wir nicht. Wir durften Haare haben. In Dux, wo Casanova im Gefängnis war und wo ich lebte ![]() Gemeinsam mit seiner Mutter wurde Klaus Rinke 1944 aus Wattenscheid evakuiert. Die Zeit bis zum Kriegsende verbrachte er in Dux und Marienbad in den besetzten Gebieten der Tschechoslowakei. , durften die Tschechen nicht in den Schlossgarten. Wenn es regnete, durften sie auch nicht auf den Bürgersteig, sondern mussten durch die tiefen Wasserpfützen auf der Straße gehen. Setzten sie doch mal ihren Fuß auf den Bürgersteig, kamen irgendwelche Uniformierten und haben sie halb totgeschlagen – das habe ich alles gesehen. Wenn ich es aber erwähne, sind die Sudetendeutschen immer sauer. Meine Mutter hat an einem Sonntagmorgen Brot geholt, als die SA mit den ganzen HDJ-Typen marschierte und für die Kriegshilfe sammelte. Ich wollte das damals sehen, weil ich dachte, es sei ein Klamauk mit den Trommeln, den SA-Hakenkreuzfahnen und den braunen Uniformen. Ich sollte mich nicht weit entfernen, also blieb ich vor dem Bäcker stehen. Damals waren da nur Frauen, die Männer waren ja alle an der Front. Ein Tscheche mit einem verrosteten Fahrrad stellte sich neben mich. Er hat sicher nicht willentlich vergessen mit „Heil Hitler“ zu grüßen. Zehn SA-Leute kamen auf ihn zu und haben ihn halb totgeschlagen. Als er in seiner Blutlache lag, gingen sie weiter. Die Frauen sagten zu ihm: „Das nächste Mal hebst du den Arm, dann wirst du auch nicht geschlagen.“ So war das damals mit den Sudetendeutschen. Da darf man sich nicht wundern, dass die Tschechen nach Ende des Krieges alle umgebracht haben.
Gemeinsam mit seiner Mutter wurde Klaus Rinke 1944 aus Wattenscheid evakuiert. Die Zeit bis zum Kriegsende verbrachte er in Dux und Marienbad in den besetzten Gebieten der Tschechoslowakei. , durften die Tschechen nicht in den Schlossgarten. Wenn es regnete, durften sie auch nicht auf den Bürgersteig, sondern mussten durch die tiefen Wasserpfützen auf der Straße gehen. Setzten sie doch mal ihren Fuß auf den Bürgersteig, kamen irgendwelche Uniformierten und haben sie halb totgeschlagen – das habe ich alles gesehen. Wenn ich es aber erwähne, sind die Sudetendeutschen immer sauer. Meine Mutter hat an einem Sonntagmorgen Brot geholt, als die SA mit den ganzen HDJ-Typen marschierte und für die Kriegshilfe sammelte. Ich wollte das damals sehen, weil ich dachte, es sei ein Klamauk mit den Trommeln, den SA-Hakenkreuzfahnen und den braunen Uniformen. Ich sollte mich nicht weit entfernen, also blieb ich vor dem Bäcker stehen. Damals waren da nur Frauen, die Männer waren ja alle an der Front. Ein Tscheche mit einem verrosteten Fahrrad stellte sich neben mich. Er hat sicher nicht willentlich vergessen mit „Heil Hitler“ zu grüßen. Zehn SA-Leute kamen auf ihn zu und haben ihn halb totgeschlagen. Als er in seiner Blutlache lag, gingen sie weiter. Die Frauen sagten zu ihm: „Das nächste Mal hebst du den Arm, dann wirst du auch nicht geschlagen.“ So war das damals mit den Sudetendeutschen. Da darf man sich nicht wundern, dass die Tschechen nach Ende des Krieges alle umgebracht haben.
Hinter dem Park des Schlosses Dux gab es viele Seen. Dort lebte einer meiner Freunde aus dem Kindergarten, dessen Vater Seewart war, was so etwas Ähnliches wie ein Förster für Seen ist. Er hatte an einem dieser großen Seen ein Holzhaus auf Pfählen, wo wir am Wochenende mit einem Ruderboot rausfuhren und auch geschlafen haben. Mit einem Fernglas guckte er immer nach den Enten, Schwänen und Störchen. Und Fische waren da! Riesige Karpfen! Noch heute träume ich davon. Am Ende des Parks war ein großes Loch in der Mauer und dort hindurch kam man an den See. Die meisten Seen waren an den Rändern dicht mit Schilf bewachsen, die tschechischen Jungs, Teenager, traten das Schilf um und gingen über das Wasser. Als Kind dachte ich: „Oh mein Gott, sie können über Wasser gehen!“ Mit einer grünen Schlange in der Hand kamen sie wieder zurück. Das war unheimlich. Diese Erlebnisse sind mir bis heute in Erinnerung geblieben.
Das hat sich alles im Alter von fünf Jahren abgespielt?
Ja. Mit sechs Jahren, Ende des Kriegs, war ich dann in Bayern. Im Ruhrgebiet zu leben, wurde unmöglich, die Kinder wurden mit den Müttern weggeschickt, weil alles zerbombt war. Ich kenne Essen noch aus der Zeit vor der Bombardierung. Meine Großmutter hat mich nach Essen zum Einkaufen mitgenommen und ich habe die Bilder noch heute im Kopf. Auch das Bild unserer Rückkehr, der Ankunft in Essen mit dem Zug: Essen gab es nicht mehr. Es standen nur noch die Kamine der Gebäude, alles andere war flach.
Wann sind Sie nach Essen zurückgegangen?
45 kamen wir zurück.
Haben Sie als Kind darauf emotional reagiert oder war das einfach die Feststellung „Das sieht jetzt anders aus“?
Als Kind war ich total symbiotisch mit meiner Mutter und meinem Großvater, der sehr wichtig für mich war. Mein Vater kam als Nazi aus dem verlorenen Krieg zurück und hat ständig geprügelt, so wie auch unsere Lehrer. Alle sind von den Vätern geprügelt worden. Sie ließen ihren Frust darüber, dass sie den Krieg verloren hatten, an uns aus.
Damals marschierten die Amerikaner in Bayern ein ![]() Im Frühjahr 1945 wurden weite Teile Bayerns und Süddeutschlands von amerikanischen Truppen besetzt. Im Juli 1945 teilten die Siegermächte Frankreich, Großbritannien, die Sowjetunion und die USA Deutschland in vier Besatzungszonen auf. Das Gebiet der amerikanischen Besatzungszone umfasste die heutigen Bundesländer Bayern, Hessen und Baden-Württemberg sowie die beiden Städte Bremen und Bremerhaven. Siehe auch: John Gimbel, „Amerikanische Besatzungspolitik in Deutschland 1945–1949“, Frankfurt am Main 1968. und wir wurden Amerikaner. Vorher hatten sie uns auch mal kurz mit Tieffliegern bombardiert – so tief, dass wir die Gesichter der Piloten sehen konnten. Sie haben auch mit Maschinengewehren auf uns gefeuert, weil irgendwelche bescheuerten Hitlerjungs eine Flak hatten und auf die Amerikaner schossen. Die standen dann wochenlang irgendwo in Mindelheim, mit Hunderten von Panzern und hatten Angst nach Dirlewang zu kommen. Dabei waren es nur fünf Hitlerjungen mit Kanonen und Munition.
Im Frühjahr 1945 wurden weite Teile Bayerns und Süddeutschlands von amerikanischen Truppen besetzt. Im Juli 1945 teilten die Siegermächte Frankreich, Großbritannien, die Sowjetunion und die USA Deutschland in vier Besatzungszonen auf. Das Gebiet der amerikanischen Besatzungszone umfasste die heutigen Bundesländer Bayern, Hessen und Baden-Württemberg sowie die beiden Städte Bremen und Bremerhaven. Siehe auch: John Gimbel, „Amerikanische Besatzungspolitik in Deutschland 1945–1949“, Frankfurt am Main 1968. und wir wurden Amerikaner. Vorher hatten sie uns auch mal kurz mit Tieffliegern bombardiert – so tief, dass wir die Gesichter der Piloten sehen konnten. Sie haben auch mit Maschinengewehren auf uns gefeuert, weil irgendwelche bescheuerten Hitlerjungs eine Flak hatten und auf die Amerikaner schossen. Die standen dann wochenlang irgendwo in Mindelheim, mit Hunderten von Panzern und hatten Angst nach Dirlewang zu kommen. Dabei waren es nur fünf Hitlerjungen mit Kanonen und Munition.
Die deutsche Rückzugsarmee sehe ich noch vor mir: mit Pferden, ohne Panzer. Die zogen sich mit Flüchtlingen zurück und schliefen bei uns in den Bauernhöfen. Dann kamen die Amis: alle vollgefressen, runde Köpfe, runde Stahlhelme, alles rund. Auf den Panzern habe ich die ersten Schwarzen gesehen. Hunderte von Panzern fuhren durch unser Dorf. Die Schwarzen spuckten dunkle Spucke – das war Kautabak, aber ich dachte: „Die spucken sogar schwarz.“ Sie waren wahnsinnig nett, haben Kekse an uns verteilt, machten Mittagspause, stoppten die Panzer und packten die Kekse und Konserven aus Kisten aus: „Komm mal her.“ Wir hatten solche Angst – wie wilde Tiere, die man ruft. Aber die Amis waren ganz locker. Sie übernahmen dann die großen Radiosender – die Briten Köln und die Amis München und Frankfurt – und machten Jazz. Diese Musik! Wir wurden langsam Teenager und das war unsere Musik. Das war Freiheit! Als man mich fragte: „Wie kannst du nach Amerika gehen?“, antwortete ich: „Die haben mir gezeigt, was Freiheit ist.“ Dieser Kadavergehorsam und diese Saumseligkeit … das war die Diktatur der Kleinbürgerlichkeit. Hitler, Goebbels, Göring, Himmler – das waren die kleinbürgerlichsten Menschen. Und das geht ja bis heute. Die Inquisition, die sie uns antun, diese Missgunst, diese kleinkarierten Machtinhaber, dieses gesunde Volksempfinden. Das ist unglaublich! Das sitzt tief in uns drin, auch noch in den heutigen Generationen. Obwohl sie so tun, als wenn sie etwas anderes wären. Das sitzt ganz tief in den Genen. Wir sind Kriegsvolk. Bei uns sind nur Kriege geführt worden. Zwischen den Goten, Ostgoten, Franken, Westfranken und Ostfranken, die Lothringer – die haben ja alle nur Kriege geführt. Das ist unsere kriegerische Vergangenheit.
War Amerika, Sie haben den Jazz erwähnt, für Sie immer Vorbild und auch Ziel?
Mit dem Jazz und Louis Armstrong, Glenn Miller und wie die alle hießen ![]() Der Trompeter Louis Armstrong (1901 New Orleans – 1971 New York) und der Posaunist Glenn Miller (1904 Clarinda, Iowa – 1944 Ärmelkanal) gehörten zu den einflussreichsten Jazzmusikern in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. kam dann auch Picasso …
Der Trompeter Louis Armstrong (1901 New Orleans – 1971 New York) und der Posaunist Glenn Miller (1904 Clarinda, Iowa – 1944 Ärmelkanal) gehörten zu den einflussreichsten Jazzmusikern in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. kam dann auch Picasso …
Picasso haben Sie in Hamburg gesehen?
Ja, 1956. ![]() „Picasso. 1900–1955“, unter anderem Kunstverein in Hamburg (Kunsthalle), 10. März – 29. April 1956. Da war ich noch in der Lehre. Ich hatte kaum Geld, aber mein Vater war Eisenbahner und ich konnte daher umsonst nach Hamburg fahren. Ich bin um sechs Uhr morgens am Bahnhof angekommen. Die Kunsthalle Hamburg war teilweise noch zerstört – man konnte durch das Dach den Himmel sehen. Wirklich! Da sie erst um zehn Uhr aufmachte, bin ich zum Hafen runtergegangen. Um acht Uhr gab es eine Hafenrundfahrt. Ich habe mein Geld gezählt: Das Geld reichte für eine Wurst, für die Hafenrundfahrt und für ein Foto. Am Hafen wird ja immer ein Foto gemacht und da stehe ich dann mit irgendwelchen Leuten. Um zehn Uhr hatte ich, bis auf das Geld für meine Rückfahrkarte, alles ausgegeben. Davon habe ich mir den Picasso-Katalog gekauft, den ich immer noch habe. Da war das Bild „Guernica“
„Picasso. 1900–1955“, unter anderem Kunstverein in Hamburg (Kunsthalle), 10. März – 29. April 1956. Da war ich noch in der Lehre. Ich hatte kaum Geld, aber mein Vater war Eisenbahner und ich konnte daher umsonst nach Hamburg fahren. Ich bin um sechs Uhr morgens am Bahnhof angekommen. Die Kunsthalle Hamburg war teilweise noch zerstört – man konnte durch das Dach den Himmel sehen. Wirklich! Da sie erst um zehn Uhr aufmachte, bin ich zum Hafen runtergegangen. Um acht Uhr gab es eine Hafenrundfahrt. Ich habe mein Geld gezählt: Das Geld reichte für eine Wurst, für die Hafenrundfahrt und für ein Foto. Am Hafen wird ja immer ein Foto gemacht und da stehe ich dann mit irgendwelchen Leuten. Um zehn Uhr hatte ich, bis auf das Geld für meine Rückfahrkarte, alles ausgegeben. Davon habe ich mir den Picasso-Katalog gekauft, den ich immer noch habe. Da war das Bild „Guernica“ ![]() Pablo Picasso, „Guernica“, 1937. Das Gemälde befindet sich heute im Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía in Madrid.
Pablo Picasso, „Guernica“, 1937. Das Gemälde befindet sich heute im Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía in Madrid.  auf einem Dachlattengerüst ausgestellt. Guernica habe ich als Kind im Bunker erlebt. Guernica war für mich die Illustration meiner Bunkerzeit als Kind in Essen, als die Bomben flogen und die Frauen schrien. Wir Kinder haben gespielt, wir hatten ja keine Todesangst.
auf einem Dachlattengerüst ausgestellt. Guernica habe ich als Kind im Bunker erlebt. Guernica war für mich die Illustration meiner Bunkerzeit als Kind in Essen, als die Bomben flogen und die Frauen schrien. Wir Kinder haben gespielt, wir hatten ja keine Todesangst.
Haben Sie das 56, als Sie das Bild zum ersten Mal gesehen haben, auch direkt darauf beziehen können?
Picasso war für mich modern. Aber ich war vorher schon an einer Volkshochschule in Gelsenkirchen gewesen, in der es ebenfalls Künstler gab, die von moderner Kunst beeinflusst waren. Und auch an der Folkwangschule, an die ich 55 als Abendschüler gegangen bin, lehrten einige, die ehemals Bauhausstudenten waren. Bauhaus war für uns sehr modern. „Der Röhrende Hirsch“, „Der Mann mit dem Goldhelm“, „Der Seemann mit der Pfeife“ oder „Die Zigeunerin“ – das war Dritte-Reich-Zeit.
Können Sie Ihren Zugang zur Kunst beschreiben?
Ich habe noch eine Zeichnung aus der Zeit. Meine Mutter hat sie, Gott sei Dank, nicht weggeschmissen. Als ich irgendwann im Keller in Ratingen war, habe ich in einem Koffer meine alten Zeichnungen entdeckt, und da habe ich gesagt: „Mutter – Danke!“
Bei irgendeinem Klassentreffen vor ein paar Jahren sagten meine ehemaligen Schulkameraden: „Rinke, du sprichst ja.“ Ich muss wohl früher nicht gesprochen haben. Ich weiß nicht warum. Ich hatte auch immer im mündlichen Ausdruck ein Mangelhaft. Erst später bin ich ein Mundtyp geworden. Jetzt kann ich so irre Sachen sagen! Ich kann vor Tausenden von Leuten reden – erst dann werde ich richtig gut. Früher in der Schule hatte ich immer Albträume, dass mich jemand auf eine Bühne zieht. Das war ein Horror für mich! Oder: „Rinke, geh mal vor und sing.“
Wir hatten einen Geschichtslehrer, der auch Zeichenlehrer war, ein ehemaliger Offizier aus der Nazizeit. Als wir in die Schule kamen, tauchte er mit seinen Stiefeln und seinen Breeches-Hosen auf, von seinem Vater hatte er wahrscheinlich eine zivile Tweed-Jacke. Der war ganz gut. Er machte mich darauf aufmerksam, dass ich Talent habe. Wir bekamen Geschichtsunterricht und zu Hause sollten wir irgendeine Zeichnung anfertigen, wie Ritter eine Burg einnehmen. Lehrer Bröker sagte dann: „Rinke, geh mal an die Tafel und zeig denen, wie das aussieht, wenn Raubritter eine Burg einnehmen.“ Heute lebe ich auf so einer Burg.
Als es um die Berufsauswahl ging, sagte Lehrer Bröker: „Wenn Klaus Rinke bei der Stadt im Büro sitzt, wird er die ganze Zeit nur herumzeichnen. Das heißt, er hat den falschen Beruf und wird sich langweilen.“ Mein Vater wollte, dass ich Architekt werde, ich wollte es aber nicht. Man hätte drei Jahre Maurer lernen müssen, und damals hat man noch den Zement und Speis auf der Leiter hochgetragen. Ich bin dann Plakatmaler geworden. Zusammen mit Paul Maenz ![]() Paul Maenz (* 1939 Gelsenkirchen) ist ein deutscher Galerist und Kunstsammler. Er studierte ab 1959 bei Max Burchartz an der Folkwangschule für Gestaltung in Essen und war ab 1964 als Art Director in der Werbeagentur Young & Rubicam (Y&R) in Frankfurt am Main und New York tätig. Zusammen mit Peter Roehr organisierte er 1967 die Ausstellungen „Serielle Formationen“ (Studiogalerie im Studentenhaus der Goethe-Universität, Frankfurt am Main) und „Dies alles, Herzchen, wird einmal dir gehören“ (Galerie Dorothea Loehr, Frankfurt am Main). 1971 eröffnete Maenz eine Galerie in Köln. Sein Programm umfasste wichtige Positionen der Minimal Art und Konzeptkunst, darunter Hans Haacke und Joseph Kosuth sowie Künstler der Mülheimer Freiheit und der Transavanguardia. In den 1980er-Jahren zeigte Maenz als erste Galerie in Deutschland Arbeiten von Keith Haring (1984) und Jeff Koons (1987). hatte ich mich in Westfalen, im Kaufhaus Gelsenkirchen, beworben.
Paul Maenz (* 1939 Gelsenkirchen) ist ein deutscher Galerist und Kunstsammler. Er studierte ab 1959 bei Max Burchartz an der Folkwangschule für Gestaltung in Essen und war ab 1964 als Art Director in der Werbeagentur Young & Rubicam (Y&R) in Frankfurt am Main und New York tätig. Zusammen mit Peter Roehr organisierte er 1967 die Ausstellungen „Serielle Formationen“ (Studiogalerie im Studentenhaus der Goethe-Universität, Frankfurt am Main) und „Dies alles, Herzchen, wird einmal dir gehören“ (Galerie Dorothea Loehr, Frankfurt am Main). 1971 eröffnete Maenz eine Galerie in Köln. Sein Programm umfasste wichtige Positionen der Minimal Art und Konzeptkunst, darunter Hans Haacke und Joseph Kosuth sowie Künstler der Mülheimer Freiheit und der Transavanguardia. In den 1980er-Jahren zeigte Maenz als erste Galerie in Deutschland Arbeiten von Keith Haring (1984) und Jeff Koons (1987). hatte ich mich in Westfalen, im Kaufhaus Gelsenkirchen, beworben. ![]() Zwischen 1954 und 1957 absolvierte Klaus Rinke eine Lehre als Plakatmaler im Westfalenkaufhaus in Gelsenkirchen. Andy Warhol wird sich im Grab umdrehen, denn ich habe schon 53 Marlene Dietrich und andere Stars porträtiert. Das war die Zeit der Filmstars. Später kam Rock ’n’ Roll, das war noch irrer, da war ich noch in der Lehre. Elvis Presley und die ganzen Größen. Damals kam Klaus Doldinger, ein Saxofonist aus Düsseldorf, immer nach Gelsenkirchen, weil wir neben dem Hauptbahnhof den Gelsenkirchener Jazzklub gemacht haben. Weil es vor dem Krieg in den Häusern noch keine Bäder und Duschen gab, war neben dem Hauptbahnhof unterhalb der Straßenbahnhaltestellen ein riesiger Platz, der komplett gefliest war – mit lauter Bädern, Duschen und Umkleideräumen. Wir haben dann die Stadt bedrängt: „Gebt uns das.“ Und dann haben wir daraus einen Jazzklub gemacht. Direkt neben dem Hauptbahnhof Gelsenkirchen unter der ehemaligen Toilette. Ich war ein guter Tänzer, aber Musik machen konnte ich nicht.
Zwischen 1954 und 1957 absolvierte Klaus Rinke eine Lehre als Plakatmaler im Westfalenkaufhaus in Gelsenkirchen. Andy Warhol wird sich im Grab umdrehen, denn ich habe schon 53 Marlene Dietrich und andere Stars porträtiert. Das war die Zeit der Filmstars. Später kam Rock ’n’ Roll, das war noch irrer, da war ich noch in der Lehre. Elvis Presley und die ganzen Größen. Damals kam Klaus Doldinger, ein Saxofonist aus Düsseldorf, immer nach Gelsenkirchen, weil wir neben dem Hauptbahnhof den Gelsenkirchener Jazzklub gemacht haben. Weil es vor dem Krieg in den Häusern noch keine Bäder und Duschen gab, war neben dem Hauptbahnhof unterhalb der Straßenbahnhaltestellen ein riesiger Platz, der komplett gefliest war – mit lauter Bädern, Duschen und Umkleideräumen. Wir haben dann die Stadt bedrängt: „Gebt uns das.“ Und dann haben wir daraus einen Jazzklub gemacht. Direkt neben dem Hauptbahnhof Gelsenkirchen unter der ehemaligen Toilette. Ich war ein guter Tänzer, aber Musik machen konnte ich nicht.
Die Plakatmalerausbildung war wahrscheinlich noch nicht die intensive Auseinandersetzung mit der Kunst?
Doch! Wir machten auch die Werbung, aber nicht nur. Wir machten alle Blickfänge für die Dekorateure. Wir machten manchmal überdimensionale Rosen aus Gips und so etwas.
Und wir hatten einen Erfrischungsraum mit einer Jazzband, eine Combo, die Tanzmusik – Swing – machte. Alle 14 Tage kam eine neue Band von irgendwoher. Hunderte von Frauen kamen zum Tanztee und aßen Torten. So etwas gibt es heute gar nicht mehr. Und weil ich so modern zeichnete, sollte ich immer die Namen der Combo auf vier Schilder malen. Das kam aus den 20er-Jahren und ist nach dem Krieg weitergeführt worden. Ich habe auch noch Fotos von mir als Mannequin. Als Lehrling musste ich vor dem Direktor des Geschäfts Mode vorführen. „Ich?“ Die Gesellen waren Propagandamaler von Hitler. Wir haben Schablonen- und Spritztechnik gelernt, das konnten komischerweise alle, weil sie so im Hitlerismus gemalt hatten. Das waren alles verklemmte Künstler. Immer wenn wir nichts zu tun hatten, holten die Leinwände raus und malten Sonnenblumen und irgendwelche bescheuerten Alpenlandschaften. Sie wären gerne Künstler geworden, aber sie hatten Familien. Das, was sie nicht mehr werden konnten, wollte ich werden. Deswegen habe ich nie mehr irgendetwas anderes als Kunst gemacht.
Und was genau war das? Was wollten Sie werden? Was haben Sie sich vorgestellt?
Ein freies Leben. Kunst machen. Meine Gefühle ausdrücken. Etwas bewirken! Und aus der Anonymität herauskommen.
Also expressiv?
Expressionist bin ich komischerweise nicht gewesen, das ist interessant. Ich habe niemals meine Seele gezeigt, sondern bin immer Prototyp gewesen, ein Neutrum. Ich zeige die Welt. Und das ist der Unterschied – auch Beuys gegenüber. Beuys war fasziniert von mir. Ich bin ein Übermensch gewesen, was viel mit dem Dritten Reich und der Kirche zu tun gehabt hat. Ich bin in der Kirche groß geworden – in Essen-Katernberg, 300 Meter von der Zeche Zollverein, in der Heilig-Geist-Kirche. Mein Großvater war der Küster. Wenn man das weiß, kann man analysieren, was meine ganzen Performances waren – und auch meine ganze Kunst. Beuys hat immer gesagt: „Wenn du was machst, dann ist das immer was. Ich formuliere das nie aus.“ Er lässt das im Nebel, im Dunst der Vorstellungsfähigkeiten. Ich bin immer glücklich wenn es da ist, reell in der Welt, ein Hindernis.
Das war ein Schritt damals. Bis 66 haben Sie gemalt?
Ich fing 53 an. Erst war ich auf der Abendschule. Das hieß „Dekoratives Zeichnen und Malen“, war aber schon von Picasso und Bauhaus beeinflusst. „Modern sein“ hieß neue Sachen machen, nicht nur einen Abklatsch der Natur.
Warum war „modern sein“ so wichtig?
„Modern sein“ war revolutionär. Diese Dritte-Reich-Typen hassten das wie die Pest. Wir haben uns auch anders angezogen. In Essen haben sie uns Steine nachgeschmissen, ich habe mich sogar richtig geprügelt. Als Studenten waren wir immer in Essen. Einmal haben wir dort Frikadellen gegessen, als so ein Stalingrad-Kämpfer uns beschimpfte, weil wir Bärte hatten und komisch angezogen waren. Er erzählte, was sie für tolle Typen waren und was sie in Stalingrad alles gemacht hätten. Da habe ich ihm eine reingehauen, sodass er quer über die Straße geflogen ist. Heulend kam er zurück und fragte, warum ich das gemacht hätte. Ich sagte: „Sprich nicht so über uns, wir sind viel härter als die. Die haben verloren, wir sind die Gewinner.“ Ich habe mich gewonnen und das war wichtig. Ich bin ja dann auch sofort nach Frankreich gegangen.
Wenn Sie sagen, es war wichtig, es war revolutionär …
Wir waren etwas Besonderes, wenn wir durch Gelsenkirchen oder Essen gegangen sind. Das Ruhrgebiet ist ja ein Konglomerat von Städten – wenn in Gelsenkirchen nichts los war, haben wir die Straßenbahn genommen und sind nach Essen gefahren. Wenn da nichts los war, haben wir die Straßenbahn genommen und sind nach Bochum gefahren. An den Wochenenden trieben wir uns im Ruhrgebiet herum. Wir malten Jazzkeller aus, und bei den Essener Jazztagen hat Ella Fitzgerald im Altenessener Jazzclub für uns gesungen. ![]() Die Essener Jazztage waren ein Jazzfestival, das von 1959 bis 1961 in der Grugahalle in Essen ausgerichtet wurde. Im Rahmen des Programms trat 1959 die renommierte Jazzsängerin Ella Fitzgerald (1917 Newport News, Virginia – 1996 Beverly Hills) auf. Das spielte alles eine Rolle.
Die Essener Jazztage waren ein Jazzfestival, das von 1959 bis 1961 in der Grugahalle in Essen ausgerichtet wurde. Im Rahmen des Programms trat 1959 die renommierte Jazzsängerin Ella Fitzgerald (1917 Newport News, Virginia – 1996 Beverly Hills) auf. Das spielte alles eine Rolle.
Hatten Sie eine Vorstellung, wohin das einmal führen sollte?
Es gab kein Licht am Horizont. Ich wollte etwas, das die Lehrer nicht wollten. Die Folkwangschullehrer waren zum Beispiel froh, dass sie einen Job hatten, sonst wären sie ganz arm gewesen. Viele Künstler im Ruhrgebiet gaben Zeichenunterricht an der Volkshochschule. Was auch ganz wichtig war, war das Café Funke in Gelsenkirchen hinter dem Hauptbahnhof. Darüber müsste Paul Maenz Ihnen ebenfalls etwas erzählen können – obwohl er sagt, das wäre die schlimmste Zeit seines Lebens gewesen. Das war ein Café für Hausfrauen, die Buttercremetorte aßen. Kaffee trinken, Buttercreme, drei, vier, fünf Etagen Fett! Mountains! Und diese Künstler aus dem Ruhrgebiet haben den Cafébesitzer Funke überzeugt, dort Ausstellungen zu machen. Es gab dann einmal in der Woche eine Diskussion mit den Künstlern über diese Ausstellungen. In den frühen 50er-Jahren! Und ich habe die Künstler immer bewundert, mit welcher Vehemenz sie ihren Künstlerstatus gegenüber den Kleinbürgern und diesem gesunden Volksempfinden verteidigten. Da wollte ich hin!
Gab es zu der Zeit schon Künstler, die ein bisschen älter waren als Sie und zu denen Sie aufgeschaut haben? Oder die Sie sich zum Vorbild nehmen konnten? Ich glaube, die Arbeiten von Yves Klein kannten sie relativ früh, die „Anthropometrien“ ![]() Ab Februar 1960 fertigte Yves Klein seine sogenannten „Anthropometrien“ an, bei denen blaue Farbe mit dem Körperabdruck nackter Modelle auf die Leinwand übertragen wurde. Zu den bekanntesten Arbeiten dieser Werkreihe gehören „Monique (ANT 57)“ (1960), „Anthropométrie sans titre (ANT 19)“ (1960) und „Anthropométrie de l’époque bleue (ANT 82)“ (1960). .
Ab Februar 1960 fertigte Yves Klein seine sogenannten „Anthropometrien“ an, bei denen blaue Farbe mit dem Körperabdruck nackter Modelle auf die Leinwand übertragen wurde. Zu den bekanntesten Arbeiten dieser Werkreihe gehören „Monique (ANT 57)“ (1960), „Anthropométrie sans titre (ANT 19)“ (1960) und „Anthropométrie de l’époque bleue (ANT 82)“ (1960). .
Ja, der kam 57. Mein Vater ist 1956 als Eisenbahner nach Ratingen-Ost versetzt worden, und ich habe in Essen-Kettwig eine alte Schreinerei gemietet, war aber oft bei meinen Eltern. Meine Mutter kochte immer und ich kam die Reste essen. Manchmal kam ich auch nachts nach Hause, aß alles auf, was noch übrig geblieben war und haute dann morgens wieder ab – wie ein Tier. Im Juni 57 bin ich dann in die Altstadt zu Alfred Schmela gegangen, der zufällig mit Yves Klein eröffnete. ![]() Alfred Schmela (1918 Dinslaken – 1980 Düsseldorf) eröffnete 1957 in der Hunsrückenstraße 16–18 in Düsseldorf seine Galerie mit der Ausstellung „Yves, Propositions monochromes“ (31. Mai – 23. Juni 1957). Sein Programm umfasste wesentliche Positionen der deutschen Nachkriegskunst, darunter Joseph Beuys, Gerhard Richter und Künstler aus dem Umfeld der ZERO-Bewegung. Es gibt keine Zufälle im Leben! Das waren keine großen Formate. Schmela hatte eine ganz kleine Galerie. Grüne, rote, rosa, blaue, gelbe, goldene, weiße monochrome Dinger. Ich kam am nächsten Morgen in Essen in die Schule und sagte: „Die in Düsseldorf spinnen voll und ganz.“ Als wir mit der Malerei anfingen, mussten wir als Pinselübungen auch monochrome Bilder malen. Das hatte mit dem Bauhaus zu tun: schwarz, weiß, rot, grau, gelb, grün, blau geteilt.
Alfred Schmela (1918 Dinslaken – 1980 Düsseldorf) eröffnete 1957 in der Hunsrückenstraße 16–18 in Düsseldorf seine Galerie mit der Ausstellung „Yves, Propositions monochromes“ (31. Mai – 23. Juni 1957). Sein Programm umfasste wesentliche Positionen der deutschen Nachkriegskunst, darunter Joseph Beuys, Gerhard Richter und Künstler aus dem Umfeld der ZERO-Bewegung. Es gibt keine Zufälle im Leben! Das waren keine großen Formate. Schmela hatte eine ganz kleine Galerie. Grüne, rote, rosa, blaue, gelbe, goldene, weiße monochrome Dinger. Ich kam am nächsten Morgen in Essen in die Schule und sagte: „Die in Düsseldorf spinnen voll und ganz.“ Als wir mit der Malerei anfingen, mussten wir als Pinselübungen auch monochrome Bilder malen. Das hatte mit dem Bauhaus zu tun: schwarz, weiß, rot, grau, gelb, grün, blau geteilt.
Bei Schmela habe ich zum Beispiel 1957 auch zum ersten Mal Beuys gesehen. Er war damals noch gar nicht bekannt. Ich kann mich nur erinnern, dass da im Juni – es war ein unheimlich heißer Tag – einer mit einem riesigen Zimmermannshut und Gummistiefeln stand. Das war Beuys. Und da habe ich gedacht: „Was ist das für ein komischer Typ!“
Am 1. April fing ich mein Hauptstudium an der Folkwangschule an. ![]() Von 1957 bis 1960 studierte Klaus Rinke Malerei an der Folkwangschule in Essen. Eine Woche später kam ein englischer klassischer Tanzlehrer, der bei Kurt Jooss
Von 1957 bis 1960 studierte Klaus Rinke Malerei an der Folkwangschule in Essen. Eine Woche später kam ein englischer klassischer Tanzlehrer, der bei Kurt Jooss ![]() Kurt Jooss (1901 Wasseralfingen – 1979 Heilbronn) war ein Tänzer und Choreograf, der als wichtiger Wegbereiter des deutschen Ausdruckstanzes gilt. Nach seiner Ausbildung bei Rudolf von Laban und Lubov Egorova gehörte er 1925 zu den Mitbegründern der Westfälischen Akademie für Bewegung, Sprache und Musik, aus der 1928 das Folkwang-Tanztheater-Experimentalstudio hervorging. 1933 emigrierte er nach Devon in Südengland und leitete dort bis 1940 eine Tanzschule. Von 1949 bis zu seinem Ruhestand 1968 war Jooss erneut als Tanzpädagoge und Professor an der Folkwangschule in Essen tätig. Zu seinen Studenten zählen Pina Bausch, Susanne Linke und Reinhild Hoffmann. , dessen Studentin Pina Bausch war, unterrichtete, in unsere Klasse. Pina kannte ich, weil wir zusammen an der Schule angefangen haben. Mit einigen ihrer Kollegen war ich befreundet. Sie selbst war immer sehr mager und von Kurt Jooss so sehr beschützt, dass man gar nicht an sie rankam. Ich war ein unheimlicher Rock-’n’-Roll-Tänzer, die Tänzerinnen wollten immer mit mir tanzen: „Nimmst du mich mit nach Altenessen zum Rock ’n’ Roll. Tanzen?“ Bei Kurt Jooss durften sie keinen Rock ’n’ Roll tanzen, sondern nur ungarisch, klassisch, spanisch und Modern Dance. Mister Carey, der englische Tanzlehrer, hatte einen französischen Wagen, einen Renault, und fragte: „Wer hat Lust, mit mir nach Paris zu kommen? Ich muss nach Paris, um mein Auto zu verkaufen.“ Ich hatte wieder einmal kein Geld, aber es machte mir nichts, kein Geld zu haben. Und so bin ich mit ihm nach Paris gefahren. Nachmittags um fünf Uhr sind wir los. Damals gab es in Belgien und Frankreich keine Autobahn. Wir fuhren über die Nationale, die Ardennen und kamen um ein Uhr nachts hinter Soissons in einem Dorf an. Dort stoppte er. In einer Kneipe brannte noch Licht, er ging hinein und mietete in der Pension für ihn und mich ein Zimmer. Es wäre zu anstrengend gewesen, nachts noch nach Paris reinzufahren. Am nächsten Tag sind wir ziemlich früh morgens raus. Da gab es nichts als Felder und zwei Libanon-Zedern, zwischen Bourges und Porte de la Villette gab es noch Bauern. An der Pont de Levallois schubste Denis Carey mich raus und sagte: „In einer Woche, am Donnerstag um fünf Uhr treffen wir uns auf der anderen Seite wieder.“
Kurt Jooss (1901 Wasseralfingen – 1979 Heilbronn) war ein Tänzer und Choreograf, der als wichtiger Wegbereiter des deutschen Ausdruckstanzes gilt. Nach seiner Ausbildung bei Rudolf von Laban und Lubov Egorova gehörte er 1925 zu den Mitbegründern der Westfälischen Akademie für Bewegung, Sprache und Musik, aus der 1928 das Folkwang-Tanztheater-Experimentalstudio hervorging. 1933 emigrierte er nach Devon in Südengland und leitete dort bis 1940 eine Tanzschule. Von 1949 bis zu seinem Ruhestand 1968 war Jooss erneut als Tanzpädagoge und Professor an der Folkwangschule in Essen tätig. Zu seinen Studenten zählen Pina Bausch, Susanne Linke und Reinhild Hoffmann. , dessen Studentin Pina Bausch war, unterrichtete, in unsere Klasse. Pina kannte ich, weil wir zusammen an der Schule angefangen haben. Mit einigen ihrer Kollegen war ich befreundet. Sie selbst war immer sehr mager und von Kurt Jooss so sehr beschützt, dass man gar nicht an sie rankam. Ich war ein unheimlicher Rock-’n’-Roll-Tänzer, die Tänzerinnen wollten immer mit mir tanzen: „Nimmst du mich mit nach Altenessen zum Rock ’n’ Roll. Tanzen?“ Bei Kurt Jooss durften sie keinen Rock ’n’ Roll tanzen, sondern nur ungarisch, klassisch, spanisch und Modern Dance. Mister Carey, der englische Tanzlehrer, hatte einen französischen Wagen, einen Renault, und fragte: „Wer hat Lust, mit mir nach Paris zu kommen? Ich muss nach Paris, um mein Auto zu verkaufen.“ Ich hatte wieder einmal kein Geld, aber es machte mir nichts, kein Geld zu haben. Und so bin ich mit ihm nach Paris gefahren. Nachmittags um fünf Uhr sind wir los. Damals gab es in Belgien und Frankreich keine Autobahn. Wir fuhren über die Nationale, die Ardennen und kamen um ein Uhr nachts hinter Soissons in einem Dorf an. Dort stoppte er. In einer Kneipe brannte noch Licht, er ging hinein und mietete in der Pension für ihn und mich ein Zimmer. Es wäre zu anstrengend gewesen, nachts noch nach Paris reinzufahren. Am nächsten Tag sind wir ziemlich früh morgens raus. Da gab es nichts als Felder und zwei Libanon-Zedern, zwischen Bourges und Porte de la Villette gab es noch Bauern. An der Pont de Levallois schubste Denis Carey mich raus und sagte: „In einer Woche, am Donnerstag um fünf Uhr treffen wir uns auf der anderen Seite wieder.“
Und dann waren Sie eine Woche in Paris?
Ja. Ich war 17 Jahre alt, sprach kein Französisch und bin zu Fuß gegangen, weil ich Angst vor der Métro hatte. Ich habe gedacht, wenn ich da hineingehe, komme ich nie wieder raus. Eine alte Dame, die an der Pont de Levallois eine Pension hatte, habe ich nach einem Zimmer gefragt. Es war ganz billig. Die fand es prima, dass sie mit mir Deutsch sprechen konnte – ich nehme an, sie hat sich noch an die deutsche Armee erinnert … Dort habe ich zum ersten Mal ein Bidet gesehen. Was machen die denn auf dieser Toilette? Wie kann man durch so ein dünnes Loch da …
Woher hatten Sie das Geld für den Aufenthalt?
Ich habe ganz wenig gebraucht, habe trockenes Brot gegessen. Und weil die dort Wein tranken, habe ich mir einen billigen Wein gekauft – ein großer Fehler. Zum Brot habe ich eine Flasche Wein getrunken und dann so starken Durchfall bekommen, dass ich zwei Tage verlor und nur in meinem Zimmer hockte.
Was haben Sie in Paris angestellt?
Ich habe dolle Sachen gesehen. Am ersten Tag in Paris bin ich zum Beispiel zu Fuß zum Louvre gegangen. Ich kam morgens um zehn oder elf Uhr am Louvre an, und da kam ein schwarzer Wagen – ohne Verdeck, aus dem 19. Jahrhundert – mit Existenzialisten: Weiber mit langen schwarzen Haaren und schwarz angezogen, Männer mit Bärten, ungepflegt – die kamen da mit einer hohen Geschwindigkeit an und fuhren auf zwei Rädern um die Kurve direkt an den Louvre. Ich hatte so etwas nie gesehen. Existenzialisten! Für mich war das ein Wahnsinn. Als ich dann im Juni 57 das erste Mal Beuys sah, habe ich gedacht: „Das ist ein Existenzialist.“
Im Louvre habe ich die „Mona Lisa“ ![]() Leonardo da Vinci, „La Gioconda“ (Mona Lisa), 1503–1519. gesehen. Daneben hing „Johannes der Täufer“
Leonardo da Vinci, „La Gioconda“ (Mona Lisa), 1503–1519. gesehen. Daneben hing „Johannes der Täufer“ ![]() Leonardo da Vinci, „San Giovanni Battista“ (Johannes der Täufer), 1513–1516.
Leonardo da Vinci, „San Giovanni Battista“ (Johannes der Täufer), 1513–1516.  – den fand ich interessant. Und „Madame Récamier“
– den fand ich interessant. Und „Madame Récamier“ ![]() Jacques-Louis David, „Madame Récamier“, 1800.
Jacques-Louis David, „Madame Récamier“, 1800.  von David oder „Die Krönung Napoleons“
von David oder „Die Krönung Napoleons“ ![]() Jacques-Louis David, „Sacre de l’empereur Napoléon Ier et couronnement de l'impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804”, 1806/07.
Jacques-Louis David, „Sacre de l’empereur Napoléon Ier et couronnement de l'impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804”, 1806/07.  , wo er sich selbst die Krone aufsetzt – ein tolles Bild! Ich hatte nie zuvor so ein großes Bild gesehen. Ein wahnsinniger Schinken, das Bild ist 20 Meter lang. Im Jeu de Paume hingen früher noch die Impressionisten – dort bin ich mit Claude Monet konfrontiert worden. „Die Kathedrale von Rouen“
, wo er sich selbst die Krone aufsetzt – ein tolles Bild! Ich hatte nie zuvor so ein großes Bild gesehen. Ein wahnsinniger Schinken, das Bild ist 20 Meter lang. Im Jeu de Paume hingen früher noch die Impressionisten – dort bin ich mit Claude Monet konfrontiert worden. „Die Kathedrale von Rouen“ ![]() Claude Monet, „ La cathédrale de Rouen“, Serie von 33 Bildern, 1892–1894.
Claude Monet, „ La cathédrale de Rouen“, Serie von 33 Bildern, 1892–1894.  . Da bin ich ausgeflippt. Dass ich Zeitkünstler wurde, hat auch damit zu tun. Dass jemand Zeit malen konnte, hat mich unheimlich beeindruckt. Heute bin ich mit dem Urenkel von Claude Monet, Philippe Piguet, befreundet.
. Da bin ich ausgeflippt. Dass ich Zeitkünstler wurde, hat auch damit zu tun. Dass jemand Zeit malen konnte, hat mich unheimlich beeindruckt. Heute bin ich mit dem Urenkel von Claude Monet, Philippe Piguet, befreundet.
Würden Sie sagen, die Kathedralen waren ein Schlüssel?
Die waren ganz wichtig für mich. Dass jemand diese Phasen im Jahr – mittags, morgens, Winter, Spätsommer – malen konnte … Dasselbe Sujet, immer die gleiche Kathedrale, in unterschiedlicher Farbwahl. Ich wurde wahnsinnig. Mich haben aber noch andere Sachen zur Kunst gebracht. Einer meiner Rinke-Großonkel war zwölf Jahre lang in der Preußischen Armee. Da man dort nach zwölf Jahren entlassen wird, hat er sich bei den Holländern verdingen lassen und ist bei denen Polizist geworden. Die Holländer haben ihn nach Suriname, oberhalb von Brasilien, geschickt, wo er eine Schwarze geheiratet hat. Diese Familie lebte vor dem Dritten Reich im Schwarzwald. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, konnten sie nicht in Deutschland bleiben, weil sie ja in Suriname geboren war, daher sind sie nach Holland ausgewandert. Aus dieser Familie gab es in Rotterdam noch eine Tante, Tante Else. Sie war gemischt: schwarz mit krausen Haaren. Schon als Schuljunge bin ich immer in meinen Ferien, weil ich über meinen Vater einen Freifahrtschein für die Bahn hatte, nach Rotterdam gefahren. Sie arbeitete in einem Büro im Hafen, in Holland nannte man das Kontor. Der Kontorvorsteher, Herr Mohl, hatte viele Töchter und war kunstbeflissen. Damals hatte Ossip Zadkine seine Skulptur „Mann ohne Herz“ ![]() Ossip Zadkine, „De verwoeste Stad“, 1951–1953.
Ossip Zadkine, „De verwoeste Stad“, 1951–1953.  im Hafen von Rotterdam aufgestellt. Die Holländer haben sich aufgeregt, das sei „Scheißkunst“. Monatelang stritten da Trauben von Menschen, ob das Kunst sei oder Verhohnepipelung. Das habe ich mitbekommen. Und Herr Mohl nahm mich in Museen mit und zeigte mir Impressionisten, die die Rotterdamer gesammelt haben. Er hat mir auch ein Buch geschenkt – das habe ich heute noch –„Die Impressionisten“. Das war – 1952 oder 53.
im Hafen von Rotterdam aufgestellt. Die Holländer haben sich aufgeregt, das sei „Scheißkunst“. Monatelang stritten da Trauben von Menschen, ob das Kunst sei oder Verhohnepipelung. Das habe ich mitbekommen. Und Herr Mohl nahm mich in Museen mit und zeigte mir Impressionisten, die die Rotterdamer gesammelt haben. Er hat mir auch ein Buch geschenkt – das habe ich heute noch –„Die Impressionisten“. Das war – 1952 oder 53.
Das heißt, Sie hatten einige frühe Begegnungen mit der Kunst?
Das ist nicht umsonst. Ich vermute, dass das alles vorbestimmt ist. Das kommt alles auf einen zu, wenn man offen ist und sich gehen lässt. Dann ist es ein wahnsinnig interessantes Leben. Die Holländer mochten mich. Die Holländer haben zwar die Deutschen gehasst, aber mich mochten sie, weil ich jung war. Wenn ich in einem Kaff außerhalb von Rotterdam Kanäle zeichnete, kamen die alten Weiber und gaben mir Tee oder „kopje koffie“ und ein bisschen Gebäck. Sie haben mich eingeladen und auf mich eingeredet. Holländisch ist nicht einfach zu sprechen, obwohl es dem Deutschen nah ist. Man versteht es, wenn man richtig zuhört und wenn man ein bisschen Plattdeutsch kann. Meine Großmutter hat Plattdeutsch gesprochen, also ich konnte einiges verstehen. Ich hatte dort auch meine erste Freundin, Joke, ein dolles Mädchen. Eine Blonde, Große, die immer Fahrrad fuhr und tolle Beine hatte. Ich war früher ein irrsinnig guter Sportler, Leichtathlet. 100-Meter-Läufer. Ich wurde richtig trainiert, bin aber später nur noch hinter Mädchen hergelaufen.
Wir mussten um sieben Uhr da sein und das Atelier sauber machen, damit die um acht Uhr anfangen konnten – abends bis acht sollten die Pinsel ausgewaschen sein. Paul Maenz und ich mussten sonntags Markisen herunterdrehen, wenn die Sonne schien. Das war unangenehm, wie wir da vor den Leuten arbeiten mussten. Und im Ruhrgebiet war was los. Das war da nicht ausgestorben. Da wurde das erste Geld nach dem Krieg verdient. Hunderttausende Männer waren zum Arbeiten ins Ruhrgebiet gekommen, ein Korso, jeden Abend. Es gab kein Fernsehen, die gingen alle raus. Die schönsten Mädchen waren polnischen Ursprungs. In jedem Haus waren fünf Polen. Wir sind ja mit Polen groß geworden.
Warum hatten Sie den Wunsch, nach der Folkwangschule noch eine akademische Ausbildung zu machen?
Ich wollte ein freies Leben. Ich sah ja diese Leibeigenen. Wer irgendwo einen Job annimmt, der verkauft seine Lebenszeit. Ich wollte meine Lebenszeit für mich haben und darüber verfügen. Und mir war klar, das ging nur mit meinem Talent.
Als ich in der Schule war, gab es nichts zu essen. Bis 48 gab es gar nichts zu essen, die Eisenbahner haben sowieso nicht viel verdient. Wir waren mager und aßen nichts. Bis 48 klauten wir alles in den Schrebergärten: Möhren, halbreife Äpfel, auch Kaps (Weißkohl) und Wirsing haben wir gegessen. Alles roh, wie Tiere. Die Eltern waren damit beschäftigt zu hamstern – wir waren alleine und uns überlassen. Die Briten im Ruhrgebiet mochten uns. Wenn wir am Ruhrschnellweg spielten, kamen die britischen Panzer und die Soldaten haben uns zugewunken. Sonst waren die Engländer zu den deutschen Erwachsenen unheimlich hart. Wir übernahmen auch alle Werke: Stahlwerke und Ziegeleien gehörten uns, den ehemaligen Hitlerjungen und uns. Wir waren Gangs. Wir waren Wattenscheid und haben ganz schlimme Kriege mit Gelsenkirchen geführt. Wir waren auf der Grenze. Als ich nach Los Angeles kam und die Gangs mitkriegte, haben alle immer Angst gehabt, aber ich habe gesagt: „Ich habe keine Angst. Ich war ja selber mal in einer Gang.“
Wie kann man sich diese Gangs vorstellen?
Wir haben den Krieg weitergeführt. Wir sind mit Krieg, mit Auseinandersetzungen, mit dem Feind, groß geworden. Das ist dann später im Fußball weiter ausgetragen worden. Ich konnte niemals alleine in den Unteren Watermannsweg gehen, denn da wurde ich von den Unteren-Watermannsweg-Leuten verprügelt. Wir haben uns blutig geschlagen. Wenn meine Mutter Wäsche wusch, musste ich immer mit einem Bollerkarren in das Feindesgebiet zu einer Heißmangel. Da habe ich richtige Manschetten gehabt. Meine Mutter hat mir ein Netz und ein Portemonnaie mit lauter Groschen und Pfennigstücken mitgegeben und dann bin ich da runter. Die haben mich angehalten und wollten mich verprügeln – dann habe ich einem das schwere Portemonnaie mit dem Kleingeld auf den Kopf gehauen, sodass er ein Loch hatte. Der ist umgefallen und als die Erwachsenen ankamen, rannte ich mit dem Bollerkarren weg. Die Bollerkarren hatten früher Aluminiumräder und es gab keinen Asphalt, das waren noch diese Katzenköpfe, das knallte. Hamstern mit dem Bollerkarren.
Das war damals für Sie eine alltägliche Situation?
Ja, das war unser Leben. Uns gehörten ganze Steinhalden. Im Sommer waren auf den Steinhalden lauter Schwalbenschwänze, die Schmetterlinge. Ich habe Schmetterlinge gefangen und eine Schmetterlingssammlung gemacht. Oder die Bombentrichter, die voller Wasser waren. Im Ruhrgebiet ist der Mutterboden nicht so tief, danach kommt Lehm und darunter Ton. Die Bombentrichter hielten das Wasser, weil darunter Ton war und in den Bombentrichtern entstanden Wasserlinsen, Molche, Stechlitze, Libellen, Gelbbrandkäfer. Damit sind wir groß geworden. Warum bin ich Wasserkünstler geworden? Wegen dieser zahllosen Bombentrichter. Da habe ich mal einen riesen Karpfen, der zwischen zwei Steinen hing, gefangen.
Mein Vater war nicht doof, er war Nazi und hatte ein Fahrrad aus der Zeit vor dem Krieg im Kohlenkeller auseinandergenommen und überall unter den Kohlen und hinter Schränken versteckt. Nach dem Krieg baute er es wieder zusammen und schenkte es mir zu Weihnachten. Ein NSU-Fahrrad. Ich war der Erste in unserer Straße, der ein Fahrrad hatte. Das war wichtig, denn damit konnte ich nach Essen fahren. Und das wiederum ist alles ganz wichtig für meine Kunst und meine Globalisierung. Ich wollte immer weg aus diesem Kleinkarierten. Das Ruhrgebiet war durch die Bergschäden unter null gesenkt worden – so viel Druck auf dem Kopf kann man gar nicht ertragen. Ich wollte irgendwohin, wo ich freier wurde und bin dann sofort nach Frankreich gegangen.
War es wichtig, Deutschland zu verlassen?
Dadurch, dass ich schon im April/Mai 57 in Paris gewesen war, wusste ich dass es auch andere Kulturen gab. Wir haben im Caveau de la Huchette Dixieland getanzt ![]() Le Cavaeu de la Huchette ist ein Jazzklub im Pariser Quartier Latin. – den Keller gibt es immer noch. Und da haben die Jungs die Mädchen in die Mangel genommen, wenn sie mit einem Deutschen tanzten.
Le Cavaeu de la Huchette ist ein Jazzklub im Pariser Quartier Latin. – den Keller gibt es immer noch. Und da haben die Jungs die Mädchen in die Mangel genommen, wenn sie mit einem Deutschen tanzten.
Außerdem hatten wir einen Türken in der Folkwangschule, Otto Liebsch. Der studierte Grafik. Sein Bruder studierte in Köln auf einer Diplomatenschule, der Vater war Deutscher, die Mutter Griechin, groß geworden sind beide in Ankara. Und der Bruder sollte 1959 einen gebrauchten Mercedes nach Ankara überführen. In der Schule wurde herumgefragt: Wer fährt mit nach Ankara? Und ich habe mich natürlich gemeldet, hatte aber überhaupt kein Geld. Der Besitzer des Hauses in Kettwig, in dem ich damals mein Atelier hatte, war der Stadtsparkassendirektor. Zu ihm bin ich gegangen und habe gefragt, ob er mir Geld leihen könnte. Ich war damals 19 Jahre alt. „Jemandem, der keinen Beruf hat, leiht man kein Geld.“ – „Wenn ich wiederkomme, werde ich sofort arbeiten und das Geld zurückzahlen.“ Er hat mir schließlich das Geld gegeben. Und dann bin ich mit einem Poeten aus Köln, Frank, nach Thessaloniki gefahren. Frank schrieb nihilistische Literatur und war in jedes Mädchen verliebt, das wir unterwegs sahen. Es war furchtbar. Weil er Liebeskummer hatte, wollte er sich in Jugoslawien umbringen. Davor habe ich ihn gerettet, indem ich ihm einen Kinnhaken verpasste. Darüber könnte ich einen Roman schreiben. Von Thessaloniki aus ist der Bruder von Otto Liebsch in die Türkei weitergefahren und wir sind, vermittelt durch jüdische Jungs, per Autostopp weitergefahren. Der Vater des einen hatte ein Büro im Hafen von Thessaloniki. Dort haben wir geschlafen und am Morgen mussten wir bis sechs Uhr raus sein. Die haben uns einen Lastwagenfahrer vermittelt, der Pfirsiche nach Piräus brachte.
Sorbas, der Grieche ![]() „Alexis Sorbas“, Regie: Michael Cacoyannis, 142 Minuten, 1964. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Nikos Kazantzakis und erzählt die Geschichte des griechischen Bergarbeiters Alexis Sorbas. Er wurde 1965 mit drei Oscars ausgezeichnet. … das haben wir alles noch erlebt. 1959 gab es keine Touristen in Griechenland. Da war es aufsehenerregend, als wir, diese jungen Typen, dort auftauchten. Wir hatten uns mit anderen Studenten auf Santorini verabredet und sind mit dem Boot hinübergefahren, als uns gleichaltrige Griechen auf Deutsch ansprachen, ob wir nicht Lust hätten in die Erste Klasse zu kommen, ihre Mutter würde uns gerne mal kennenlernen. Bis dahin waren wir zusammen mit den Schäfern und Ziegen auf dem Deck. In der Ersten Klasse trafen wir dann die Frau des griechischen Unterrichtsministers, Frau Karidis. Frank und ich wollten von Santorini nach Kreta trampen und von Kreta nach Alexandrien. Wir hatten uns mit einem Matrosen am Hafen angefreundet, einem Kreter, der fragen sollte, ob uns jemand auf dem Boot mitnehmen könnte. Und dann tauchte da am Vulkan im Blau die Christina Onassis
„Alexis Sorbas“, Regie: Michael Cacoyannis, 142 Minuten, 1964. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Nikos Kazantzakis und erzählt die Geschichte des griechischen Bergarbeiters Alexis Sorbas. Er wurde 1965 mit drei Oscars ausgezeichnet. … das haben wir alles noch erlebt. 1959 gab es keine Touristen in Griechenland. Da war es aufsehenerregend, als wir, diese jungen Typen, dort auftauchten. Wir hatten uns mit anderen Studenten auf Santorini verabredet und sind mit dem Boot hinübergefahren, als uns gleichaltrige Griechen auf Deutsch ansprachen, ob wir nicht Lust hätten in die Erste Klasse zu kommen, ihre Mutter würde uns gerne mal kennenlernen. Bis dahin waren wir zusammen mit den Schäfern und Ziegen auf dem Deck. In der Ersten Klasse trafen wir dann die Frau des griechischen Unterrichtsministers, Frau Karidis. Frank und ich wollten von Santorini nach Kreta trampen und von Kreta nach Alexandrien. Wir hatten uns mit einem Matrosen am Hafen angefreundet, einem Kreter, der fragen sollte, ob uns jemand auf dem Boot mitnehmen könnte. Und dann tauchte da am Vulkan im Blau die Christina Onassis ![]() „Christina O“ war eine Luxusjacht, die ab 1954 von dem Reeder Aristoteles Onassis (1906 Smyrna, Osmanisches Reich, heute Türkei – 1975 Neuilly-sur-Seine, Frankreich) betrieben wurde. Auf den privaten Kreuzfahrten nahmen unter anderen der britische Staatsmann Winston Churchill (1847 Woodstock – 1965 London) und die Opernsängerin Maria Callas (1923 New York – 1977 Paris) teil. Siehe auch: Wolfgang Saxon, „Christina Onassis, Shipping Magnate, Dies at 37“, in: „The New York Times“, 20.11.1988, unter: http://www.nytimes.com/1988/11/20/obituaries/christina-onassis-shipping-magnate-dies-at-37.html (eingesehen am 08.07.2017). auf. Mit Churchill und Maria Callas. Das haben wir alles erlebt! Und dieses Blau! Das Yves-Klein-Blau ist gar nichts dagegen. Wir waren solche Egomanen mit 19, 20 … Wir waren das Zentrum der Welt! Onassis! Christina! Die haben uns gefragt, ob wir sie auf dem Ponton festmachen können, auf dem wir immer halbnackt lagen. Churchill kam dann mit seiner Zigarre raus, zusammen mit seiner Frau, und die Callas wollte nicht auf den Esel steigen. Wir haben uns totgelacht. Die blöde Kuh. Die ging nicht hoch nach Santorini, sie blieb lieber auf dem Schiff. Das haben wir alles miterlebt!
„Christina O“ war eine Luxusjacht, die ab 1954 von dem Reeder Aristoteles Onassis (1906 Smyrna, Osmanisches Reich, heute Türkei – 1975 Neuilly-sur-Seine, Frankreich) betrieben wurde. Auf den privaten Kreuzfahrten nahmen unter anderen der britische Staatsmann Winston Churchill (1847 Woodstock – 1965 London) und die Opernsängerin Maria Callas (1923 New York – 1977 Paris) teil. Siehe auch: Wolfgang Saxon, „Christina Onassis, Shipping Magnate, Dies at 37“, in: „The New York Times“, 20.11.1988, unter: http://www.nytimes.com/1988/11/20/obituaries/christina-onassis-shipping-magnate-dies-at-37.html (eingesehen am 08.07.2017). auf. Mit Churchill und Maria Callas. Das haben wir alles erlebt! Und dieses Blau! Das Yves-Klein-Blau ist gar nichts dagegen. Wir waren solche Egomanen mit 19, 20 … Wir waren das Zentrum der Welt! Onassis! Christina! Die haben uns gefragt, ob wir sie auf dem Ponton festmachen können, auf dem wir immer halbnackt lagen. Churchill kam dann mit seiner Zigarre raus, zusammen mit seiner Frau, und die Callas wollte nicht auf den Esel steigen. Wir haben uns totgelacht. Die blöde Kuh. Die ging nicht hoch nach Santorini, sie blieb lieber auf dem Schiff. Das haben wir alles miterlebt!
Frank war ein Bauernsohn aus Leichlingen und konnte sehr gut Tennis und Schach spielen. Er hat sofort Architekten im Hotel Atlantis kennengelernt. Das einzige Hotel, das nach dem Erdbeben 1956 offen war. Sonst war alles kaputt. Das Museum von Santorini war zum Beispiel in einer Kirche aufgebahrt. Die ganzen römisch-griechischen Skulpturen waren kaputt, die Köpfe lagen auf dem Boden. Und der Wärter hat immer geschlafen, wir hätten alles klauen können, was wir – Gott sei Dank – nicht gemacht haben. Das, was zum Beispiel die Arte-povera-Typen machten, nämlich die klassischen Bruchstücke in ihre Kunst zu integrieren, das haben wir da im Prinzip alles schon gesehen. Diese zerbrochenen Arme von berühmten Skulpturen …
In der Ecke eines Lokals saßen einmal ganz moderne, edle Franzosen – wir Deutschen hatten ja gar keinen Geschmack, wir waren alle geschmacklos zu jener Zeit. Einer von denen kam an unseren Tisch und fragte, ob ich Maler wäre. Ich konnte damals weder Englisch noch Französisch, er sprach aber etwas Deutsch. Er war ein Dominikanerpater, das wusste ich aber damals nicht. Am nächsten Tag kam er mit einem griechischen Maler, der damals in Paris lebte, Yannis Gaitis – in Griechenland kennt man ihn – in mein Atelier. Ich war zu der Zeit unheimlich produktiv. Ich hatte wahnsinnig viel Papier und Ölfarben mitgenommen und es hing alles voll: übermalte Akte, abstrakte Bilder … Der Grieche versuchte mir zu erklären, ich solle einen Stil finden, damit da etwas rauskommt und nicht einfach alles malen. Da habe ich geschimpft: „Ich will alles machen, ich will nicht nur auf eine Art modern sein. Ich mache Akte, dann male ich Städte, dann Wasser und dann Felsen.“ Und das ist auch so geblieben. Ich mache eben alles! Ich habe ganz viele Seelen in der Brust und die lasse ich raus. Diese Freiheit nehme ich mir! Es ist egal, welcher Händler oder Priester oder Pater sagt: „Das darfst du nicht.“ Ich mache alles im Leben! Das ist meine Nachricht! Diese Aggression, die ich habe, kommt aus dieser scheiß Dritte-Reich-Nazi-Erziehung. Dass wir so sein mussten. Kindergartenerziehung. „Heil Hitler!“ Das mache ich nicht! Nie in meinem Leben! Da werde ich sehr militant. Wer meine Freiheit angreifen will, der kriegt es mit mir zu tun. Geistig! Ich kann verbal so böse werden, dass die mich im Leben nie wieder vergessen. Das haben wir gelernt. Aber wir sind natürlich auch lieb.
Jedenfalls sind die zwei oder drei Tage geblieben. Das Atelier war eine riesige Höhle in Bimsstein eingebaut, eine halbe Kirche. Darin haben wir im Schlafsack gepennt, ich habe da gearbeitet und die Bilder dann alle aufgehängt. Abends gab es Kerzen, keine Elektrizität. Überhaupt gab es in Griechenland auf den Inseln keine Elektrizität, auch auf Santorini nicht. Es gab entweder Gaslampen, die man mit Benzin befüllen konnte, oder Kerzen. Die kamen irgendwann nachts und wollten sich verabschieden. Ich habe sie aber nicht richtig verstanden, und der Franzose, der Dominikanerpater, clever wie er war, dachte: „Pourquoi pas? Warum nicht? Wenn er es missversteht, dann muss es so sein.“ Er sagte zu mir: „Dann morgen um sechs Uhr unten am Schiff.“ Ich habe meine ganzen Klamotten zusammengepackt und habe Frank, der im Hotel mit irgendeinem reichen Architekten Schach oder Karten spielte, gesagt: „Ich haue ab.“ Er kam dann mit und wir sind mit dem Pater und Gaitis nach Paros zu der Familie von Gaitis gefahren. Dem Vater gehörten alle Omnibusse in Athen, und sie wohnten in einer wunderschönen Villa, ganz in der Nähe des Museums. Da schliefen wir im Eingang – und oben die ganze Familie, eine große Familie.
Auch da wusste ich noch nicht, dass der Pater Dominikaner war. Wir sind dann mit dem Bus nach Skyros gefahren. Mit 19, 20 war ich ein wahnsinniger Typ. Irrsinnig! Diese griechische Freiheit. Wir waren immer nackt. Das kam noch aus dem Dritten Reich. Freikörperkultur. Schon als ich an der Folkwangschule anfing und die ersten schönen Tage in Essen-Werden an der Ruhr erlebte, gingen wir mittags zum Sonnen auf die Brehminsel. Da war die ganze Tanzabteilung, alle nackt. Das war bei uns gang und gäbe.
Jacques Laval ![]() Jacques Laval (1911–2002) war ein Dominikanermönch und Schriftsteller. Unter dem Pseudonym „Jean Lorbais“ veröffentlichte er während der 1960er- und 1970er-Jahre mehrere Bücher, darunter die Erzählungen „Le Gratte-ciel“ (1967) und „Le Roi indigne“ (1972). , so hieß der Dominikanerpater, schrieb an einem Roman. Er mietete sich eine Mühle am Ende von Skyros und mir mietete er einen alten Eselstall mitten in der Savanne hinterm Strand. Den habe ich sauber gemacht und dort gemalt. Frank, total braun gebrannt, lag immer am Strand – und ich malte. Farbverschmiert ging ich dann in die Wellen. Das sind Erinnerungen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe die höchste Stufe des Lebens erlebt. Das kriege ich nie mehr wieder – wahrscheinlich erst nach dem Tod. Wir haben wirklich gelebt. Wow! Jeden Morgen kam ein toller Typ mit irrsinnigem Körper – braun gebrannt, Franzose – und machte Meditation. Zen-Buddhismus. Der Dominikaner war ja schon 55 oder 56 Jahre alt – wir waren damals 19, für uns war er alt. Der Franzose war Tänzer im Ballett in Paris und sein Freund lebte im Dorf Skyros. Wenn wir abends mit dem Dominikanerpater ins Dorf essen und mit den alten Griechen tanzen gingen, trafen wir ihn. Das war der Freund von James Lord
Jacques Laval (1911–2002) war ein Dominikanermönch und Schriftsteller. Unter dem Pseudonym „Jean Lorbais“ veröffentlichte er während der 1960er- und 1970er-Jahre mehrere Bücher, darunter die Erzählungen „Le Gratte-ciel“ (1967) und „Le Roi indigne“ (1972). , so hieß der Dominikanerpater, schrieb an einem Roman. Er mietete sich eine Mühle am Ende von Skyros und mir mietete er einen alten Eselstall mitten in der Savanne hinterm Strand. Den habe ich sauber gemacht und dort gemalt. Frank, total braun gebrannt, lag immer am Strand – und ich malte. Farbverschmiert ging ich dann in die Wellen. Das sind Erinnerungen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe die höchste Stufe des Lebens erlebt. Das kriege ich nie mehr wieder – wahrscheinlich erst nach dem Tod. Wir haben wirklich gelebt. Wow! Jeden Morgen kam ein toller Typ mit irrsinnigem Körper – braun gebrannt, Franzose – und machte Meditation. Zen-Buddhismus. Der Dominikaner war ja schon 55 oder 56 Jahre alt – wir waren damals 19, für uns war er alt. Der Franzose war Tänzer im Ballett in Paris und sein Freund lebte im Dorf Skyros. Wenn wir abends mit dem Dominikanerpater ins Dorf essen und mit den alten Griechen tanzen gingen, trafen wir ihn. Das war der Freund von James Lord ![]() James Lord (1922 Englewood, Colorado – 2009 Paris) war ein Schriftsteller und Biograf, der engen Kontakt zu Picasso und Alberto Giacometti pflegte. Er ist unter anderem Autor der Bücher „A Giacometti Portrait“ (1965), „Giacometti. A Biography“ (1986) und „Picasso and Dora Maar. A Personal Memoir“ (1993). , dem Giacometti-Spezialisten. Wenn man über Alberto Giacometti lesen will, muss man James Lord, einen amerikanischer Kunsthistoriker, lesen. Die haben wir damals alle kennengelernt. Das war die Zeit. Der Dominikanerpater kaufte mir ein tolles Bild ab, dann hatte ich noch Geld bis November und er sagte: „Klaus, wenn du Probleme in Deutschland hast, schreib mir. Komm nach Paris.“ Im Dezember, es war kalt, habe ich in Kettwig alle meine Klamotten zusammengepackt und den Zug genommen. Es roch nach Sagrotan, der Zug kam aus Moskau und fuhr über Berlin, Aachen und über all die Grenzen. Am Gare du Nord kam ich an. Und erst da habe ich kapiert, dass er in einem Kloster lebte. Er war bei den Dominikanern für die Art sacré
James Lord (1922 Englewood, Colorado – 2009 Paris) war ein Schriftsteller und Biograf, der engen Kontakt zu Picasso und Alberto Giacometti pflegte. Er ist unter anderem Autor der Bücher „A Giacometti Portrait“ (1965), „Giacometti. A Biography“ (1986) und „Picasso and Dora Maar. A Personal Memoir“ (1993). , dem Giacometti-Spezialisten. Wenn man über Alberto Giacometti lesen will, muss man James Lord, einen amerikanischer Kunsthistoriker, lesen. Die haben wir damals alle kennengelernt. Das war die Zeit. Der Dominikanerpater kaufte mir ein tolles Bild ab, dann hatte ich noch Geld bis November und er sagte: „Klaus, wenn du Probleme in Deutschland hast, schreib mir. Komm nach Paris.“ Im Dezember, es war kalt, habe ich in Kettwig alle meine Klamotten zusammengepackt und den Zug genommen. Es roch nach Sagrotan, der Zug kam aus Moskau und fuhr über Berlin, Aachen und über all die Grenzen. Am Gare du Nord kam ich an. Und erst da habe ich kapiert, dass er in einem Kloster lebte. Er war bei den Dominikanern für die Art sacré ![]() Der Begriff „L’Art sacré“ (franz.: Heilige Kunst) bezeichnet traditionell alle religiös ausgerichteten Kunstformen. Siehe auch: Rolf Toman, „Ars Sacra. Christliche Kunst und Architektur des Abendlandes von den Anfängen bis zur Gegenwart“, Potsdam 2010. zuständig. Georges Braque, Pierre Soulages, Alfred Manessier … das waren alles seine Freunde. Und er war total in mich verliebt, ich stehe aber nur auf Frauen.
Der Begriff „L’Art sacré“ (franz.: Heilige Kunst) bezeichnet traditionell alle religiös ausgerichteten Kunstformen. Siehe auch: Rolf Toman, „Ars Sacra. Christliche Kunst und Architektur des Abendlandes von den Anfängen bis zur Gegenwart“, Potsdam 2010. zuständig. Georges Braque, Pierre Soulages, Alfred Manessier … das waren alles seine Freunde. Und er war total in mich verliebt, ich stehe aber nur auf Frauen.
Ich habe unter einem Max Ernst geschlafen, vor mir hing ein Tàpies. Damals war ich 20 Jahre alt und konnte im Bett nicht schlafen, weil ich in Griechenland immer auf Steinen geschlafen hatte. Also schlief ich auf dem Teppich am Boden. In ganz Paris war bekannt: Da ist so ein wilder Typ, der schläft nicht im Bett, sondern auf dem Teppich. Ich wurde dann mit der Mappe herumgefahren und war bei einer berühmten Sammlerin, Madame Maillart, deren Vater ein Schweizer Bauingenieur war und in Frankreich die Stahlbrücken gebaut hat. Gekauft haben von mir die Nichte von Marcel Proust, Madame Monte-Proust auf der Île Saint-Louis, und Claude Mauriac ![]() Claude Mauriac (1914 Paris – 1996 Paris) war ein Filmkritiker und Essayist, der unter anderem für die französische Tageszeitung „Le Figaro“ arbeitete. Er war der Sohn des Schriftstellers François Mauriac (1885 Bordeaux– 1970 Paris). , der Sohn von François Mauriac. Wenn bei ihm früher das Fenster geöffnet war, konnte ich meine Bilder sehen. Er war Filmkritiker. Und seine Nichte, die ich noch als Kind bei denen am Esstisch erlebt habe, war später mit Godard verheiratet.
Claude Mauriac (1914 Paris – 1996 Paris) war ein Filmkritiker und Essayist, der unter anderem für die französische Tageszeitung „Le Figaro“ arbeitete. Er war der Sohn des Schriftstellers François Mauriac (1885 Bordeaux– 1970 Paris). , der Sohn von François Mauriac. Wenn bei ihm früher das Fenster geöffnet war, konnte ich meine Bilder sehen. Er war Filmkritiker. Und seine Nichte, die ich noch als Kind bei denen am Esstisch erlebt habe, war später mit Godard verheiratet. ![]() Zwischen 1967 und 1979 lebte der Filmregisseur Jean-Luc Godard (* 1930 Paris) in einer Ehe mit der Schauspielerin und Schriftstellerin Anne Wiazemsky (* 1947 Berlin). Sie ist die Enkelin des Schriftstellers François Mauriac und die Nichte des Filmkritikers Claude Mauriac. Das ist meine französische Connection!
Zwischen 1967 und 1979 lebte der Filmregisseur Jean-Luc Godard (* 1930 Paris) in einer Ehe mit der Schauspielerin und Schriftstellerin Anne Wiazemsky (* 1947 Berlin). Sie ist die Enkelin des Schriftstellers François Mauriac und die Nichte des Filmkritikers Claude Mauriac. Das ist meine französische Connection!
Wer hat Sie damals herumgefahren?
Jacques Laval. Mit Schauspielern wie Jeanne Moreau oder Alain Cuny bin ich in Paris wandern gegangen. Ich habe damals so viel Geld verdient, so viel Geld hatten meine Eltern noch nie gesehen. Ich kam mit einem Packen Tausend-Francs-Scheine bei denen an, mit Napoleon drauf!
Was hat eine Arbeit von Ihnen damals gekostet?
Nicht viel, 600 Francs. Ich habe die Preise nicht gemacht. Jaques Laval war gebürtig aus Reims, sein Bruder hatte dort eine riesige Textilfabrik. Da sind wir am Wochenende hingefahren, es wurden die ganzen Champagnerfamilien zusammengetrommelt, ich habe meine Bilder gezeigt und die wollten alle etwas kaufen. Ich hatte gar keine Ahnung, was das kostet. Vor meinen Augen haben sie bestimmt, wie teuer das sein sollte. Die Listen habe ich noch heute, auch die Adressen dieser Leute. Mein ganzes Frühwerk ist in Frankreich. Was haben wir für Leute kennengelernt, mein Gott! Aber ich bin wieder zurückgegangen!
1963 ging der Dominikanerpater Laval nach New York. Das sind ja Prediger, die in Kanada und überall predigen. Er besuchte damals Ellsworth Kelly ![]() Ellsworth Kelly (1923 Newburgh, New York – 2015 New York) war ein Künstler, der zu den Begründern der Hard-Edge-Malerei gehört. Nachdem er 1946 sein Studium an der School of the Museum of Fine Arts in Boston begonnen hatte, setzte er dieses ab 1949 an der École nationale supérieure des beaux-arts de Paris fort. 1954 zog Kelly nach New York, wo er 1956 seine erste Einzelausstellung in der Betty Parsons Gallery hatte. Er war ab 1964 auf der documenta und 1966 auf der Biennale von Venedig vertreten. , der vorher in Paris gelebt hatte, und sah dessen minimalistischen Bilder. Ich hatte zu jener Zeit in Reims in der Nähe der Kathedrale am Place du Forum ein Atelier. Diese Kämpfe gegen die Monochromie waren 63 dramatisch. In Griechenland habe ich dann bichrome Bilder gemalt. Das war ein Kampf, der nicht mehr auszuhalten war und für mich endete die Malerei dort. Laval erklärte Ellsworth Kelly damals, dass er einen deutschen Künstler in Reims kannte, der ähnliche Versuche machte wie er. Da hat Kelly gesagt: „Er soll sofort hierhin kommen.“ Unter seinem Atelier in Manhattan war eine Wohnung frei, in der ich wohnen sollte, während ich für ihn als Assistent arbeitete. Aber ich musste zurück. Vor dem Algerienkrieg war ich totaler Franzose geworden; ich hatte meine Nationalität verloren. Und im Rheinland waren dann die ZERO-Gruppe, Beuys, Schmela … ich hatte die erste Ausstellung in Luxemburg
Ellsworth Kelly (1923 Newburgh, New York – 2015 New York) war ein Künstler, der zu den Begründern der Hard-Edge-Malerei gehört. Nachdem er 1946 sein Studium an der School of the Museum of Fine Arts in Boston begonnen hatte, setzte er dieses ab 1949 an der École nationale supérieure des beaux-arts de Paris fort. 1954 zog Kelly nach New York, wo er 1956 seine erste Einzelausstellung in der Betty Parsons Gallery hatte. Er war ab 1964 auf der documenta und 1966 auf der Biennale von Venedig vertreten. , der vorher in Paris gelebt hatte, und sah dessen minimalistischen Bilder. Ich hatte zu jener Zeit in Reims in der Nähe der Kathedrale am Place du Forum ein Atelier. Diese Kämpfe gegen die Monochromie waren 63 dramatisch. In Griechenland habe ich dann bichrome Bilder gemalt. Das war ein Kampf, der nicht mehr auszuhalten war und für mich endete die Malerei dort. Laval erklärte Ellsworth Kelly damals, dass er einen deutschen Künstler in Reims kannte, der ähnliche Versuche machte wie er. Da hat Kelly gesagt: „Er soll sofort hierhin kommen.“ Unter seinem Atelier in Manhattan war eine Wohnung frei, in der ich wohnen sollte, während ich für ihn als Assistent arbeitete. Aber ich musste zurück. Vor dem Algerienkrieg war ich totaler Franzose geworden; ich hatte meine Nationalität verloren. Und im Rheinland waren dann die ZERO-Gruppe, Beuys, Schmela … ich hatte die erste Ausstellung in Luxemburg ![]() „Choix et découvertes. Quelques artistes français”, Galerie Marie-Thérèse, Luxemburg, 14. April – 06. Mai 1961. , wo ich Jean-Pierre Wilhelm
„Choix et découvertes. Quelques artistes français”, Galerie Marie-Thérèse, Luxemburg, 14. April – 06. Mai 1961. , wo ich Jean-Pierre Wilhelm ![]() Jean-Pierre Wilhelm (1912 Düsseldorf – 1968 Düsseldorf) war ein deutscher Galerist und Kunstkritiker, der gemeinsam mit Manfred de la Motte von 1957 bis 1960 die Galerie 22 in Düsseldorf leitete. Mit „Hommage à John Cage“ zeigte er dort im November 1959 die erste Einzelausstellung von Nam June Paik. kennengelernt habe, den ersten Galeristen, ein Jude aus Düsseldorf. Das war die Galerie 22 in der Kaiserstraße. Daher kenne ich zum Beispiel Nam June Paik, weil Wilhelm ihn entdeckt hat. Und ich habe wiederum Nam June Paik zum Professor gemacht.
Jean-Pierre Wilhelm (1912 Düsseldorf – 1968 Düsseldorf) war ein deutscher Galerist und Kunstkritiker, der gemeinsam mit Manfred de la Motte von 1957 bis 1960 die Galerie 22 in Düsseldorf leitete. Mit „Hommage à John Cage“ zeigte er dort im November 1959 die erste Einzelausstellung von Nam June Paik. kennengelernt habe, den ersten Galeristen, ein Jude aus Düsseldorf. Das war die Galerie 22 in der Kaiserstraße. Daher kenne ich zum Beispiel Nam June Paik, weil Wilhelm ihn entdeckt hat. Und ich habe wiederum Nam June Paik zum Professor gemacht. ![]() Nam June Paik war von 1979 bis 1996 Professor für Videokunst an der Kunstakademie in Düsseldorf.
Nam June Paik war von 1979 bis 1996 Professor für Videokunst an der Kunstakademie in Düsseldorf.
So bin ich zum Künstler geworden. Durch dieses Globale. Ich habe ja auch jahrelang in Australien gelebt ![]() Zwischen 1978 und 1983 lebte Klaus Rinke jährlich für mehrere Monate in Australien. und habe die größte Sammlung von Aboriginal Art.
Zwischen 1978 und 1983 lebte Klaus Rinke jährlich für mehrere Monate in Australien. und habe die größte Sammlung von Aboriginal Art.
Können wir noch einmal auf das sogenannte „Ende der Malerei“ zurückkommen?
Es hat ja wieder angefangen. Ich male auch wieder. Tony Cragg ![]() Tony Cragg (* 1949 Liverpool) ist ein Künstler, der vor allem für seine abstrakt-biomorphen Skulpturen bekannt ist. Von 1988 bis 2001 war er Professor an der Kunstakademie Düsseldorf und folgte 2009 Markus Lüpertz als Rektor der Hochschule nach. Cragg war auf der documenta 7 (1982) und 8 (1987) vertreten und wurde 1988 mit dem Turner Prize ausgezeichnet. war gerade da. Der ist ausgeflippt, als er meine frühen Skulpturen gesehen hat. Ihn habe ich auch zum Professor gemacht, Sir Anthony Cragg! Sehen Sie sich mal an, wie die Engländer mit ihren Künstlern umgehen und wie die Deutschen mit ihren Künstlern umgehen … Sechzig Steuerfahnder sechs Jahre auf Rinke, bis er kaputt ist. Wie die Nibelungen bin ich hier runtergegangen, dem Hagen zuvorgekommen!
Tony Cragg (* 1949 Liverpool) ist ein Künstler, der vor allem für seine abstrakt-biomorphen Skulpturen bekannt ist. Von 1988 bis 2001 war er Professor an der Kunstakademie Düsseldorf und folgte 2009 Markus Lüpertz als Rektor der Hochschule nach. Cragg war auf der documenta 7 (1982) und 8 (1987) vertreten und wurde 1988 mit dem Turner Prize ausgezeichnet. war gerade da. Der ist ausgeflippt, als er meine frühen Skulpturen gesehen hat. Ihn habe ich auch zum Professor gemacht, Sir Anthony Cragg! Sehen Sie sich mal an, wie die Engländer mit ihren Künstlern umgehen und wie die Deutschen mit ihren Künstlern umgehen … Sechzig Steuerfahnder sechs Jahre auf Rinke, bis er kaputt ist. Wie die Nibelungen bin ich hier runtergegangen, dem Hagen zuvorgekommen! ![]() Klaus Rinke lebt seit Ende 2007 auf Schloss Neuhaus in der Nähe von Neufelden in Österreich und in Los Angeles. Meine verwundbare Stelle werden sie nicht finden. Ich sitze jetzt an der Donau, gehe aber nicht bis zu Atilla nach Ungarn, ich bleibe hier. Ich bin dem zuvorgekommen. Ich sage immer: Rhein Richtung Nordsee, Donau Richtung gelobtes Land. Boah! Die Deutschen! Jahrelang bin ich durch die Welt gezogen. Ich war in New York auf allen Kunstschulen. 1971, ich konnte gar kein Englisch sprechen, bittet mich Kynaston McShine
Klaus Rinke lebt seit Ende 2007 auf Schloss Neuhaus in der Nähe von Neufelden in Österreich und in Los Angeles. Meine verwundbare Stelle werden sie nicht finden. Ich sitze jetzt an der Donau, gehe aber nicht bis zu Atilla nach Ungarn, ich bleibe hier. Ich bin dem zuvorgekommen. Ich sage immer: Rhein Richtung Nordsee, Donau Richtung gelobtes Land. Boah! Die Deutschen! Jahrelang bin ich durch die Welt gezogen. Ich war in New York auf allen Kunstschulen. 1971, ich konnte gar kein Englisch sprechen, bittet mich Kynaston McShine ![]() Kynaston McShine (* 1935 Trinidad und Tobago) ist ein Kunsthistoriker und Kurator. Von 1966 bis 1968 arbeitete er am Jewish Museum in New York, wo er mit „Primary Structures“ (1966) die erste museale Ausstellung zur Minimal Art organisierte. Anschließend war er bis 2008 am Museum of Modern Art in New York tätig. Dort initiierte er 1971 die Serie „Innovative Projects“ und verantwortete wichtige Überblicksausstellungen unter anderem zum Werk von Marcel Duchamp (1973), Andy Warhol (1989) und Richard Serra (2007). , zu seinem Kurs über Post War German Art zu kommen: „Klaus, kommst du mit?“ Riesiges Auditorium, Hunderte von Studenten. Ich dachte, ich sollte ihm beistehen, damit er keine Fehler macht, aber da stellte er mich auf die Bühne, setzte sich ins Auditorium und ich sollte dann über die Post War German Art erzählen. Ich hatte so einen Adrenalin-Schock, dass ich plötzlich Englisch konnte.
Kynaston McShine (* 1935 Trinidad und Tobago) ist ein Kunsthistoriker und Kurator. Von 1966 bis 1968 arbeitete er am Jewish Museum in New York, wo er mit „Primary Structures“ (1966) die erste museale Ausstellung zur Minimal Art organisierte. Anschließend war er bis 2008 am Museum of Modern Art in New York tätig. Dort initiierte er 1971 die Serie „Innovative Projects“ und verantwortete wichtige Überblicksausstellungen unter anderem zum Werk von Marcel Duchamp (1973), Andy Warhol (1989) und Richard Serra (2007). , zu seinem Kurs über Post War German Art zu kommen: „Klaus, kommst du mit?“ Riesiges Auditorium, Hunderte von Studenten. Ich dachte, ich sollte ihm beistehen, damit er keine Fehler macht, aber da stellte er mich auf die Bühne, setzte sich ins Auditorium und ich sollte dann über die Post War German Art erzählen. Ich hatte so einen Adrenalin-Schock, dass ich plötzlich Englisch konnte.
1973 hatten Sie Ihre erste Ausstellung im MoMA New York? ![]() „Projects. Klaus Rinke“, The Museum of Modern Art, New York, 19. September – 21. Oktober 1973. In der Ausstellung zeigte Rinke die Arbeit „Klaus Rinke. In Front of ...“, die zwischen 1971 und 1973 entstanden ist und aus mehreren Fotoserien besteht.
„Projects. Klaus Rinke“, The Museum of Modern Art, New York, 19. September – 21. Oktober 1973. In der Ausstellung zeigte Rinke die Arbeit „Klaus Rinke. In Front of ...“, die zwischen 1971 und 1973 entstanden ist und aus mehreren Fotoserien besteht.
Das war die erste Fotoausstellung. Dazu möchte ich noch mal deutlich sagen: Wenn ich, die Bechers ![]() Bernd (1931 Siegen – 2007 Rostock) und Hilla (1934 Potsdam – 2015 Düsseldorf) Becher waren ein deutsches Künstlerpaar. Mit ihren Typologien zur Industriearchitektur ab den 1970er-Jahren trugen sie wesentlich zur Entwicklung der konzeptuellen Fotografie in Deutschland bei. 1976 übernahmen sie die Professur für die neu eingerichtete Abteilung Fotografie an der Kunstakademie Düsseldorf und begründeten in den Folgejahren die international renommierte Düsseldorfer Photoschule. Zu den bekanntesten Schülern von Bernd und Hilla Becher zählen Andreas Gursky, Candida Höfer, Thomas Ruff und Thomas Struth. oder Michael Snow
Bernd (1931 Siegen – 2007 Rostock) und Hilla (1934 Potsdam – 2015 Düsseldorf) Becher waren ein deutsches Künstlerpaar. Mit ihren Typologien zur Industriearchitektur ab den 1970er-Jahren trugen sie wesentlich zur Entwicklung der konzeptuellen Fotografie in Deutschland bei. 1976 übernahmen sie die Professur für die neu eingerichtete Abteilung Fotografie an der Kunstakademie Düsseldorf und begründeten in den Folgejahren die international renommierte Düsseldorfer Photoschule. Zu den bekanntesten Schülern von Bernd und Hilla Becher zählen Andreas Gursky, Candida Höfer, Thomas Ruff und Thomas Struth. oder Michael Snow ![]() Michael Snow (* 1929 Toronto) ist ein Künstler und Regisseur, der sich in seinen Arbeiten häufig mit der experimentellen Verwendung technischer Medien beschäftigt. Er war unter anderem auf der Biennale von Venedig 1970 sowie auf der documenta 6 (1977) vertreten. Snow zählt zu den frühen Wegbereitern der konzeptuellen Fotografie. in den Museen eine reine Fotoausstellung gemacht haben, hieß es immer: „Das ist keine Kunst, das ist ja nur Fotografie.“ Wir haben die Museen für die Fotografie geöffnet! Auch für diese Werbe- und Modefotografen, die heute alle Künstler sind. Das ist aber gar keine Kunst. In der Kunst muss man etwas zeigen – nicht nur Images, sondern etwas Neues, ein Konzept. Auch van Gogh war ein Konzeptkünstler! Er hat versucht Licht zu malen. Ich werde immer als Konzeptkünstler vorgestellt, aber jeder Künstler hat ein Konzept. Rembrandt hatte ein Konzept, Cézanne hatte ein Konzept … Das sind alles Konzeptkünstler.
Michael Snow (* 1929 Toronto) ist ein Künstler und Regisseur, der sich in seinen Arbeiten häufig mit der experimentellen Verwendung technischer Medien beschäftigt. Er war unter anderem auf der Biennale von Venedig 1970 sowie auf der documenta 6 (1977) vertreten. Snow zählt zu den frühen Wegbereitern der konzeptuellen Fotografie. in den Museen eine reine Fotoausstellung gemacht haben, hieß es immer: „Das ist keine Kunst, das ist ja nur Fotografie.“ Wir haben die Museen für die Fotografie geöffnet! Auch für diese Werbe- und Modefotografen, die heute alle Künstler sind. Das ist aber gar keine Kunst. In der Kunst muss man etwas zeigen – nicht nur Images, sondern etwas Neues, ein Konzept. Auch van Gogh war ein Konzeptkünstler! Er hat versucht Licht zu malen. Ich werde immer als Konzeptkünstler vorgestellt, aber jeder Künstler hat ein Konzept. Rembrandt hatte ein Konzept, Cézanne hatte ein Konzept … Das sind alles Konzeptkünstler.
Wie kam der Kontakt zum MoMA zustande?
Über Kynaston McShine. Ich war ja nicht von der Fotografie-Abteilung eingeladen, sondern von der Abteilung Malerei und Skulptur. „In front of …“ ![]() „Klaus Rinke. In Front of ...“, 1971–1973. – das waren nur Gesichter. Ich habe diese großen Live-Fotos gemacht. Wenn in New York jemand auf der Straße zu mir sagte: „I know you“, wusste ich, dass die im Museum of Modern Art gewesen waren. Die haben mich sofort erkannt. Ich hatte damals noch lange Haare.
„Klaus Rinke. In Front of ...“, 1971–1973. – das waren nur Gesichter. Ich habe diese großen Live-Fotos gemacht. Wenn in New York jemand auf der Straße zu mir sagte: „I know you“, wusste ich, dass die im Museum of Modern Art gewesen waren. Die haben mich sofort erkannt. Ich hatte damals noch lange Haare.
71 war ich zum ersten Mal in New York, weil Reese Palley mich eingeladen hatte, im April 72 eine Ausstellung ![]() „Klaus Rinke/Monika Baumgartl. Dimostrazioni primarie“, Galleria L’Attico, Rom, 17.–22. Januar 1972; „Klaus Rinke/Monika Baumgartl. Primary Demonstrations. Time – Space – Body – Transformations“, Reese Palley Gallery, New York, 25.–31. März 1972. zu machen. Damals habe ich gesagt: „Ich muss New York sehen, damit ich überhaupt Ideen habe.“ Ich will das alles da machen. Er hat mir dann im Greenwich Village an der Bleecker Street eine Wohnung gemietet. Da lebten Berühmtheiten wie Allen Ginsberg
„Klaus Rinke/Monika Baumgartl. Dimostrazioni primarie“, Galleria L’Attico, Rom, 17.–22. Januar 1972; „Klaus Rinke/Monika Baumgartl. Primary Demonstrations. Time – Space – Body – Transformations“, Reese Palley Gallery, New York, 25.–31. März 1972. zu machen. Damals habe ich gesagt: „Ich muss New York sehen, damit ich überhaupt Ideen habe.“ Ich will das alles da machen. Er hat mir dann im Greenwich Village an der Bleecker Street eine Wohnung gemietet. Da lebten Berühmtheiten wie Allen Ginsberg ![]() Allen Ginsberg (1926 Paterson, New Jersey – 1997 New York) war ein Autor, der gemeinsam mit William S. Burroughs und Jack Kerouac zu den zentralen Vertretern der Beat Generation gehört. Aufgrund ihrer thematischen und sprachlichen Radikalität lösten viele seiner Werke in den 1950er- und 1960er-Jahren öffentliche Diskussionen aus. Internationales Ansehen erlangte er insbesondere für die beiden Gedichte „Howl“ (1957) und „Kaddish“ (1959). , der irgendwann mal im Theater vor mir stand. 71 machte Gordon Matta-Clark „FOOD“
Allen Ginsberg (1926 Paterson, New Jersey – 1997 New York) war ein Autor, der gemeinsam mit William S. Burroughs und Jack Kerouac zu den zentralen Vertretern der Beat Generation gehört. Aufgrund ihrer thematischen und sprachlichen Radikalität lösten viele seiner Werke in den 1950er- und 1960er-Jahren öffentliche Diskussionen aus. Internationales Ansehen erlangte er insbesondere für die beiden Gedichte „Howl“ (1957) und „Kaddish“ (1959). , der irgendwann mal im Theater vor mir stand. 71 machte Gordon Matta-Clark „FOOD“ ![]() FOOD war ein von Künstlern geleitetes Restaurant, das im Oktober 1971 von Gordon Matta-Clark (1943 New York – 1978 New York) und Carol Goodden (* 1940 New York) im New Yorker Stadtteil SoHo gegründet wurde. Es bestand bis 1974. Siehe auch: Randy Kennedy, „When Meals Played the Muse“, in: „The New York Times“, 21.02.2007, unter: http://www.nytimes.com/2007/02/21/dining/21soho.html (eingesehen am 08.07.2017). – da kochten die Künstler. Ich gehörte damals zu der SoHo-Generation mit Richard Serra, Carl Andre ... Wir gingen jeden Abend zusammen essen. Bis nachts waren wir in Max’s Kansas City.
FOOD war ein von Künstlern geleitetes Restaurant, das im Oktober 1971 von Gordon Matta-Clark (1943 New York – 1978 New York) und Carol Goodden (* 1940 New York) im New Yorker Stadtteil SoHo gegründet wurde. Es bestand bis 1974. Siehe auch: Randy Kennedy, „When Meals Played the Muse“, in: „The New York Times“, 21.02.2007, unter: http://www.nytimes.com/2007/02/21/dining/21soho.html (eingesehen am 08.07.2017). – da kochten die Künstler. Ich gehörte damals zu der SoHo-Generation mit Richard Serra, Carl Andre ... Wir gingen jeden Abend zusammen essen. Bis nachts waren wir in Max’s Kansas City.
Wer hat Sie da eingeführt?
Wir haben uns alle 1970 in Tokio kennengelernt. Auf der Tokio-Biennale habe ich das Projekt „Maskulin – Feminin“ ![]() Gemeinsam mit Monika Baumgartl (* 1942 Prag) zeigte Klaus Rinke auf der Tokio-Biennale 1970 die Aktion „Maskulin – feminin“. mit Monika Baumgartl vorgeführt: Einen Monat lang standen wir da als lebende Objekte. Ich kannte Carl Andre
Gemeinsam mit Monika Baumgartl (* 1942 Prag) zeigte Klaus Rinke auf der Tokio-Biennale 1970 die Aktion „Maskulin – feminin“. mit Monika Baumgartl vorgeführt: Einen Monat lang standen wir da als lebende Objekte. Ich kannte Carl Andre ![]() Carl Andre (* 1935 Quincy, Massachusetts) ist ein Künstler, der zu den zentralen Vertretern der Minimal Art gehört. Bekannt wurde er vor allem durch seine Anordnungen von flachen, quadratischen Platten aus Stahl, Kupfer oder Blei. , Robert Smithson
Carl Andre (* 1935 Quincy, Massachusetts) ist ein Künstler, der zu den zentralen Vertretern der Minimal Art gehört. Bekannt wurde er vor allem durch seine Anordnungen von flachen, quadratischen Platten aus Stahl, Kupfer oder Blei. , Robert Smithson ![]() Robert Smithson (1938 Passaic, New Jersey – 1973 Amarillo, Texas) gilt als Wegbereiter der Land-Art. Sein bekanntestes Werk ist „Spiral Jetty“ (1970) in Great Salt Lake, Utah, USA.
Robert Smithson (1938 Passaic, New Jersey – 1973 Amarillo, Texas) gilt als Wegbereiter der Land-Art. Sein bekanntestes Werk ist „Spiral Jetty“ (1970) in Great Salt Lake, Utah, USA.  … Konrad Fischer rief mich eines Abends in Düsseldorf an: „Klaus, was machst du? John Weber
… Konrad Fischer rief mich eines Abends in Düsseldorf an: „Klaus, was machst du? John Weber ![]() John Weber (1932 Los Angeles – 2008 Hudson, New York) war ein Galerist, der von 1971 bis 2000 eine Galerie in New York führte. Er zeigte insbesondere Positionen der Arte povera und des Post-Minimalismus, darunter Werke von Giovanni Anselmo, Daniel Buren, Hans Haacke, Richard Long, Mario Merz, Dorothea Rockburne und Franz Erhard Walther. hat mir einen Künstler geschickt, der sitzt hier in der Ecke und sagt nichts. Ich habe Angst vor ihm. Kannst du nicht kommen und ihm die Altstadt zeigen?“ Ich bin also zu ihm in die Dachwohnung in der Poststraße gegangen, und da saß dann Smithson. Ich habe ihm die Altstadt und auch die Industrien wie die Gerresheimer Glashütte
John Weber (1932 Los Angeles – 2008 Hudson, New York) war ein Galerist, der von 1971 bis 2000 eine Galerie in New York führte. Er zeigte insbesondere Positionen der Arte povera und des Post-Minimalismus, darunter Werke von Giovanni Anselmo, Daniel Buren, Hans Haacke, Richard Long, Mario Merz, Dorothea Rockburne und Franz Erhard Walther. hat mir einen Künstler geschickt, der sitzt hier in der Ecke und sagt nichts. Ich habe Angst vor ihm. Kannst du nicht kommen und ihm die Altstadt zeigen?“ Ich bin also zu ihm in die Dachwohnung in der Poststraße gegangen, und da saß dann Smithson. Ich habe ihm die Altstadt und auch die Industrien wie die Gerresheimer Glashütte ![]() Die Gerresheimer Glashütte bestand von 1864 bis 2005 und gehörte zu den traditionsreichsten Unternehmen Düsseldorfs. gezeigt. Daraus sind einige Arbeiten von Smithson entstanden. Smithson war über viele Jahre mein Freund – mein einziger, wirklicher, ehrlicher Freund. Wenn ich nach New York kam, hat er immer ein Essen für mich gemacht. Nancy Holt
Die Gerresheimer Glashütte bestand von 1864 bis 2005 und gehörte zu den traditionsreichsten Unternehmen Düsseldorfs. gezeigt. Daraus sind einige Arbeiten von Smithson entstanden. Smithson war über viele Jahre mein Freund – mein einziger, wirklicher, ehrlicher Freund. Wenn ich nach New York kam, hat er immer ein Essen für mich gemacht. Nancy Holt ![]() Nancy Holt (1938 Worchester, Massachusetts – 2014 New York) war eine Künstlerin, die zur frühen Generation der Land-Art gezählt wird. Von 1963 bis 1973 lebte sie in einer Ehe mit dem Künstler Robert Smithson. musste dann kochen und das Essen servieren. Smithson war so ein Male-Chauvinist, das war schon Wahnsinn.
Nancy Holt (1938 Worchester, Massachusetts – 2014 New York) war eine Künstlerin, die zur frühen Generation der Land-Art gezählt wird. Von 1963 bis 1973 lebte sie in einer Ehe mit dem Künstler Robert Smithson. musste dann kochen und das Essen servieren. Smithson war so ein Male-Chauvinist, das war schon Wahnsinn.
71 tauchte Harald Szeemann mit Jean-Christophe Amman in New York auf, um die „documenta 5“ für das Jahr 72 vorzubereiten. ![]() Harald Szeemann (1933 Bern – 2005 Tegna im Tessin) war ein Schweizer Kurator und 1972 Leiter der „documenta 5“. Neben Arnold Bode (1900 Kassel – 1977 Kassel) zählte auch Jean-Christophe Ammann (1939 Berlin – 2015 Frankfurt am Main) zum Team seiner Arbeitsgruppe. Die wollten Leo Castelli und alle möglichen Leute treffen: Serra, Barry Le Va … Bruce Nauman hatte damals gerade eine Ausstellung bei Castelli,
Harald Szeemann (1933 Bern – 2005 Tegna im Tessin) war ein Schweizer Kurator und 1972 Leiter der „documenta 5“. Neben Arnold Bode (1900 Kassel – 1977 Kassel) zählte auch Jean-Christophe Ammann (1939 Berlin – 2015 Frankfurt am Main) zum Team seiner Arbeitsgruppe. Die wollten Leo Castelli und alle möglichen Leute treffen: Serra, Barry Le Va … Bruce Nauman hatte damals gerade eine Ausstellung bei Castelli, ![]() „Bruce Nauman“, Leo Castelli Gallery, New York, 20. November – 11. Dezember 1971. den ich auch sehr gut kannte. Der Szeemann kam mit Kategorien an, persönliche Mythologien … der hatte geistige Schubladen konstruiert, die er auf der documenta ausstellen wollte. Wir wollten aber nicht in solchen Schubladen enden. Serra, Smithson … auch Michael Heizer kannte ich durch die „Prospect“-Ausstellung
„Bruce Nauman“, Leo Castelli Gallery, New York, 20. November – 11. Dezember 1971. den ich auch sehr gut kannte. Der Szeemann kam mit Kategorien an, persönliche Mythologien … der hatte geistige Schubladen konstruiert, die er auf der documenta ausstellen wollte. Wir wollten aber nicht in solchen Schubladen enden. Serra, Smithson … auch Michael Heizer kannte ich durch die „Prospect“-Ausstellung ![]() Unter dem Titel „Prospect“ fanden zwischen 1968 und 1976 insgesamt fünf Ausstellungen in unregelmäßigen Abständen in der Kunsthalle Düsseldorf statt. Durch den Galeristen Konrad Fischer und den damals als Kunstkritiker tätigen Hans Strelow initiiert, entstand „Prospect“ als Alternative zum Kölner Kunstmarkt, der 1967 erstmals stattfand und ausschließlich deutschen Galerien Zugang gewährte. „Prospect“ wurde zu einer internationalen Plattform für zeitgenössische Kunst, wobei die in- und ausländischen Galerien der Avantgarde die Transporte finanzierten und im Gegenzug Vorschläge zur Auswahl der Künstler einreichen konnten. in Düsseldorf damals ganz gut – die Stadt war ein Schmelztiegel. Düsseldorf war genauso wichtig wie New York. Da rief einen der Kneipier aus der Altstadt an: „Hier sitzt so ein Langhaariger, der fragt nach dir.“ Und dann saß da Mel Bochner
Unter dem Titel „Prospect“ fanden zwischen 1968 und 1976 insgesamt fünf Ausstellungen in unregelmäßigen Abständen in der Kunsthalle Düsseldorf statt. Durch den Galeristen Konrad Fischer und den damals als Kunstkritiker tätigen Hans Strelow initiiert, entstand „Prospect“ als Alternative zum Kölner Kunstmarkt, der 1967 erstmals stattfand und ausschließlich deutschen Galerien Zugang gewährte. „Prospect“ wurde zu einer internationalen Plattform für zeitgenössische Kunst, wobei die in- und ausländischen Galerien der Avantgarde die Transporte finanzierten und im Gegenzug Vorschläge zur Auswahl der Künstler einreichen konnten. in Düsseldorf damals ganz gut – die Stadt war ein Schmelztiegel. Düsseldorf war genauso wichtig wie New York. Da rief einen der Kneipier aus der Altstadt an: „Hier sitzt so ein Langhaariger, der fragt nach dir.“ Und dann saß da Mel Bochner ![]() Mel Bochner (* 1940 Pittsburgh, Pennsylvania) ist ein Künstler, der sich in seinen Werken häufig mit dem Verhältnis von Sprache und visueller Darstellung beschäftigt. 1966 organisierte er in der School of Visual Arts in New York die Ausstellung „Working Drawings and Other Visible Things on Paper Not Necessarily Meant to Be Viewed as Art”, die als Meilenstein in der Geschichte der Konzeptkunst gilt. Mit seinen Arbeiten war Bochner unter anderem auf der documenta 5 (1977) und 6 (1977) vertreten. und wollte mich treffen. Das war die Welt der Hippie-Generation. Wir hatten keine Nationalitäten! Wir hatten die gleichen oder ähnlichen Gedanken!
Mel Bochner (* 1940 Pittsburgh, Pennsylvania) ist ein Künstler, der sich in seinen Werken häufig mit dem Verhältnis von Sprache und visueller Darstellung beschäftigt. 1966 organisierte er in der School of Visual Arts in New York die Ausstellung „Working Drawings and Other Visible Things on Paper Not Necessarily Meant to Be Viewed as Art”, die als Meilenstein in der Geschichte der Konzeptkunst gilt. Mit seinen Arbeiten war Bochner unter anderem auf der documenta 5 (1977) und 6 (1977) vertreten. und wollte mich treffen. Das war die Welt der Hippie-Generation. Wir hatten keine Nationalitäten! Wir hatten die gleichen oder ähnlichen Gedanken!
Sie haben beschrieben, dass Sie in Frankreich „der Deutsche“ waren. War das in den USA auch so?
Weniger. Ich ging auch mit Clement Greenberg, Larry Poons und Jules Olitski zum Essen. Die machten vollkommen andere Kunst, aber die mochten mich, auch als deutschen Künstler. Es spielte keine Rolle. 1972 zur Eröffnung ![]() „Klaus Rinke. Films and Photographic Pieces“, Reese Palley Gallery, San Francisco, 15. April – 13. Mai 1972. bei Reese Palley in San Francisco kam John Gutmann
„Klaus Rinke. Films and Photographic Pieces“, Reese Palley Gallery, San Francisco, 15. April – 13. Mai 1972. bei Reese Palley in San Francisco kam John Gutmann ![]() John Gutmann (1905 Breslau, Niederschlesien, heute Polen – 1998 San Francisco) war ein Künstler, der vor allem für seine dokumentarischen Fotoarbeiten internationales Ansehen erlangte. Nach seiner Entlassung als Lehrer durch die Nationalsozialisten emigrierte er 1933 in die USA, wo er zunächst als Fotojournalist arbeitete. Von 1938 bis zu seiner Emeritierung 1973 lehrte er als Professor am San Francisco State College. , ein deutscher Jude, der ausgewandert war, und erzählte mir von dem Raunen der Upperclass unter den Deutschjuden in Berlin, als die Nazis an die Macht kamen: „Wir müssen raus.“ Eigentlich wollte er nach Paris, aber die reichen Juden sagten zu ihm: „Nein, du musst aufs Boot, raus aus Europa.“ Also hat er alles zusammengepackt, ist aufs Boot gegangen, erst nach Argentinien und später nach San Francisco, wo er eine berühmte Hollywood-Schauspielerin geheiratet hat. Seine Studenten waren die ersten Hippies, die diese riesigen Konzerte mit Pink Floyd organisiert haben. Ich habe die alle kennengelernt. Zu meiner Ausstellung „The Doors“
John Gutmann (1905 Breslau, Niederschlesien, heute Polen – 1998 San Francisco) war ein Künstler, der vor allem für seine dokumentarischen Fotoarbeiten internationales Ansehen erlangte. Nach seiner Entlassung als Lehrer durch die Nationalsozialisten emigrierte er 1933 in die USA, wo er zunächst als Fotojournalist arbeitete. Von 1938 bis zu seiner Emeritierung 1973 lehrte er als Professor am San Francisco State College. , ein deutscher Jude, der ausgewandert war, und erzählte mir von dem Raunen der Upperclass unter den Deutschjuden in Berlin, als die Nazis an die Macht kamen: „Wir müssen raus.“ Eigentlich wollte er nach Paris, aber die reichen Juden sagten zu ihm: „Nein, du musst aufs Boot, raus aus Europa.“ Also hat er alles zusammengepackt, ist aufs Boot gegangen, erst nach Argentinien und später nach San Francisco, wo er eine berühmte Hollywood-Schauspielerin geheiratet hat. Seine Studenten waren die ersten Hippies, die diese riesigen Konzerte mit Pink Floyd organisiert haben. Ich habe die alle kennengelernt. Zu meiner Ausstellung „The Doors“ ![]() „Klaus Rinke. Sculpture = Performance = Sculpture (Poseidon)“, Ace Gallery, Los Angeles, 04. August – 04. September 1981. 1981 in der Ace Gallery in Los Angeles gab es eine Befragung: „What do you think about this young German artist?“ – „He is a genius.“ Und das im Ausland!
„Klaus Rinke. Sculpture = Performance = Sculpture (Poseidon)“, Ace Gallery, Los Angeles, 04. August – 04. September 1981. 1981 in der Ace Gallery in Los Angeles gab es eine Befragung: „What do you think about this young German artist?“ – „He is a genius.“ Und das im Ausland!
Unterscheidet sich die Rezeption Ihrer Werke in den USA, Frankreich und Deutschland?
Ja, die Franzosen lieben mich. Deutsch ist fantastisch, das ist meine Muttersprache, eine Philosophensprache, aber in Deutschland gilt: „Schweigen ist Gold.“ In Frankreich dagegen: „Reden ist Gold.“ Man kommuniziert über Sprache. Palabern, palavern … Lateinisch: unterm Baum sitzen und reden. ![]() Der Begriff „Palaver“ leitet sich von dem lateinischen Wort „parabola“ (lat.: Erzählung, Bericht) ab. Weitere Bedeutung erlangte er vor allem im afrikanischen Sprachgebrauch, wo er öffentliche Versammlungen mit religiösem oder gerichtlichem Hintergrund bezeichnete. Das Direkte. Das können Deutsche nicht ertragen. Ich bin oft im Rheinland zu bürgerlichen Essen eingeladen gewesen, da flippten die immer aus, wenn ich irgendwelche Sachen sagte, wofür man in Frankreich bewundert wird. In Deutschland geht das vollkommen daneben. Deutsche lieben die Intimität nicht, die halten immer Abstand. Anstand ist Abstand. Die Engländer sind noch schlimmer. Die Höflichkeit der Angelsachsen. Die Engländer sind so höflich, dass man nicht an sie herankommt. Das ist deren Mauer. Und die Deutschen haben Disziplin und sie haben Angst, Intimität zu zeigen. Ich hatte deutsche Freunde, Sammler, die haben „Sie Klaus“ gesagt, niemals „du Klaus“.
Der Begriff „Palaver“ leitet sich von dem lateinischen Wort „parabola“ (lat.: Erzählung, Bericht) ab. Weitere Bedeutung erlangte er vor allem im afrikanischen Sprachgebrauch, wo er öffentliche Versammlungen mit religiösem oder gerichtlichem Hintergrund bezeichnete. Das Direkte. Das können Deutsche nicht ertragen. Ich bin oft im Rheinland zu bürgerlichen Essen eingeladen gewesen, da flippten die immer aus, wenn ich irgendwelche Sachen sagte, wofür man in Frankreich bewundert wird. In Deutschland geht das vollkommen daneben. Deutsche lieben die Intimität nicht, die halten immer Abstand. Anstand ist Abstand. Die Engländer sind noch schlimmer. Die Höflichkeit der Angelsachsen. Die Engländer sind so höflich, dass man nicht an sie herankommt. Das ist deren Mauer. Und die Deutschen haben Disziplin und sie haben Angst, Intimität zu zeigen. Ich hatte deutsche Freunde, Sammler, die haben „Sie Klaus“ gesagt, niemals „du Klaus“.
Paul Maenz hat es, glaube ich, zum Teil mit seinen Künstlern auch so gemacht?
Die Familie von Paul Maenz kam ursprünglich aus Bremen. Sein Großvater ist nach Gelsenkirchen gegangen, hat mitten in der Stadt eine Kneipe aufgemacht und die Mutter von Paul Maenz hat die Kneipe geführt. Sein Vater war Matrose. Maenz hat ihn nur einmal gesehen. Uns war es immer klar … Wenn wir am Hafen in Gelsenkirchen malen gingen, malte er immer Jungs. Er zeichnete aus dem Kopf heraus Jungs. Das war aber nicht bewusst. Wir anderen aquarellierten Industrieanlagen … Wir haben wirklich Jahre miteinander verbracht! Wir sind oft zu Maenz’ Großvater gegangen. Wir hatten ja überhaupt kein Geld und der Großvater gab uns Bier aus. Außerdem hatten sie Gästezimmer und dort legte der Paul Franz Liszt und solche Sachen auf. Die hatten dolle Platten.
Das war die Zeit, als wir zur Musterung zitiert wurden. Ich habe mich aber gewehrt. Ich hätte jeden General verprügelt, wenn ich zur Bundeswehr gemusst hätte. Wir waren ja eine der ersten Generationen, die zur Bundeswehr mussten. Ich bin sofort auf die Wehrersatzämter gegangen und habe so rumort und geschrien, dass die fast Angst vor mir hatten. Da haben die gesagt: „Das sagen Sie zu mir? Ich habe damit doch nichts zu tun. Ich tue nur meine Pflicht.“ – Da habe ich gesagt: „Das haben die im Dritten Reich auch gesagt!“ Ich bin nie gemustert worden!
Wie haben Sie das vermeiden können?
Indem ich unheimlich aggressiv war. Die haben sich gedacht: „Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Das führt zur Wehrzersetzung.“ 69 hat mir ein General geschrieben, ob mir klar wäre, dass ich mich strafbar mache. Da habe ich gesagt: „Das ist mir scheißegal. Ich habe im Dritten Reich so viele Tote gesehen, so viele Dramen erlebt.“ Wir Deutschen müssen Frieden zeigen! Die Amerikaner haben uns da wieder hingebracht. Die brauchten eine Armee gegen den Kommunismus.
Diese klare Haltung und diese Wut, haben Sie das damals mit anderen deutschen Kollegen an der Akademie geteilt?
Ich war zornig! Meine Studenten sagen immer: „Der Rinke ist wahnsinnig.“ An und für sich bin ich ein ganz Netter – ich lache ja auch dabei. Ich bin nie ein Untertan gewesen. Manche Leute sind gerne Untertan, aber ich bin nie ein Untertan gewesen! Devot sein heißt tot sein.
Es gab sicher auch andere, die diese Wut hatten. Sie hatten Ihr Atelier neben Uecker und Richter …
Die sind im Osten aufgewachsen und haben noch den Sozialismus mitgekriegt. Auf der Akademie hießen die „Ostblock-Künstler“. Polke, Palermo, Richter, Uecker, Reusch, Graubner – die sind alle im Sozialismus groß geworden. Sie haben den Nationalsozialismus und den Sozialismus mitgekriegt und sind dann rübergekommen. Deswegen sind sie auch so gut mit dem Kapital. Die haben den Kapitalismus studiert. Wir waren Kapitalisten, haben ihn aber nicht studiert. Uns interessierte nur Freiheit. Wenn in der Akademie über Lehrstühle oder sonst irgendetwas abgestimmt wurde, saßen wir, acht oder zehn Professoren, zusammen und haben gesagt: „Wir sind alle befreundet, wir stimmen das durch Handheben ab: ja oder nein?“ Uecker und Richter machten immer geheime Wahl. Die wollten nicht, dass wir sahen, wie sie abstimmten. Das ist psychologisch interessant.
Haben Sie mit denen über Kunst gesprochen?
Mehr mit Uecker, wir sind uns verwandter. Gerhard Richter ist sehr verschämt und schüchtern. Das spielt er teilweise auch, er ist trotzdem sehr egoistisch. Beuys war auch immer lustig. Ihm half man immer, mir hat man nie geholfen.
Man half Beuys?
Ja, er hatte auch einen leidenden Zug an sich.
Sie haben erwähnt, dass Sie ihn das erste Mal bei Schmela gesehen haben. Wie war später Ihr Kontakt?
Intensiv kennengelernt haben wir uns 1970 in Edinburgh. ![]() „Strategy. Get Arts! Contemporary Art from Düsseldorf“, anlässlich des 24. Edinburgh International Festival, Edinburgh College of Art, 23. August – 12. September 1970. Im Rahmen der Ausstellung zeigte Klaus Rinke eine ortsspezifische Version seiner „Wasserzirkulation“. Da hatte ich meine „Wasserzirkulation“ im Haupteingang und Beuys war wahnsinnig fasziniert. Er kam morgens immer schon mit seinem Bentley an, weil ich um acht Uhr mit der Feuerwehr das Wasser angeschlossen habe. Durch das Hauptportal habe ich den Wasserstrahl von innen nach außen gelegt, sodass alle Leute am Wasser vorbeigehen mussten. Wenn sie etwas näher kamen, waren sie nass. Daran schloss sich die „Wasserzirkulation“ an. Beuys war damals schon bekannt. „Margarine-Christus“ nannten sie ihn nach dem Happening im Ruhrgebiet, weil er da 24 Stunden auf dem Margarineberg gesessen hatte und mit einem Gerät Objekte zu sich zog.
„Strategy. Get Arts! Contemporary Art from Düsseldorf“, anlässlich des 24. Edinburgh International Festival, Edinburgh College of Art, 23. August – 12. September 1970. Im Rahmen der Ausstellung zeigte Klaus Rinke eine ortsspezifische Version seiner „Wasserzirkulation“. Da hatte ich meine „Wasserzirkulation“ im Haupteingang und Beuys war wahnsinnig fasziniert. Er kam morgens immer schon mit seinem Bentley an, weil ich um acht Uhr mit der Feuerwehr das Wasser angeschlossen habe. Durch das Hauptportal habe ich den Wasserstrahl von innen nach außen gelegt, sodass alle Leute am Wasser vorbeigehen mussten. Wenn sie etwas näher kamen, waren sie nass. Daran schloss sich die „Wasserzirkulation“ an. Beuys war damals schon bekannt. „Margarine-Christus“ nannten sie ihn nach dem Happening im Ruhrgebiet, weil er da 24 Stunden auf dem Margarineberg gesessen hatte und mit einem Gerät Objekte zu sich zog. ![]() „24-Stunden-Happening“, Galerie Parnass, Wuppertal, 05. Juni 1965. Im Rahmen des Happenings zeigte Joseph Beuys die Aktion „… und in uns … unter uns … landunter …“.
„24-Stunden-Happening“, Galerie Parnass, Wuppertal, 05. Juni 1965. Im Rahmen des Happenings zeigte Joseph Beuys die Aktion „… und in uns … unter uns … landunter …“.
Palermo hatte 1969 mein Atelier gemietet. Ich traf ihn vollkommen aufgelöst am Düsseldorfer Hauptbahnhof. „Klaus, ich habe im Herbst eine Ausstellung bei Heiner Friedrich, aber ich habe gar kein Atelier. Ich kann gar keine Kunst machen.“ Zu der Zeit begann ich gerade mit Performance. Das hatte damit zu tun, dass ich bei der Aktion ![]() „14 mal 14. Eskalation“, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, 06. Juni – 20. Juli 1969. in Baden-Baden wichtiger war als das, was ich machte. Da kam die Aggression rüber. Ich war immer mit Typen konfrontiert, ob die mich mochten oder nicht, das war egal. Ich musste verbal werden. Ich musste meine Arbeit erklären. Daraus entstand 71 die „Primärdemonstration“
„14 mal 14. Eskalation“, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, 06. Juni – 20. Juli 1969. in Baden-Baden wichtiger war als das, was ich machte. Da kam die Aggression rüber. Ich war immer mit Typen konfrontiert, ob die mich mochten oder nicht, das war egal. Ich musste verbal werden. Ich musste meine Arbeit erklären. Daraus entstand 71 die „Primärdemonstration“ ![]() Anfang der 1970er-Jahre zeigte Klaus Rinke erstmals Aktionen, in denen er durch den Einsatz seines Körpers die Verhältnisse von Raum und Zeit erforschte. Diese fasste er unter dem Begriff „Primärdemonstrationen“ zusammen. Zu den bekanntesten Beispielen dieser Werkreihe zählen „Maskulin – feminin“ (1970), „Horizontale und vertikale Kräfte. Vorgeführte Gravitation. Waagrecht – senkrecht – (Erdanziehung)“ (1971) und „Defensive – Offensive“ (1972). Siehe auch: Hans-Werner Schmidt, „Klaus Rinke: ‚Der Versuch, meine Arbeit zu erklären.‘ Ein Versuch, seine Arbeit zu erklären“, in: „Klaus Rinke. Retro Aktiv“, hg. von dems., Ausst.-Kat. Kunsthalle Düsseldorf, Düsseldorf 1992, S. 9–40, hier S. 21 ff. , bei der ich mich selbst ohne Material darstellte. Palermo hatte dann jedenfalls mein Atelier und ich hatte vorne noch die Wohnung. Dadurch, dass ich kein Trinker war, hat Palermo auch gearbeitet. Durch Ulrich Rückriem wurde er später verführt. Blinky war ein Findelkind aus Dresden, der immer seine Mutter suchte. Das war alles sehr kompliziert bei ihm – ein wahnsinnig sensibler Junge. Wenn er eine Sache gemacht hatte, fragte er immer: „Kannst du mal kommen, Klaus? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist.“ Dann zeigte er mir seine Bilder. Er war ein irrsinniger Zweifler. Er war ganz unsicher – und das ist das Dolle an seinem Werk. Bei Knoebel ist es dekorativ, bei Palermo ist es tief. Selbst wenn er nur zwei Farben nahm, saß er Monate daran, bis er es herausließ. Und das sieht man den Arbeiten an.
Anfang der 1970er-Jahre zeigte Klaus Rinke erstmals Aktionen, in denen er durch den Einsatz seines Körpers die Verhältnisse von Raum und Zeit erforschte. Diese fasste er unter dem Begriff „Primärdemonstrationen“ zusammen. Zu den bekanntesten Beispielen dieser Werkreihe zählen „Maskulin – feminin“ (1970), „Horizontale und vertikale Kräfte. Vorgeführte Gravitation. Waagrecht – senkrecht – (Erdanziehung)“ (1971) und „Defensive – Offensive“ (1972). Siehe auch: Hans-Werner Schmidt, „Klaus Rinke: ‚Der Versuch, meine Arbeit zu erklären.‘ Ein Versuch, seine Arbeit zu erklären“, in: „Klaus Rinke. Retro Aktiv“, hg. von dems., Ausst.-Kat. Kunsthalle Düsseldorf, Düsseldorf 1992, S. 9–40, hier S. 21 ff. , bei der ich mich selbst ohne Material darstellte. Palermo hatte dann jedenfalls mein Atelier und ich hatte vorne noch die Wohnung. Dadurch, dass ich kein Trinker war, hat Palermo auch gearbeitet. Durch Ulrich Rückriem wurde er später verführt. Blinky war ein Findelkind aus Dresden, der immer seine Mutter suchte. Das war alles sehr kompliziert bei ihm – ein wahnsinnig sensibler Junge. Wenn er eine Sache gemacht hatte, fragte er immer: „Kannst du mal kommen, Klaus? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist.“ Dann zeigte er mir seine Bilder. Er war ein irrsinniger Zweifler. Er war ganz unsicher – und das ist das Dolle an seinem Werk. Bei Knoebel ist es dekorativ, bei Palermo ist es tief. Selbst wenn er nur zwei Farben nahm, saß er Monate daran, bis er es herausließ. Und das sieht man den Arbeiten an.
Gallwitz hat damals gesagt: „Rinke, kommen Sie nach Baden-Baden, ich habe etwas für Sie. Mit wem können Sie sich vorstellen zur Biennale ![]() „Septième Biennale de Paris“, Parc Floral Vincennes, Paris, 24. September – 01. November 1971. nach Paris zu gehen?“ Da habe ich gesagt: „Rückriem, Knoebel, Palermo.“ Wir sind also dahin und Palermo fiel vom Stuhl, mit dem Kopf aufs Pflaster. Als ich ihn aufheben wollte, sagte Knoebel: „Du nicht.“ Diese Unverschämtheit!
„Septième Biennale de Paris“, Parc Floral Vincennes, Paris, 24. September – 01. November 1971. nach Paris zu gehen?“ Da habe ich gesagt: „Rückriem, Knoebel, Palermo.“ Wir sind also dahin und Palermo fiel vom Stuhl, mit dem Kopf aufs Pflaster. Als ich ihn aufheben wollte, sagte Knoebel: „Du nicht.“ Diese Unverschämtheit!
Es gab bestimmt Spannungen unter Ihnen, aber es muss auch ein enger Zusammenhalt in dieser Kunstszene gewesen sein?
Uecker machte Creamcheese ![]() Das Creamcheese war eine Bar, die 1967 von Hans-Joachim Reinert und Bim Reinert in der Düsseldorfer Neubrückstraße 12 eröffnet wurde. An der Ausgestaltung der Räumlichkeiten waren mehrere Künstler beteiligt, darunter Ferdinand Kriwet, Heinz Mack und Günther Uecker. Neben Theateraufführungen und Performances umfasste das Programm ebenso zahlreiche Konzerte internationaler Bands wie etwa Deep Purple, Genesis und Pink Floyd. Aufgrund anstehender Sanierungsarbeiten wurde das Creamcheese 1976 geschlossen. Siehe auch: Alexander Simmeth, „Krautrock transnational. Die Neuerfindung der Popmusik in der BRD, 1968–1978“, Bielefeld 2016, S. 113 ff. . Der war schon Anfang der 60er-Jahre in New York und hatte dort eine Diskothek, Electric Circus, erlebt. Die hat er nach Düsseldorf gebracht. Etwas anders, aber es war diese Art von Diskothek. Da hat Gerhard Richter dann ein Bild gemalt. Ich war vorher Geschäftsführer von einem Beat-Schuppen, dem Liverpool-Club, auf der Graf-Adolf-Straße. Deswegen hatte ich lange Haare. Weil wir immer Bands aus England bei uns hatten, haben wir ein Hotel in der Adersstraße gemietet. Alle 14 Tage kamen Neue. Morgens habe ich bei mir im Atelier für die Bands Frühstück gemacht. Die kamen aus Glasgow, Liverpool oder London. Alle Proletarier-Jungs, die mit Beat-Musik Geld verdienten. Bei uns waren Jimi Hendrix, The Lords, The Mirage … und ich war Geschäftsführer. Aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr, ich wollte nur noch Kunst machen. Ich hatte wahnsinnig viel Geld verdient und fing dann an, Material für Skulpturen zu kaufen. Damals sind die Polyester-Elemente entstanden. Dann kam die Creamcheese-Eröffnung und die waren so müde, weil sie so viel gearbeitet hatten – Uecker und sein Assistent hatten alles selbst hergestellt –, dass Reinert sagte: „Klaus, kannst du das für eine Woche übernehmen? Wir fahren in die Eifel. Wir haben jeden Tag 24 Stunden gearbeitet und möchten ausschlafen.“ Also habe ich mich breitschlagen lassen und für die ersten 14 Tage die Geschäftsführung im Creamcheese übernommen. Ein Jahr später hat Konrad Fischer direkt daneben die Galerie aufgemacht. Ich bin ja einer der Ersten, der da ausgestellt hat. Erst Carl Andre, dann Richard Long und dann kam ich.
Das Creamcheese war eine Bar, die 1967 von Hans-Joachim Reinert und Bim Reinert in der Düsseldorfer Neubrückstraße 12 eröffnet wurde. An der Ausgestaltung der Räumlichkeiten waren mehrere Künstler beteiligt, darunter Ferdinand Kriwet, Heinz Mack und Günther Uecker. Neben Theateraufführungen und Performances umfasste das Programm ebenso zahlreiche Konzerte internationaler Bands wie etwa Deep Purple, Genesis und Pink Floyd. Aufgrund anstehender Sanierungsarbeiten wurde das Creamcheese 1976 geschlossen. Siehe auch: Alexander Simmeth, „Krautrock transnational. Die Neuerfindung der Popmusik in der BRD, 1968–1978“, Bielefeld 2016, S. 113 ff. . Der war schon Anfang der 60er-Jahre in New York und hatte dort eine Diskothek, Electric Circus, erlebt. Die hat er nach Düsseldorf gebracht. Etwas anders, aber es war diese Art von Diskothek. Da hat Gerhard Richter dann ein Bild gemalt. Ich war vorher Geschäftsführer von einem Beat-Schuppen, dem Liverpool-Club, auf der Graf-Adolf-Straße. Deswegen hatte ich lange Haare. Weil wir immer Bands aus England bei uns hatten, haben wir ein Hotel in der Adersstraße gemietet. Alle 14 Tage kamen Neue. Morgens habe ich bei mir im Atelier für die Bands Frühstück gemacht. Die kamen aus Glasgow, Liverpool oder London. Alle Proletarier-Jungs, die mit Beat-Musik Geld verdienten. Bei uns waren Jimi Hendrix, The Lords, The Mirage … und ich war Geschäftsführer. Aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr, ich wollte nur noch Kunst machen. Ich hatte wahnsinnig viel Geld verdient und fing dann an, Material für Skulpturen zu kaufen. Damals sind die Polyester-Elemente entstanden. Dann kam die Creamcheese-Eröffnung und die waren so müde, weil sie so viel gearbeitet hatten – Uecker und sein Assistent hatten alles selbst hergestellt –, dass Reinert sagte: „Klaus, kannst du das für eine Woche übernehmen? Wir fahren in die Eifel. Wir haben jeden Tag 24 Stunden gearbeitet und möchten ausschlafen.“ Also habe ich mich breitschlagen lassen und für die ersten 14 Tage die Geschäftsführung im Creamcheese übernommen. Ein Jahr später hat Konrad Fischer direkt daneben die Galerie aufgemacht. Ich bin ja einer der Ersten, der da ausgestellt hat. Erst Carl Andre, dann Richard Long und dann kam ich. ![]() Im Oktober 1967 eröffnete Konrad Fischer (1939 Düsseldorf – 1996 Düsseldorf) seine Galerie in der Neubrückstraße 12 in Düsseldorf mit Arbeiten von Carl Andre. Es folgten unter anderem Ausstellungen mit Hanne Darboven (Dezember 1967), Sol LeWitt (Januar 1968), Blinky Palermo (Februar 1968), Fred Sandback (Mai 1968), Richard Long (September 1968) und Klaus Rinke (Februar 1969).
Im Oktober 1967 eröffnete Konrad Fischer (1939 Düsseldorf – 1996 Düsseldorf) seine Galerie in der Neubrückstraße 12 in Düsseldorf mit Arbeiten von Carl Andre. Es folgten unter anderem Ausstellungen mit Hanne Darboven (Dezember 1967), Sol LeWitt (Januar 1968), Blinky Palermo (Februar 1968), Fred Sandback (Mai 1968), Richard Long (September 1968) und Klaus Rinke (Februar 1969).
Wie war der Kontakt zu Konrad Fischer?
Konrad und ich waren so unterschiedlicher Natur, das ging nicht. Er bewunderte mich teilweise, aber es war einfach zu kompliziert. 69 hatte ich mir auf einem Wassersack ![]() Klaus Rinke, „Begehbarer Wassersack I–III“, 1968.
Klaus Rinke, „Begehbarer Wassersack I–III“, 1968. 
![]() „Experimenta 4“, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main, 28. Mai – 06. Juni 1971. Im Rahmen der Ausstellung zeigte Klaus Rinke die Aktionen „Maskulin – feminin“, „Der Mittelpunkt durch die Diagonalen“ und „Waagerecht – Senkrecht“. Mit drei Fernsehstationen.
„Experimenta 4“, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main, 28. Mai – 06. Juni 1971. Im Rahmen der Ausstellung zeigte Klaus Rinke die Aktionen „Maskulin – feminin“, „Der Mittelpunkt durch die Diagonalen“ und „Waagerecht – Senkrecht“. Mit drei Fernsehstationen.
Ihre ersten Ausstellungen hatten Sie in Galerien in Paris, in Le Havre und bei Konrad Fischer.
In Le Havre war meine erste Einzelausstellung ![]() „Klaus Rinke. Peintures récentes“, Galerie Le Portulan, Le Havre, 28. April – 19. Mai 1962. . 1961 war dann in Luxemburg die erste Ausstellung
„Klaus Rinke. Peintures récentes“, Galerie Le Portulan, Le Havre, 28. April – 19. Mai 1962. . 1961 war dann in Luxemburg die erste Ausstellung ![]() „Choix et découvertes. Quelques artistes français”, Galerie Marie-Thérèse, Luxemburg, 14. April – 06. Mai 1961. als französischer Künstler. Das vergessen die Franzosen nicht. Ich habe als französischer Künstler angefangen, und daher darf ich auch in Frankreich komische Sachen sagen, weil ich damals mit wichtigen Leuten ausgestellt wurde. Eine Galeristin, eine sehr reiche Frau, die die Galerie Marie-Thérèse gemacht hat, kam damals nach Reims und hat fünf Bilder von mir gekauft.
„Choix et découvertes. Quelques artistes français”, Galerie Marie-Thérèse, Luxemburg, 14. April – 06. Mai 1961. als französischer Künstler. Das vergessen die Franzosen nicht. Ich habe als französischer Künstler angefangen, und daher darf ich auch in Frankreich komische Sachen sagen, weil ich damals mit wichtigen Leuten ausgestellt wurde. Eine Galeristin, eine sehr reiche Frau, die die Galerie Marie-Thérèse gemacht hat, kam damals nach Reims und hat fünf Bilder von mir gekauft.
Mit Jacques Laval, dem Dominikanerpater, machte ich alle paar Wochen einen Galerien-Rundgang, den ich später in Paris auch alleine gemacht habe. Anfang der 60er-Jahre beendete Charles de Gaulle den Algerienkrieg ![]() In dem seit Mitte des 19. Jahrhunderts durch Frankreich besetzten Algerien kam es ab November 1954 zunehmend zu gewaltvollen Auseinandersetzungen zwischen der Unabhängigkeitsbewegung FLN (Front de Libération Nationale) und dem französischen Militär. Diese mündeten in einen mehrjährigen Krieg, der erst durch die Verträge von Évian am 18. März 1962 beigelegt werden konnte. Mit dem Abkommen willigte der französische Präsident Charles de Gaulle (1890 Lille – 1970 Colombey-les-Deux-Églises) in einen sofortigen Waffenstillstand sowie ein Referendum zur Unabhängigkeit Algeriens ein. Siehe auch: Martin Evans, „Algeria. France’s undeclared war“, Oxford 2012. und danach gingen viele Galeristen nach New York. Ileana Sonnabend
In dem seit Mitte des 19. Jahrhunderts durch Frankreich besetzten Algerien kam es ab November 1954 zunehmend zu gewaltvollen Auseinandersetzungen zwischen der Unabhängigkeitsbewegung FLN (Front de Libération Nationale) und dem französischen Militär. Diese mündeten in einen mehrjährigen Krieg, der erst durch die Verträge von Évian am 18. März 1962 beigelegt werden konnte. Mit dem Abkommen willigte der französische Präsident Charles de Gaulle (1890 Lille – 1970 Colombey-les-Deux-Églises) in einen sofortigen Waffenstillstand sowie ein Referendum zur Unabhängigkeit Algeriens ein. Siehe auch: Martin Evans, „Algeria. France’s undeclared war“, Oxford 2012. und danach gingen viele Galeristen nach New York. Ileana Sonnabend ![]() Ileana Sonnabend (1914 Bukarest – 2007, New York) war eine Galeristin. Von 1932 bis 1959 lebte sie in einer Ehe mit dem Kunsthändler und Galeristen Leo Castelli und eröffnete 1962 eine Galerie in Paris, in der sie insbesondere auch die amerikanische Pop-Art vertrat. 1971 gründete Sonnabend eine weitere Galerie in New York und zeigte dort junge europäische Kunst. Sie stellte unter anderen Georg Baselitz, Bernd und Hilla Becher, Gilbert & George, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg und Andy Warhol aus. blieb natürlich am Quai des Grands Augustins und stellte dort Robert Rauschenberg und Jim Dine aus. Die alte Sonnabend war toll! Wenn ich da reinkam, stand sie auf und erklärte mir die ganze Kunst. Aber auch Paul Facchetti
Ileana Sonnabend (1914 Bukarest – 2007, New York) war eine Galeristin. Von 1932 bis 1959 lebte sie in einer Ehe mit dem Kunsthändler und Galeristen Leo Castelli und eröffnete 1962 eine Galerie in Paris, in der sie insbesondere auch die amerikanische Pop-Art vertrat. 1971 gründete Sonnabend eine weitere Galerie in New York und zeigte dort junge europäische Kunst. Sie stellte unter anderen Georg Baselitz, Bernd und Hilla Becher, Gilbert & George, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg und Andy Warhol aus. blieb natürlich am Quai des Grands Augustins und stellte dort Robert Rauschenberg und Jim Dine aus. Die alte Sonnabend war toll! Wenn ich da reinkam, stand sie auf und erklärte mir die ganze Kunst. Aber auch Paul Facchetti ![]() Paul Facchetti (1912 Brescia, Italien – 2010 Joigny, Frankreich) war ein Fotograf und Galerist. Zwischen 1951 und 1979 führte er eine Galerie in Paris, in deren Programm er Werke von Karel Appel, Jean Dubuffet, Sam Francis, Paul Jenkins und Jackson Pollock zeigte. Facchetti gilt als einer der frühesten Vermittler des Abstrakten Expressionismus in Europa. auf der Rue de Lille. Der war Fotograf und fotografierte die Bilder der Künstler für die Kataloge. Einmal kam ich rein: „Ich zeige Ihnen jetzt mal Bilder und Sie sagen mir, von wem die sind.“ Dann kam er mit riesigen Rollen nicht aufgezogener Bilder und rollte sie in der Galerie aus. „Keine Ahnung.“ – „Den kennen Sie. Ein Patriot von Ihnen.“ – „Keine Ahnung.“ – „Max Ernst!“ Er fotografierte riesige Max-Ernst-Gemälde. Diese Galeristen waren anders. Oder Kahnweiler
Paul Facchetti (1912 Brescia, Italien – 2010 Joigny, Frankreich) war ein Fotograf und Galerist. Zwischen 1951 und 1979 führte er eine Galerie in Paris, in deren Programm er Werke von Karel Appel, Jean Dubuffet, Sam Francis, Paul Jenkins und Jackson Pollock zeigte. Facchetti gilt als einer der frühesten Vermittler des Abstrakten Expressionismus in Europa. auf der Rue de Lille. Der war Fotograf und fotografierte die Bilder der Künstler für die Kataloge. Einmal kam ich rein: „Ich zeige Ihnen jetzt mal Bilder und Sie sagen mir, von wem die sind.“ Dann kam er mit riesigen Rollen nicht aufgezogener Bilder und rollte sie in der Galerie aus. „Keine Ahnung.“ – „Den kennen Sie. Ein Patriot von Ihnen.“ – „Keine Ahnung.“ – „Max Ernst!“ Er fotografierte riesige Max-Ernst-Gemälde. Diese Galeristen waren anders. Oder Kahnweiler ![]() Daniel-Henry Kahnweiler (1884 Mannheim – 1979 Paris) gründete 1907 seine erste Galerie in Paris und war von da an als Kunsthändler tätig. Befreundet mit Pablo Picasso, Georges Braque und der Pariser Kunstszene der Zeit, wurde er vor allem als Vermittler der kubistischen Kunst bekannt. Aufgrund seiner jüdischen Abstammung musste Kahnweiler sich ab 1939 vor den Nationalsozialisten verstecken. Zwischen 1940 und 1945 führte seine Schwägerin Louise Leiris die Galerie unter ihrem Namen weiter. Nach dem Krieg teilte sich Kahnweiler gemeinsam mit Maurice Jardot und Louise Leiris die Leitung der Galerie, welche 1957 neue Räumlichkeiten in der Rue de Monceau in Paris eröffnete. Neben seiner Tätigkeit als Galerist publizierte er unter anderem „Der Weg zum Kubismus“(1920) und seine Memoiren „Meine Maler – meine Galerien“(1961). … der Dominikanerpater kannte ihn. Oben am Boulevard Haussmann war die Galerie Louise Leiris, die von Kahnweiler betrieben wurde. Die Galerie war meistens leer. Er wusste, dass ich ein junger deutscher Künstler war, wir haben immer Deutsch gesprochen, er war ja aus Frankfurt. Die machten einem Hoffnungen, gekauft haben sie aber nichts. Bei der Galerie Karl Flinker hat Norbert Kricke ausgestellt.
Daniel-Henry Kahnweiler (1884 Mannheim – 1979 Paris) gründete 1907 seine erste Galerie in Paris und war von da an als Kunsthändler tätig. Befreundet mit Pablo Picasso, Georges Braque und der Pariser Kunstszene der Zeit, wurde er vor allem als Vermittler der kubistischen Kunst bekannt. Aufgrund seiner jüdischen Abstammung musste Kahnweiler sich ab 1939 vor den Nationalsozialisten verstecken. Zwischen 1940 und 1945 führte seine Schwägerin Louise Leiris die Galerie unter ihrem Namen weiter. Nach dem Krieg teilte sich Kahnweiler gemeinsam mit Maurice Jardot und Louise Leiris die Leitung der Galerie, welche 1957 neue Räumlichkeiten in der Rue de Monceau in Paris eröffnete. Neben seiner Tätigkeit als Galerist publizierte er unter anderem „Der Weg zum Kubismus“(1920) und seine Memoiren „Meine Maler – meine Galerien“(1961). … der Dominikanerpater kannte ihn. Oben am Boulevard Haussmann war die Galerie Louise Leiris, die von Kahnweiler betrieben wurde. Die Galerie war meistens leer. Er wusste, dass ich ein junger deutscher Künstler war, wir haben immer Deutsch gesprochen, er war ja aus Frankfurt. Die machten einem Hoffnungen, gekauft haben sie aber nichts. Bei der Galerie Karl Flinker hat Norbert Kricke ausgestellt. ![]() „Norbert Kricke“, Galerie Karl Flinker, Paris, 1961. Flinker kannte ich persönlich ganz gut. Auch seinen Vater. Der war Wiener Jude und hatte die deutsche Buchhandlung auf der Île de la Cité. Wenn ich Ruhrgebiets-Deutsch sprach, korrigierte der Vater mich immer.
„Norbert Kricke“, Galerie Karl Flinker, Paris, 1961. Flinker kannte ich persönlich ganz gut. Auch seinen Vater. Der war Wiener Jude und hatte die deutsche Buchhandlung auf der Île de la Cité. Wenn ich Ruhrgebiets-Deutsch sprach, korrigierte der Vater mich immer.
Und die Galerien in Köln, Düsseldorf – wie war Ihr Kontakt zu denen?
Kontakt hatte ich nur zu Schmela. Diese Ausstellung 1961 in Luxemburg hieß „Choix et Découverte“. „Découverte“, die Entdeckung, war ich. „Choix“, die Auswahl, waren Josef Sima, ein tschechischer Surrealist, den ich sehr gut kannte, Jean Messagier und Vieira da Silva ![]() Maria Helena Vieira da Silva (1908 Lissabon – 1992 Paris) war eine Künstlerin, die vor allem für ihre abstrakten malerischen und grafischen Arbeiten bekannt ist. Sie war auf den ersten drei documenta-Ausstellungen (1955, 1959, 1964) vertreten. Als erste Künstlerin erhielt sie für ihr Schaffen 1966 den französischen Grand Prix National des Arts. . Die Ausstellung eröffnete samstags morgens in der Galerie Marie-Thérèse. Sie war eine wahnsinnig reiche Frau, die Streichhölzer aus Russland importierte und in ganz Europa verkaufte. Die Franzosen haben sie immer Madame Der-Die-Das genannt. Ein Besucher der Galerie war Italiener, der sehr gut Deutsch sprach – die Luxemburger sprechen nicht nur Luxemburgisch, sondern auch Französisch und Deutsch. Und dieser Besucher sprach mich dann an, ob ich nicht Lust hätte, am nächsten Tag, Sonntagmittag, zu ihm zum Essen zu kommen. Ein älterer Herr. Als er weg war, sagte ich zu jemandem: „Dieser ältere italienische Mann hat mich zum Essen eingeladen.“ – „Boah! Das ist der Stellvertreter der italienischen Stahlindustrie in der Montanunion in Luxemburg.“ Luxemburg, der kleine Staat, hatte die größte Stahlindustrie. Ich bin dahin, er hatte eine riesige Villa am Park voller Kunst und eine riesige Bibliothek. Dann wollte er wissen, ob ich lese. Ich habe ihm gesagt: „Ich habe keine Zeit zum Lesen, ich mache Kunst.“ Ich müsse lesen, sagte er. Dann hat er mir einen ganzen Koffer voller Bücher mitgegeben. Das müsse ich lesen und das müsse ich lesen, dabei hatte ich ihn gerade erst kennengelernt. Ich habe immer noch Bücher von ihm.
Maria Helena Vieira da Silva (1908 Lissabon – 1992 Paris) war eine Künstlerin, die vor allem für ihre abstrakten malerischen und grafischen Arbeiten bekannt ist. Sie war auf den ersten drei documenta-Ausstellungen (1955, 1959, 1964) vertreten. Als erste Künstlerin erhielt sie für ihr Schaffen 1966 den französischen Grand Prix National des Arts. . Die Ausstellung eröffnete samstags morgens in der Galerie Marie-Thérèse. Sie war eine wahnsinnig reiche Frau, die Streichhölzer aus Russland importierte und in ganz Europa verkaufte. Die Franzosen haben sie immer Madame Der-Die-Das genannt. Ein Besucher der Galerie war Italiener, der sehr gut Deutsch sprach – die Luxemburger sprechen nicht nur Luxemburgisch, sondern auch Französisch und Deutsch. Und dieser Besucher sprach mich dann an, ob ich nicht Lust hätte, am nächsten Tag, Sonntagmittag, zu ihm zum Essen zu kommen. Ein älterer Herr. Als er weg war, sagte ich zu jemandem: „Dieser ältere italienische Mann hat mich zum Essen eingeladen.“ – „Boah! Das ist der Stellvertreter der italienischen Stahlindustrie in der Montanunion in Luxemburg.“ Luxemburg, der kleine Staat, hatte die größte Stahlindustrie. Ich bin dahin, er hatte eine riesige Villa am Park voller Kunst und eine riesige Bibliothek. Dann wollte er wissen, ob ich lese. Ich habe ihm gesagt: „Ich habe keine Zeit zum Lesen, ich mache Kunst.“ Ich müsse lesen, sagte er. Dann hat er mir einen ganzen Koffer voller Bücher mitgegeben. Das müsse ich lesen und das müsse ich lesen, dabei hatte ich ihn gerade erst kennengelernt. Ich habe immer noch Bücher von ihm.
Ungelesen?
Ich lese nicht, ich schreibe selbst. Ich bin nicht vorbelastet. Philosophie habe ich gelesen, aber erst später. Durch ihn habe ich irrsinnige Leute kennengelernt. Er unterstützte finanziell den Buchladen von Christian Butterbach. Butterbach war ein luxemburgischer jüdischer Junge. Seine Mutter hatte ein Korsagen-Geschäft, in das die ganzen reichen Luxemburger Hausfrauen hingegangen sind. Luxemburg war sehr reich. Frankreich und Deutschland waren durch den Krieg richtig verletzt, die Luxemburger waren reich. Und im Café Namur waren nur korpulente Damen in Pelzmänteln, die Torten aßen. Christian Butterbach führte einen Buchladen und lud auch Pianisten ein. In der Villa von dem Italiener gaben unter anderen Heinz-Klaus Metzger ![]() Heinz-Klaus Metzger (1932 Konstanz – 2009 Berlin) war ein Pianist, Komponist und Musiktheoretiker. Er gehörte zu den einflussreichsten Vertretern der Neuen Musik in Deutschland. Gemeinsam mit Rainer Riehn gründete er 1977 die renommierte Fachzeitschrift „Musik-Konzepte“. und Sylvano Bussotti
Heinz-Klaus Metzger (1932 Konstanz – 2009 Berlin) war ein Pianist, Komponist und Musiktheoretiker. Er gehörte zu den einflussreichsten Vertretern der Neuen Musik in Deutschland. Gemeinsam mit Rainer Riehn gründete er 1977 die renommierte Fachzeitschrift „Musik-Konzepte“. und Sylvano Bussotti ![]() Sylvano Bussotti (* 1931 Florenz) ist ein Komponist, Musiker und Künstler. Er wird zu den frühen Vertretern der Zwölftontechnik gezählt. Von 1975 bis 1983 leitete er das Teatro La Fenice in Venedig. Anschließend war er bis 1991 als Direktor der dortigen Musikbiennale tätig. Konzerte und ich habe meine Bilder dort aufgehängt. Da tauchten auch Jean-Pierre Wilhelm und Nam June Paik auf. Unser erster tiefer Kontakt kam über Christian Butterbach zustande. Auch Radio Luxemburg entstand in dieser Zeit. Mit den ganzen Redakteuren haben wir Bridge gespielt. Ich bin gar kein Spieler, aber ich musste das dann lernen. Luxemburg war so ein spezieller Treffpunkt für Politiker aus ganz Europa. Alle waren bei Madame Madu, das war eine Bar und ein Nachtclub. Die waren zu dritt: die Oma, die Tochter und Madame Madu. Sie hat sich mit Spray einen 50er-Jahre-Haarturm gemacht, und wenn das nicht funktionierte, kam sie einfach nicht. Wenn sie aber kam, klatschten alle. Luxemburg war vollkommen wahnsinnig in der Zeit. Und dieser Dottore Guido Rietti schickte mir jeden Monat Geld. Meine einzige Verpflichtung war, dass ich ihm schriftlich auf seine Briefe antwortete und das habe ich immer gemacht. Bis 62 – da schrieb er mir seinen letzten Brief, in dem stand, er fühle sich nicht gut. Danach hat er sich das Leben genommen.
Sylvano Bussotti (* 1931 Florenz) ist ein Komponist, Musiker und Künstler. Er wird zu den frühen Vertretern der Zwölftontechnik gezählt. Von 1975 bis 1983 leitete er das Teatro La Fenice in Venedig. Anschließend war er bis 1991 als Direktor der dortigen Musikbiennale tätig. Konzerte und ich habe meine Bilder dort aufgehängt. Da tauchten auch Jean-Pierre Wilhelm und Nam June Paik auf. Unser erster tiefer Kontakt kam über Christian Butterbach zustande. Auch Radio Luxemburg entstand in dieser Zeit. Mit den ganzen Redakteuren haben wir Bridge gespielt. Ich bin gar kein Spieler, aber ich musste das dann lernen. Luxemburg war so ein spezieller Treffpunkt für Politiker aus ganz Europa. Alle waren bei Madame Madu, das war eine Bar und ein Nachtclub. Die waren zu dritt: die Oma, die Tochter und Madame Madu. Sie hat sich mit Spray einen 50er-Jahre-Haarturm gemacht, und wenn das nicht funktionierte, kam sie einfach nicht. Wenn sie aber kam, klatschten alle. Luxemburg war vollkommen wahnsinnig in der Zeit. Und dieser Dottore Guido Rietti schickte mir jeden Monat Geld. Meine einzige Verpflichtung war, dass ich ihm schriftlich auf seine Briefe antwortete und das habe ich immer gemacht. Bis 62 – da schrieb er mir seinen letzten Brief, in dem stand, er fühle sich nicht gut. Danach hat er sich das Leben genommen.
Das ging ein Jahr?
Zwei Jahre. Ich habe gesagt, dass ich kein Geld geschenkt haben will. Immer wenn ich nach Deutschland trampte, habe ich ihm etwas mitgebracht und ihm immer etwas hingehängt. Er hatte ungefähr 20 Arbeiten von mir. Rietti war wichtig. Aber leider sterben die alle. Wie wir ja auch bald … Hoffentlich nicht! Die Wutentbrannten haben Energie, die sterben nicht so einfach.
Hatten Sie mit den Münchener und Kölner Galeristen gar nichts zu tun?
Doch, ich hatte in den 70er-Jahren einen Agenten in New York, Stephen Reichard. Der hatte zwei Lofts, in denen ich immer arbeiten konnte, wenn ich da war. Darunter lebte die Tochter des Bildhauers Tony Smith, Kiki Smith ![]() Kiki Smith (* 1954 Nürnberg) ist eine Künstlerin, die für ihr bildhauerisches Werk internationales Ansehen erlangte. 1978 war sie Mitbegründerin der Künstlergruppe Collaborative Projects in New York. Sie war 1993 auf der Biennale von Venedig 1993 vertreten und nahm 1997 an der documenta 10 teil. . Bei Stephen Reichard habe ich oft zusammen mit Rudolf Zwirner
Kiki Smith (* 1954 Nürnberg) ist eine Künstlerin, die für ihr bildhauerisches Werk internationales Ansehen erlangte. 1978 war sie Mitbegründerin der Künstlergruppe Collaborative Projects in New York. Sie war 1993 auf der Biennale von Venedig 1993 vertreten und nahm 1997 an der documenta 10 teil. . Bei Stephen Reichard habe ich oft zusammen mit Rudolf Zwirner ![]() Rudolf Zwirner (* 1933 Berlin) betrieb von 1959 bis 1962 eine Galerie in Essen. 1962 eröffnete er neue Räumlichkeiten im Kolumbakirchhof in Köln. Zwirner zählte in den 1960er-Jahren zu den ersten deutschen Kunsthändlern, die in ihrem Programm US-amerikanische Gegenwartskunst, darunter John Chamberlain, Dan Flavin, Allen Jones, Roy Lichtenstein und Andy Warhol, vertraten. 1966 gründete Zwirner gemeinsam mit Hein Stünke den Verein progressiver deutscher Kunsthändler, aus dem 1967 der erste Kölner Kunstmarkt hervorging. gewohnt. Der fuhr dann nach Texas und verkaufte dort Bilder von Gerhard Richter. Irgendwann sagte er: „Rinke, mach doch mal eine Ausstellung bei mir in Köln.“ Und als ich bei ihm in der Galerie saß, sagte er zu mir: „Du, Rinke, ich brauche jeden Monat 40.000 D-Mark, um diese Galerie am Leben zu halten.“ Da habe ich zu ihm gesagt: „Rudolf, ich hoffe, dass du mir jeden Monat 40.000 Mark machst, deswegen sitze ich hier.“ Ich kannte den Zwirner schon, da war ich noch Student. Direkt neben dem Museum Folkwang in Essen war ein ganz junger Galerist mit einer Galerie in einer kleinen Wohnung im Parterre – das war Rudolf Zwirner. Als ganz junger Künstler habe ich ihn immer besucht.
Rudolf Zwirner (* 1933 Berlin) betrieb von 1959 bis 1962 eine Galerie in Essen. 1962 eröffnete er neue Räumlichkeiten im Kolumbakirchhof in Köln. Zwirner zählte in den 1960er-Jahren zu den ersten deutschen Kunsthändlern, die in ihrem Programm US-amerikanische Gegenwartskunst, darunter John Chamberlain, Dan Flavin, Allen Jones, Roy Lichtenstein und Andy Warhol, vertraten. 1966 gründete Zwirner gemeinsam mit Hein Stünke den Verein progressiver deutscher Kunsthändler, aus dem 1967 der erste Kölner Kunstmarkt hervorging. gewohnt. Der fuhr dann nach Texas und verkaufte dort Bilder von Gerhard Richter. Irgendwann sagte er: „Rinke, mach doch mal eine Ausstellung bei mir in Köln.“ Und als ich bei ihm in der Galerie saß, sagte er zu mir: „Du, Rinke, ich brauche jeden Monat 40.000 D-Mark, um diese Galerie am Leben zu halten.“ Da habe ich zu ihm gesagt: „Rudolf, ich hoffe, dass du mir jeden Monat 40.000 Mark machst, deswegen sitze ich hier.“ Ich kannte den Zwirner schon, da war ich noch Student. Direkt neben dem Museum Folkwang in Essen war ein ganz junger Galerist mit einer Galerie in einer kleinen Wohnung im Parterre – das war Rudolf Zwirner. Als ganz junger Künstler habe ich ihn immer besucht.
Sie haben die Freiheit angesprochen, die Sie mit dem Künstlerdasein verbinden. In anderen Texten schreiben Sie auch über die missionarische Seite der Künstler. Sehen Sie sich als Künstler in einer Mission?
Ich nenne mich immer Johannes der Täufer. Josef war Messias, der war messianisch, aber so vermessen bin ich nicht. Ich erkenne die Dinge. Als ich in Japan war, habe ich auch ein wenig Japanisch gelernt. Shigeo Anzai hat mir gezeigt, dass im japanischen Schriftsystem das umgedrehte H das Zeichen für Künstler ist. Der Vermittler zwischen Himmel und Erde. Das ist das alte chinesische Zeichen. Alles wartet darauf, dass ich irgendwann ein Buch herausbringe. Ich schreibe ja permanent. Wenn ich in Los Angeles auf der Leiter stehe und ein riesiges Bild male, fällt mir oben wieder etwas ein – dann renne ich runter, schreibe das auf und gehe wieder malen. In mir sitzen ganz viele Personen, das bin ich gar nicht. Ich bin nur ein Behälter und in mir gibt es Geister, die sich äußern wollen.
Diese Worte bezeichnen Sie als Vermittlung und nicht als Kunst?
Alles ist ja eine Äußerung nach außen. Du wirst gezeugt und dann im Universum alleine gelassen. Da sind andere, mit denen man kommunizieren muss, und dazu braucht man Worte, Gesten, Zeichen oder Schläge. „Wenn du mich nicht verstehst, kriegst du eine gelangt, dann verstehst du das.“ So haben das unsere Lehrer oder unsere Väter gemacht. Oder man streichelt, wenn man jemanden sympathisch findet. Der Sympathikusnerv ist ja auch zuständig für die Sexualität.
Sie haben darauf beharrt, dass es modern sein muss. Avantgarde!
Das war nach dem Krieg. Ich bin kein moderner Künstler. Heute bin ich Neandertaler und tausche moderne Kunst gegen einen Faustkeil ein – ich bin prähistorisch.
Manche Leute hassen Künstler, weil sie denken, Künstler seien von Gott begnadet. Das heißt, dass wir aufgrund unserer Kreativität Gott näher sind, was ja gar nicht stimmt. Wir sind visuelle Intelligenzen. Der eine ist verbal sehr versiert, der andere kann gar nicht reden. Kinder beginnen sich zu äußern, indem sie zeichnen, weil sie Schwierigkeiten haben zu reden. Auch in meinem Fall war es wahrscheinlich so, dass ich Angst hatte zu reden und zu scheu war – also begann ich zu zeichnen. Mein erstes Atelier war unter dem Bügeltisch meiner Mutter. Wenn es draußen regnete, durfte ich nicht rausgehen, um zu spielen. Also saß ich mit einem Block und Buntstiften unter dem Tisch und malte. Das war mein erstes Atelier. Unter dem Rock der Mutter zu sein, ist für einen Mann das Irrsinnigste. Die Mütter! Mein Gott! Ich würde gerne eine Ausstellung mit dem Titel „Mama“ machen, die von Alice Schwarzer eröffnet wird. Die Kreativität in uns ist ja weiblich, nicht männlich. Wir Männer wollen alles vermessen. Kriege! Wir wollen uns messen und sind vermessen. Das Weibliche ist das Kreative in uns. Wir haben doch eine Menge weiblicher Hormone. Bei mir sind die männlichen ein bisschen mehr.
Egal ob Sie Geld hatten oder nicht, sie haben sich immer für die Kunst entschieden?
Bis heute! Ich lebe zwar in einem Schloss, aber ich habe oft kein Geld. Das macht mir keine Angst. Meine Beschützer, die Erzengel, beschützen mich. Immer! Das Geld kommt, keine Sorge! Es kommt. 1969 sitze ich in Paris im Café de Flore, da beobachtet mich diagonal durch das Café ein sehr eleganter schwarzer Afrikaner. Sehr mager, groß, grauer Anzug, perfekt gekleidet. Ich wurde langsam aggressiv: Was guckt der mich immer so doof an? Ich saß da stundenlang und habe mich mit jemandem unterhalten. Plötzlich steht er bei mir am Tisch und erzählt mir Sachen aus meinem Leben, die er gar nicht wissen kann. Da flippen Sie aus! Ich glaube eigentlich nicht an so etwas. Er wusste, dass ich Künstler war – 69 war ich noch völlig unbekannt – und sagte mir, ich würde mein ganzes Leben kämpfen, es würde schwierig werden, aber am Ende werde ich ein ganz Großer sein. Und das trifft zu. Jetzt sehe ich das. Es ist irre, ich flippe langsam aus.
Und er blieb nicht der Einzige: Als ich nach Venice in Kalifornien kam, traf ich eine der schönsten Frauen des Orients. Sie war uralt und hatte kein Geld mehr. Früher war sie mit einem der reichsten Libanesen verheiratet und lebte in Alexandria. Sie hat alles verloren, als Nasser ![]() Gamal Abdel Nasser (1918 Alexandria – 1970 Kairo) war ein Militär und Staatsmann. Gemeinsam mit General Muhammad Nagib stürzte er im Juli 1952 durch einen Militärputsch den ägyptischen König Faruk I. Nach anfänglichen innenpolitischen Auseinandersetzungen wurde Nasser 1956 zum neuen Präsidenten Ägyptens gewählt und begleitete das Amt bis zu seinem Tod im Jahr 1970. Seine Regierungszeit kennzeichnete sich vor allem durch eine antisemitische Außenpolitik sowie die Durchsetzung eines arabischen Sozialismus. an die Macht kam – durch das sozialistische Ägypten. Sie waren in den Libanon ausgewandert, bis dort der Krieg ausbrach und sie wieder alles verloren und erneut ausgewandert sind. Ihr Mann lebte nicht mehr. Als sie jung war, war sie die schönste Frau des Orients und Aly Khan, der Sohn von Aga Khan III., war hinter ihr her. Leila lebte davon, den Menschen am Venice Beach aus den Händen zu lesen. Weil sie kein Geld hatte, habe ich mir mal aus der Hand lesen lassen. Auch sie wusste Sachen von mir, die sie nicht wissen konnte. Woher wissen die das? Das möchte ich gerne mal wissen.
Gamal Abdel Nasser (1918 Alexandria – 1970 Kairo) war ein Militär und Staatsmann. Gemeinsam mit General Muhammad Nagib stürzte er im Juli 1952 durch einen Militärputsch den ägyptischen König Faruk I. Nach anfänglichen innenpolitischen Auseinandersetzungen wurde Nasser 1956 zum neuen Präsidenten Ägyptens gewählt und begleitete das Amt bis zu seinem Tod im Jahr 1970. Seine Regierungszeit kennzeichnete sich vor allem durch eine antisemitische Außenpolitik sowie die Durchsetzung eines arabischen Sozialismus. an die Macht kam – durch das sozialistische Ägypten. Sie waren in den Libanon ausgewandert, bis dort der Krieg ausbrach und sie wieder alles verloren und erneut ausgewandert sind. Ihr Mann lebte nicht mehr. Als sie jung war, war sie die schönste Frau des Orients und Aly Khan, der Sohn von Aga Khan III., war hinter ihr her. Leila lebte davon, den Menschen am Venice Beach aus den Händen zu lesen. Weil sie kein Geld hatte, habe ich mir mal aus der Hand lesen lassen. Auch sie wusste Sachen von mir, die sie nicht wissen konnte. Woher wissen die das? Das möchte ich gerne mal wissen.
Ja, woher wissen die das?
Telepathie. Die Aborigines haben telepathische Fähigkeiten. Das ist bei uns leider verloren gegangen. Das nennt man Hellsehen.
Hat diese Frau am Venice Beach Ihnen etwas über die Zukunft oder
über die Vergangenheit gesagt?
Sie hat ein ganzes Buch über mich geschrieben. Leila lebt immer noch, sie muss fast 100 sein. Sie war sehr arm und ist in Indien irgendeinem Guru verfallen. Ich habe ihr das Geld gegeben, damit sie nach Indien gehen und ihren Guru treffen kann. Wir telefonieren manchmal. Ich habe gehört, dass sie immer noch lebt, aber sie muss uralt sein. Im Moment sterben viele Leute um mich herum. Ich werde auch 78. Die ewig Jugendlichen werden alt … Schmalenbach hat einmal gesagt: „Ich dachte nur, ich werde alt, aber der Rinke wird ja auch alt.“
Was war Ihr Anspruch an die Kunst? Inwiefern hat die gesellschaftlich-politische Situation der 60er-Jahre auch auf Ihre Arbeit gewirkt?
Bei meiner Ausstellung ![]() „Klaus Rinke. Der Versuch meine Arbeit zu erklären“, Kunsthalle Tübingen, 11. November – 10. Dezember 1972. in Tübingen 1972 haben mich die Studenten von Ernst Bloch zur Diskussion aufgefordert. Götz Adriani sagte: „Das wird eine Schlacht.“ Zur Verstärkung wollte er Bazon Brock dazu laden. Da habe ich gesagt: „Das mache ich alleine.“ Das Jahr 72 war ein Hoch in unserer Kunst. Da war die documenta, auf der ich jemandem die Nase eingeschlagen habe, weil Studenten unsere Arbeit zerstört hatten, woraufhin ich in Kassel verurteilt wurde. Jedenfalls kamen in Tübingen diese Bloch-Studenten. Der ganze Laden war voller Menschen. Abends um acht Uhr fing das an. Die Kunsthalle Tübingen hat eine kleine Bühne, da haben wir eine Bahnhofsuhr installiert und eine Messlatte: fünf Meter lang als Orientierung für Vergangenheit, Zukunft, Anfang und Ende. Außerdem hatte ich mir ein Schild mit der Aufschrift „Gegenwart“ umgehängt. Und dann habe ich da die größte Rede gehalten! Ich war so boshaft. Die Professoren aus Tübingen haben mich ihr ganzes Leben lang nicht mehr vergessen. Das hat keiner aufgenommen! Und Adriani hat noch nicht mal festgestellt, dass das wichtige Diskussionen waren. Diese Bloch-Studenten haben mich einen spätkapitalistischen Egotrip-Künstler getauft. Darauf bin ich heute noch stolz. Ich habe damals gesagt: „Ich muss die Mao-Bibel, ,Das Kapital‘ von Marx und auch die Bibel nicht lesen, ich habe eine eigene Vision der Welt. Das nehme ich mir heraus.“
„Klaus Rinke. Der Versuch meine Arbeit zu erklären“, Kunsthalle Tübingen, 11. November – 10. Dezember 1972. in Tübingen 1972 haben mich die Studenten von Ernst Bloch zur Diskussion aufgefordert. Götz Adriani sagte: „Das wird eine Schlacht.“ Zur Verstärkung wollte er Bazon Brock dazu laden. Da habe ich gesagt: „Das mache ich alleine.“ Das Jahr 72 war ein Hoch in unserer Kunst. Da war die documenta, auf der ich jemandem die Nase eingeschlagen habe, weil Studenten unsere Arbeit zerstört hatten, woraufhin ich in Kassel verurteilt wurde. Jedenfalls kamen in Tübingen diese Bloch-Studenten. Der ganze Laden war voller Menschen. Abends um acht Uhr fing das an. Die Kunsthalle Tübingen hat eine kleine Bühne, da haben wir eine Bahnhofsuhr installiert und eine Messlatte: fünf Meter lang als Orientierung für Vergangenheit, Zukunft, Anfang und Ende. Außerdem hatte ich mir ein Schild mit der Aufschrift „Gegenwart“ umgehängt. Und dann habe ich da die größte Rede gehalten! Ich war so boshaft. Die Professoren aus Tübingen haben mich ihr ganzes Leben lang nicht mehr vergessen. Das hat keiner aufgenommen! Und Adriani hat noch nicht mal festgestellt, dass das wichtige Diskussionen waren. Diese Bloch-Studenten haben mich einen spätkapitalistischen Egotrip-Künstler getauft. Darauf bin ich heute noch stolz. Ich habe damals gesagt: „Ich muss die Mao-Bibel, ,Das Kapital‘ von Marx und auch die Bibel nicht lesen, ich habe eine eigene Vision der Welt. Das nehme ich mir heraus.“
Ich wollte immer die Hand reichen. Mit den ganzen „Primärdemonstrationen“ wollte ich den Menschen zeigen, womit wir Menschen umgehen: Zeit, Ermüdung, maskulin und feminin, Aggression, Wasser. Das habe ich ein paar Jahre lang gemacht. Bis zum „New Dance Festival“ beim Steirischen Herbst mit den Japanern und Trisha Brown – danach habe ich aufgehört. ![]() „New Dance Festival“, anlässlich des Steirischen Herbsts, Graz, 19.–24. Oktober 1976. Im Rahmen des Festivals zeigte Klaus Rinke seine letzte „Primärdemonstration“ mit Monika Baumgartl. Wenn ich es heute mache, dann eher verbal. Worte verletzen mehr als irgendeine Aktion. Wenn Marina Abramović heute ihre Vagina zeigt, bedeutet das gar nichts. Hamburger Stripper machen das und leben davon. Aber Erkenntnis weitergeben, auch Zorn und Liebenswürdigkeit, das geht tief. Egal wo. Wenn ich heute Reden halte, bewirke ich damit wirklich etwas.
„New Dance Festival“, anlässlich des Steirischen Herbsts, Graz, 19.–24. Oktober 1976. Im Rahmen des Festivals zeigte Klaus Rinke seine letzte „Primärdemonstration“ mit Monika Baumgartl. Wenn ich es heute mache, dann eher verbal. Worte verletzen mehr als irgendeine Aktion. Wenn Marina Abramović heute ihre Vagina zeigt, bedeutet das gar nichts. Hamburger Stripper machen das und leben davon. Aber Erkenntnis weitergeben, auch Zorn und Liebenswürdigkeit, das geht tief. Egal wo. Wenn ich heute Reden halte, bewirke ich damit wirklich etwas.
Können Sie beschreiben, warum Sie das Bedürfnis hatten, diese „Primärdemonstrationen“ auszuführen? Das waren sehr direkte Konfrontationen mit dem Publikum, eine Mitteilung oder Vermittlung Ihrer Erkenntnisse.
Manchmal entstanden die Stücke sogar vor den Leuten. Mir kam eine Idee, ich baute das ein und machte daraus ein neues Stück. Ich habe immer gesagt: „Ihr seid Zeugen echter momentaner Kreativität.“
Hat das für Sie funktioniert?
Ja. Wenn die Aktionen vorbei waren, saßen die Leute manchmal 20 Minuten vor dem leeren Raum. Wir hatten ihn mit Problemen gefüllt. Das war richtig aufgeladen. In Holland, wo wir im Freien vorgeführt haben, ![]() „Sonsbeek 71. Sonsbeek buiten de perken“, Park Sonsbeek, Arnheim, 19. Juni – 15. August 1971. kamen die Leute jeden Tag mit einer Decke. Sie saßen 150 Meter von mir entfernt und haben nie mit mir gesprochen. Von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends haben wir Vorführungen gemacht. Auch bei unseren Pausen zwischendurch schauten die Leute uns zu. Das war eine Art Meditation. Aber in den Body-Art-Büchern tauche ich selten auf. Es lief gerade wieder der Performancefilm
„Sonsbeek 71. Sonsbeek buiten de perken“, Park Sonsbeek, Arnheim, 19. Juni – 15. August 1971. kamen die Leute jeden Tag mit einer Decke. Sie saßen 150 Meter von mir entfernt und haben nie mit mir gesprochen. Von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends haben wir Vorführungen gemacht. Auch bei unseren Pausen zwischendurch schauten die Leute uns zu. Das war eine Art Meditation. Aber in den Body-Art-Büchern tauche ich selten auf. Es lief gerade wieder der Performancefilm ![]() „Marina Abramović. The Artist Is Present“, Regie: Matthew Akers, 106 Minuten, 2012. über Abramović und Ulay, ihren Partner. Sie hat in meiner Klasse Vorführungen gemacht, aber in dem Film werde ich nicht einmal erwähnt. Oder Ulrike Rosenbach … die hat immer so liebe Sachen gemacht, ich hingegen habe wirklich vorgeführt.
„Marina Abramović. The Artist Is Present“, Regie: Matthew Akers, 106 Minuten, 2012. über Abramović und Ulay, ihren Partner. Sie hat in meiner Klasse Vorführungen gemacht, aber in dem Film werde ich nicht einmal erwähnt. Oder Ulrike Rosenbach … die hat immer so liebe Sachen gemacht, ich hingegen habe wirklich vorgeführt.
Und Franz Erhard Walther?
Der hat ja mehr ein Objekte-Benutzen gemacht. Ich habe die Menschen in meinen Werken selbst nicht mit eingeplant. Das habe ich nur einmal im Jahr 69 in der Kunsthalle bei der Ausstellung „Zwischenmenschliche Beziehung“ ![]() „between 2“, Städtische Kunsthalle Düsseldorf, 21./22. Juni 1969. Im Rahmen der Ausstellung zeigte Klaus Rinke seine Arbeit „Zwischenmenschliche Beziehungen“. Auf einer aus Bauholzdielen, Holztischen und Bänken bestehenden Aktionsfläche wurde der Raum zwischen den einzelnen Besuchern vermessen und verändert. gemacht. Da habe ich die Zwischenräume vermessen und die Leute zusammengebracht. Langsam, bis sie ganz nah waren. Walther war unheimlich eifersüchtig – Künstler sind ja manchmal doofer als Tenöre. Damals wollte der Direktor des Museums in Darmstadt mit mir und Franz Erhard Walther eine Ausstellung machen.
„between 2“, Städtische Kunsthalle Düsseldorf, 21./22. Juni 1969. Im Rahmen der Ausstellung zeigte Klaus Rinke seine Arbeit „Zwischenmenschliche Beziehungen“. Auf einer aus Bauholzdielen, Holztischen und Bänken bestehenden Aktionsfläche wurde der Raum zwischen den einzelnen Besuchern vermessen und verändert. gemacht. Da habe ich die Zwischenräume vermessen und die Leute zusammengebracht. Langsam, bis sie ganz nah waren. Walther war unheimlich eifersüchtig – Künstler sind ja manchmal doofer als Tenöre. Damals wollte der Direktor des Museums in Darmstadt mit mir und Franz Erhard Walther eine Ausstellung machen.
Gerhard Bott ![]() Gerhard Bott (* 1927 Hanau) ist ein Kunsthistoriker und Historiker. Von 1957 bis 1960 leitete er das Historische Museum Frankfurt, bevor er die Direktion des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt übernahm. Zwischen 1975 und 1980 war er als Direktor des Wallraf-Richartz-Museums sowie als Generaldirektor der Museen der Stadt Köln tätig, wo er die Gründung des dortigen Museums Ludwig mitverantwortete. Von 1980 bis zu seiner Pensionierung 1993 führte er als Generaldirektor das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg. Bott war von 1964 bis 1972 außerdem im documenta-Rat. ?
Gerhard Bott (* 1927 Hanau) ist ein Kunsthistoriker und Historiker. Von 1957 bis 1960 leitete er das Historische Museum Frankfurt, bevor er die Direktion des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt übernahm. Zwischen 1975 und 1980 war er als Direktor des Wallraf-Richartz-Museums sowie als Generaldirektor der Museen der Stadt Köln tätig, wo er die Gründung des dortigen Museums Ludwig mitverantwortete. Von 1980 bis zu seiner Pensionierung 1993 führte er als Generaldirektor das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg. Bott war von 1964 bis 1972 außerdem im documenta-Rat. ?
Ich glaube, das war Bott. Er hat mich in Darmstadt angesprochen, aber Walther hat gesagt: „Mit Rinke nie.“ Heute würde ich sagen: „Du hast alles verpasst! Wir hätten beide eine tolle Ausstellung und eine vollkommen neue Kunstrichtung begründen können.“ Er wollte nicht. Heute fragt er: „Rinke, wie geht es dir?“ – „Zu spät, Junge!“ Man muss dann auch zusammenhalten. Ich bin nicht eifersüchtig! Ich habe eine ganz andere Kunst gemacht. Ich war Wasserkünstler und habe mit zwei Eimern dagestanden. ![]() Klaus Rinke, „Horizontale und vertikale Kräfte. Vorgeführte Gravitation. Waagerecht – senkrecht – (Erdanziehung)“, 1971.
Klaus Rinke, „Horizontale und vertikale Kräfte. Vorgeführte Gravitation. Waagerecht – senkrecht – (Erdanziehung)“, 1971.  Heute weiß ich, weil ich mit einer Jüdin verheiratet bin, dass der Wasserträger bei den Juden der Wahrheitsbringer ist. Alles, was wir machen, kommt irgendwoher. Wir machen das intuitiv und plötzlich hat es eine riesige Bedeutung in der Menschheitsgeschichte. Mich interessiert die Menschheitsgeschichte vielmehr als die Kunstgeschichte. Kunst ist ja reine Mode geworden.
Heute weiß ich, weil ich mit einer Jüdin verheiratet bin, dass der Wasserträger bei den Juden der Wahrheitsbringer ist. Alles, was wir machen, kommt irgendwoher. Wir machen das intuitiv und plötzlich hat es eine riesige Bedeutung in der Menschheitsgeschichte. Mich interessiert die Menschheitsgeschichte vielmehr als die Kunstgeschichte. Kunst ist ja reine Mode geworden.
Gab es andere Leute als Monika Baumgartl, mit denen Sie zusammengearbeitet haben?
Monika Baumgartl war meine Partnerin. Mit Gerry Schum ![]() Gerry Schum (eigtl. Gerhard Alexander Schum; 1938 Köln – 1973 Düsseldorf) war ein Filmemacher und Galerist, der ab 1964 Kunstdokumentationen für den Westdeutschen Rundfunk produzierte. 1967 initiierte er das Fernsehformat „Fernsehgalerie“, für das er die international beachteten Beiträge „Land Art“ (1969) und „Identifications“ (1970) produzierte. 1971 eröffnete er die Videogalerie Schum in Düsseldorf. Es war die erste Galerie, die sich auf die Produktion und Distribution künstlerischer Videoeditionen konzentrierte. Schum arbeitete unter anderen mit Joseph Beuys, Daniel Buren, Jan Dibbets, Klaus Rinke, Ulrike Rosenbach und Lawrence Weiner. Gerry Schum beging 1973 in seinem Wohnmobil Selbstmord. war ich wirklich richtig befreundet. Gott sei Dank haben wir den damals nicht gefunden. Hätten wir die Tür aufgemacht, hätten wir Gerry tot aufgefunden. Er hat mir das seinerzeit nicht erzählt, weil ich zu männlich war. Er dachte: „Dem Rinke kannst du das nicht sagen.“ Ich habe gesagt: „Vergiss Ursula Wevers
Gerry Schum (eigtl. Gerhard Alexander Schum; 1938 Köln – 1973 Düsseldorf) war ein Filmemacher und Galerist, der ab 1964 Kunstdokumentationen für den Westdeutschen Rundfunk produzierte. 1967 initiierte er das Fernsehformat „Fernsehgalerie“, für das er die international beachteten Beiträge „Land Art“ (1969) und „Identifications“ (1970) produzierte. 1971 eröffnete er die Videogalerie Schum in Düsseldorf. Es war die erste Galerie, die sich auf die Produktion und Distribution künstlerischer Videoeditionen konzentrierte. Schum arbeitete unter anderen mit Joseph Beuys, Daniel Buren, Jan Dibbets, Klaus Rinke, Ulrike Rosenbach und Lawrence Weiner. Gerry Schum beging 1973 in seinem Wohnmobil Selbstmord. war ich wirklich richtig befreundet. Gott sei Dank haben wir den damals nicht gefunden. Hätten wir die Tür aufgemacht, hätten wir Gerry tot aufgefunden. Er hat mir das seinerzeit nicht erzählt, weil ich zu männlich war. Er dachte: „Dem Rinke kannst du das nicht sagen.“ Ich habe gesagt: „Vergiss Ursula Wevers ![]() Ursula Wevers (* 1943 Hameln) ist eine Künstlerin, die an der Schnittstelle von Video und Fotografie arbeitet. Sie war mit Gerry Schum verheiratet und arbeitete ab 1968 zusammen mit ihm an der Produktion der „Fernsehgalerie“ und später an der Entwicklung der „Videogalerie Schum“. Nach dem Tod ihres Ehemanns im Jahr 1973 führte sie das Galerieprogramm mithilfe des Galeristen Rolf Ricke in neuen Räumlichkeiten fort. Ab 1976 lehrte Wevers als Professorin zunächst an der Kunstakademie Düsseldorf und später an der Bergischen Universität Wuppertal. . Wir gehen in die Diskothek tanzen, da findest du eine Neue.“ Aber er litt sehr darunter. Die ganzen Jahre hatte er sie malträtiert und ich habe gesagt: „Gerry, lass die Ursula in Ruhe.“ Die ist abgehauen, weil sie das nicht mehr ertragen konnte. Er war ja so ein Chauvinist.
Ursula Wevers (* 1943 Hameln) ist eine Künstlerin, die an der Schnittstelle von Video und Fotografie arbeitet. Sie war mit Gerry Schum verheiratet und arbeitete ab 1968 zusammen mit ihm an der Produktion der „Fernsehgalerie“ und später an der Entwicklung der „Videogalerie Schum“. Nach dem Tod ihres Ehemanns im Jahr 1973 führte sie das Galerieprogramm mithilfe des Galeristen Rolf Ricke in neuen Räumlichkeiten fort. Ab 1976 lehrte Wevers als Professorin zunächst an der Kunstakademie Düsseldorf und später an der Bergischen Universität Wuppertal. . Wir gehen in die Diskothek tanzen, da findest du eine Neue.“ Aber er litt sehr darunter. Die ganzen Jahre hatte er sie malträtiert und ich habe gesagt: „Gerry, lass die Ursula in Ruhe.“ Die ist abgehauen, weil sie das nicht mehr ertragen konnte. Er war ja so ein Chauvinist.
Andere Künstler? Mit Pina Bausch wollten wir mal etwas zusammen machen, aber die hat dann auch gesagt: „Bei mir dauert das immer so lange.“ Wir haben zusammen studiert. Sie lebte bei den Sammlern Gustav Adolf und Stella Baum und ich lebte in Haan. Als sie nach Wuppertal kam, haben wir abends oft zusammen gegessen. Meine Studenten sagen immer, dass ich nie etwas zu deren Kunst gesagt hätte. „Wenn er nichts sagt, ist ja alles okay.“ Dasselbe sagen die Tänzerinnen über Pina Bausch. Sie hat nie etwas gesagt, sie hat nur zugeguckt und es wirken lassen. Ich fand das ja auch ganz gut. Erst durch den Film von Wim Wenders ![]() „Pina – Tanzt, tanzt sonst sind wir verloren“, Regie: Wim Wenders, 106 Minuten, 2011. , ist mir klar geworden, dass Pina ihre femininen Probleme über ihre Tanzstücke herausließ. Bevor Sie heute kamen, habe ich einen Text geschrieben darüber, dass ich ein Neutrum war. Ich wollte meine Gefühle nach außen hin nie zeigen. Ich habe nie meinen Schwanz gezeigt. Wenn ich irgendetwas machte, waren das immer echte Lebensskulpturen, die vollkommen neutral, prototypenhaft waren. Der Mensch als Prototyp war ich. Ich musste meine Psyche nicht vor dem Publikum auskotzen. Und das ist der Unterschied. Als Klauke
„Pina – Tanzt, tanzt sonst sind wir verloren“, Regie: Wim Wenders, 106 Minuten, 2011. , ist mir klar geworden, dass Pina ihre femininen Probleme über ihre Tanzstücke herausließ. Bevor Sie heute kamen, habe ich einen Text geschrieben darüber, dass ich ein Neutrum war. Ich wollte meine Gefühle nach außen hin nie zeigen. Ich habe nie meinen Schwanz gezeigt. Wenn ich irgendetwas machte, waren das immer echte Lebensskulpturen, die vollkommen neutral, prototypenhaft waren. Der Mensch als Prototyp war ich. Ich musste meine Psyche nicht vor dem Publikum auskotzen. Und das ist der Unterschied. Als Klauke ![]() Jürgen Klauke (* 1943 Kliding) ist ein deutscher Künstler, der in den 1970er-Jahren mit seinen fotografischen Inszenierungen zur geschlechtlichen Identität bekannt wurde. Von 1993 bis 2008 lehrte Klauke als Professor für künstlerische Fotografie an der Kunsthochschule für Medien Köln. anfing, Transvestit zu spielen oder die Künstler anfingen, sich alles aufzuschneiden, da habe ich gesagt: „Die sind doch bescheuert. Das können sie zu Hause machen, wenn sie pervers sind. Sie können machen, was sie wollen.“ Aber ich habe etwas anderes gemacht. Ich habe direkt vor den Leuten Kreativität gezeigt. Immer vollkommen neutral. Fast apokalyptisch. Ohne Schmerz. Ein Gesicht ohne Ausdruck. Ein ausdrucksloses Gesicht. Ich habe immer versucht neutral zu bleiben. Und das ist nicht einfach! Mein Gesicht immer ein Nichts. Ich habe keine Fratzen. Arnulf Rainer zum Beispiel, das möchte ich auch mal laut sagen, ist erst auf den Wagen aufgesprungen, als wir so etwas machten. Da fing er an, seine Grimassen zu machen und zu übermalen. Er war ja ein Übermaler.
Jürgen Klauke (* 1943 Kliding) ist ein deutscher Künstler, der in den 1970er-Jahren mit seinen fotografischen Inszenierungen zur geschlechtlichen Identität bekannt wurde. Von 1993 bis 2008 lehrte Klauke als Professor für künstlerische Fotografie an der Kunsthochschule für Medien Köln. anfing, Transvestit zu spielen oder die Künstler anfingen, sich alles aufzuschneiden, da habe ich gesagt: „Die sind doch bescheuert. Das können sie zu Hause machen, wenn sie pervers sind. Sie können machen, was sie wollen.“ Aber ich habe etwas anderes gemacht. Ich habe direkt vor den Leuten Kreativität gezeigt. Immer vollkommen neutral. Fast apokalyptisch. Ohne Schmerz. Ein Gesicht ohne Ausdruck. Ein ausdrucksloses Gesicht. Ich habe immer versucht neutral zu bleiben. Und das ist nicht einfach! Mein Gesicht immer ein Nichts. Ich habe keine Fratzen. Arnulf Rainer zum Beispiel, das möchte ich auch mal laut sagen, ist erst auf den Wagen aufgesprungen, als wir so etwas machten. Da fing er an, seine Grimassen zu machen und zu übermalen. Er war ja ein Übermaler.
Warum sprechen Sie im Plural? Als „wir“ anfingen …?
Monika Baumgartl und ich.
In New York gab es die Tänzer Trisha Brown ![]() Trisha Brown (* 1936 Aberdeen, Washington – 2017 San Antonio, Texas) war eine US-amerikanische Choreografin für modernen Tanz sowie Gründerin der Trisha Brown Company. oder Yvonne Rainer
Trisha Brown (* 1936 Aberdeen, Washington – 2017 San Antonio, Texas) war eine US-amerikanische Choreografin für modernen Tanz sowie Gründerin der Trisha Brown Company. oder Yvonne Rainer ![]() Yvonne Rainer (* 1934 San Francisco) wurde als Tänzerin und Choreografin mit dem Judson Dance Theater bekannt, dem sie seit der Entstehung 1962 gemeinsam mit unter anderen Trisha Brown, Sally Gross und Carolee Schneemann angehörte. Ab den 1970er-Jahren produzierte Rainer außerdem experimentelle und feministisch motivierte Filme. Zu ihren bekanntesten Arbeiten zählen „A Film About a Woman Who …“(1974) und „Privilege“(1990). Rainer lehrt seit 1974 im Whitney Independent Program des Whitney Museum of American Art in New York. . Das war aber etwas anders. Serra hat mich immer Wooden-x-Performer genannt – aber das stimmte gar nicht. Bei mir verlangsamten sich die Stücke. Wir bewegten uns wie Uhrwerke und zwischendurch bewegten wir uns normal. Das Normale war keine Kunst. Aber in dem Moment, in dem wir stillstanden und uns wieder in Bewegung setzten, wurde das Kunst. Oder wenn ich mir selbst einen Befehl gab: Ich habe in eine Richtung gezeigt und bin dann dahin gegangen und dort stehen geblieben. Das war ein Stück. Dazwischen lief ich normal. Das war kein Stück, das war das normale Leben.
Yvonne Rainer (* 1934 San Francisco) wurde als Tänzerin und Choreografin mit dem Judson Dance Theater bekannt, dem sie seit der Entstehung 1962 gemeinsam mit unter anderen Trisha Brown, Sally Gross und Carolee Schneemann angehörte. Ab den 1970er-Jahren produzierte Rainer außerdem experimentelle und feministisch motivierte Filme. Zu ihren bekanntesten Arbeiten zählen „A Film About a Woman Who …“(1974) und „Privilege“(1990). Rainer lehrt seit 1974 im Whitney Independent Program des Whitney Museum of American Art in New York. . Das war aber etwas anders. Serra hat mich immer Wooden-x-Performer genannt – aber das stimmte gar nicht. Bei mir verlangsamten sich die Stücke. Wir bewegten uns wie Uhrwerke und zwischendurch bewegten wir uns normal. Das Normale war keine Kunst. Aber in dem Moment, in dem wir stillstanden und uns wieder in Bewegung setzten, wurde das Kunst. Oder wenn ich mir selbst einen Befehl gab: Ich habe in eine Richtung gezeigt und bin dann dahin gegangen und dort stehen geblieben. Das war ein Stück. Dazwischen lief ich normal. Das war kein Stück, das war das normale Leben.
In den 60er- und 70er-Jahren hatten Sie wahnsinnig viele Ausstellungen.
18 Stück im Jahr 78. Da bin ich von einer Ausstellung zur nächsten gefahren.
Wie haben Sie das für sich selbst begriffen?
Das war auch Teil der Performance: lange Reise, schnelle Stücke. Ich habe oft an Ort und Stelle irgendetwas gemacht. In Akron, Ohio, war John Coplans ![]() John Coplans (1920 London – 2003 New York) war ein Künstler, Kunstkritiker und Kurator. Gemeinsam mit John P. Irwin gründete er 1962 das Kunstmagazin „Artforum“, für das er anschließend als Redakteur arbeitete. Zwischen 1968 und 1970 leitete er als Direktor das Pasadena Art Museum, bevor er 1971 als Chefredakteur des „Artforum“ nach New York wechselte. Ab 1984 widmete er sich zunehmend seiner künstlerischen Arbeit. Diese zeichnet sich vor allem durch fotografische Studien des eigenen Körpers aus. , der ehemalige Boss vom Art Forum, Museumsdirektor. Er war Südafrikaner, ein berühmter Mann, der später auch ein großer Künstler geworden ist. Coplans hat ähnliche Fotos gemacht wie ich, hat sich immer nackt fotografiert. Er hatte mich zu einer Fotoausstellung
John Coplans (1920 London – 2003 New York) war ein Künstler, Kunstkritiker und Kurator. Gemeinsam mit John P. Irwin gründete er 1962 das Kunstmagazin „Artforum“, für das er anschließend als Redakteur arbeitete. Zwischen 1968 und 1970 leitete er als Direktor das Pasadena Art Museum, bevor er 1971 als Chefredakteur des „Artforum“ nach New York wechselte. Ab 1984 widmete er sich zunehmend seiner künstlerischen Arbeit. Diese zeichnet sich vor allem durch fotografische Studien des eigenen Körpers aus. , der ehemalige Boss vom Art Forum, Museumsdirektor. Er war Südafrikaner, ein berühmter Mann, der später auch ein großer Künstler geworden ist. Coplans hat ähnliche Fotos gemacht wie ich, hat sich immer nackt fotografiert. Er hatte mich zu einer Fotoausstellung ![]() „Klaus Rinke. Conceptions“, Akron Art Museum, 03. November – 03. Dezember 1978. eingeladen, wollte aber, dass ich auch eine Performance mache. Am Tag der Eröffnung kam ich in Akron, Ohio, an, wo die berühmten amerikanischen Autoreifen herkommen. Ich bin dort herumgelaufen und habe dann in einem Gebäude durchs Fenster Anstreicher oder Putzer gesehen, die auf ganz seltsamen Aluminiumstelzen die Decke strichen. „Where did you get these shoes?“ Sie nannten mir einen Laden, ich bin mit dem Taxi dahin gefahren, habe mir die Schuhe gekauft, angeschnallt und dann die One-Man-Show „Opening-Shoes“ gezeigt. Ich war damit drei Meter groß und habe von oben den Leuten die Hand gegeben. Das habe ich noch mal in Zürich mit Beuys gemacht – da flippen die Leute immer noch aus. Die deutschen Künstler haben nie richtig zusammengehalten – bis auf die ZERO-Leute vielleicht. Mit Beuys wollte ich die Akademie machen. Wir waren zusammen in Wien in der Secession und machten eine Ausstellung
„Klaus Rinke. Conceptions“, Akron Art Museum, 03. November – 03. Dezember 1978. eingeladen, wollte aber, dass ich auch eine Performance mache. Am Tag der Eröffnung kam ich in Akron, Ohio, an, wo die berühmten amerikanischen Autoreifen herkommen. Ich bin dort herumgelaufen und habe dann in einem Gebäude durchs Fenster Anstreicher oder Putzer gesehen, die auf ganz seltsamen Aluminiumstelzen die Decke strichen. „Where did you get these shoes?“ Sie nannten mir einen Laden, ich bin mit dem Taxi dahin gefahren, habe mir die Schuhe gekauft, angeschnallt und dann die One-Man-Show „Opening-Shoes“ gezeigt. Ich war damit drei Meter groß und habe von oben den Leuten die Hand gegeben. Das habe ich noch mal in Zürich mit Beuys gemacht – da flippen die Leute immer noch aus. Die deutschen Künstler haben nie richtig zusammengehalten – bis auf die ZERO-Leute vielleicht. Mit Beuys wollte ich die Akademie machen. Wir waren zusammen in Wien in der Secession und machten eine Ausstellung ![]() „Internationale Biennale für Graphik und visuelle Kunst“, Secession Wien, 23. Juni – 22. Juli 1979. . „Rinke, zum Telefon.“ – „Wer ist denn dran?“ – „Ministerium.“ Da sagte Beuys: „Was wollen die denn von dir?“ – „Weiß ich nicht, keine Ahnung.“ Es war Jochimsen
„Internationale Biennale für Graphik und visuelle Kunst“, Secession Wien, 23. Juni – 22. Juli 1979. . „Rinke, zum Telefon.“ – „Wer ist denn dran?“ – „Ministerium.“ Da sagte Beuys: „Was wollen die denn von dir?“ – „Weiß ich nicht, keine Ahnung.“ Es war Jochimsen ![]() Reimut Jochimsen (1933 Niebüll – 1999 Bonn) war ein Wirtschaftswissenschaftler und Politiker. Von 1970 bis 1973 leitete er die Planungsabteilung des Bundeskanzleramts und wurde 1973 zum Staatssekretär des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft berufen. 1978 bis 1980 leitete er in der SPD-Regierung unter Johannes Rau das Ministerium für Wissenschaft und Forschung in Nordrhein-Westfalen. Nach Raus Wiederwahl 1980 war er bis 1990 in der Landesregierung als Wirtschaftsminister tätig. , unser Wissenschaftsminister, den wir duzten, seitdem seine Frau Margarethe mich eingeladen hatte, in der Universität in Kiel eine Vorführung zu machen. Damals wohnten wir bei ihm zu Hause. „Kricke hatte einen Herzinfarkt und ist jetzt ausgeschaltet, du musst sofort die Direktion übernehmen.“ Das war zu der Zeit, als Beuys und ich uns immer näherkamen. 79 sind wir zusammen von Düsseldorf mit dem Auto nach Paris zur Ausstellung „Allemagne auhourd’hui“
Reimut Jochimsen (1933 Niebüll – 1999 Bonn) war ein Wirtschaftswissenschaftler und Politiker. Von 1970 bis 1973 leitete er die Planungsabteilung des Bundeskanzleramts und wurde 1973 zum Staatssekretär des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft berufen. 1978 bis 1980 leitete er in der SPD-Regierung unter Johannes Rau das Ministerium für Wissenschaft und Forschung in Nordrhein-Westfalen. Nach Raus Wiederwahl 1980 war er bis 1990 in der Landesregierung als Wirtschaftsminister tätig. , unser Wissenschaftsminister, den wir duzten, seitdem seine Frau Margarethe mich eingeladen hatte, in der Universität in Kiel eine Vorführung zu machen. Damals wohnten wir bei ihm zu Hause. „Kricke hatte einen Herzinfarkt und ist jetzt ausgeschaltet, du musst sofort die Direktion übernehmen.“ Das war zu der Zeit, als Beuys und ich uns immer näherkamen. 79 sind wir zusammen von Düsseldorf mit dem Auto nach Paris zur Ausstellung „Allemagne auhourd’hui“ ![]() „Art Allemagne aujourd’hui“, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 17. Januar – 08. März 1981. gefahren. Ich sprach Französisch, Beuys nicht. Bei der Pressekonferenz saß er neben mir und ich habe übersetzt. Die französischen Journalisten stellten Fragen wie: „Monsieur Beuys, est-ce que vous êtes Richard Wagner de l’Art Visuelle?“ Da habe ich gesagt: „Beuys ist Beuys. Richard Wagner ist ein Musiker.“ Dann haben die gesagt: „Taisez-vous! Vous êtes Siegfried.“ Wir sind jeden Abend zusammen essen gegangen. Beuys ist endlos oft eingeladen worden, aber er fragte mich immer: „Was machen wir heute? Was willst du?“ Ich kannte ein paar arabische Restaurants, da wollte er immer hin. Wir waren ja auch zusammen bei Schmela. Mit der Familie Schmela sind wir oft essen gegangen. Und dann war Beuys auch bei mir zu Hause. Obwohl er aus der Akademie raus war, hatte er ja dort noch sein Atelier und die FIU, die Freie Universität.
„Art Allemagne aujourd’hui“, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 17. Januar – 08. März 1981. gefahren. Ich sprach Französisch, Beuys nicht. Bei der Pressekonferenz saß er neben mir und ich habe übersetzt. Die französischen Journalisten stellten Fragen wie: „Monsieur Beuys, est-ce que vous êtes Richard Wagner de l’Art Visuelle?“ Da habe ich gesagt: „Beuys ist Beuys. Richard Wagner ist ein Musiker.“ Dann haben die gesagt: „Taisez-vous! Vous êtes Siegfried.“ Wir sind jeden Abend zusammen essen gegangen. Beuys ist endlos oft eingeladen worden, aber er fragte mich immer: „Was machen wir heute? Was willst du?“ Ich kannte ein paar arabische Restaurants, da wollte er immer hin. Wir waren ja auch zusammen bei Schmela. Mit der Familie Schmela sind wir oft essen gegangen. Und dann war Beuys auch bei mir zu Hause. Obwohl er aus der Akademie raus war, hatte er ja dort noch sein Atelier und die FIU, die Freie Universität. ![]() Nachdem 1972 ein neues Zulassungsverfahren an der Akademie eingeführt wurde, besetzte Beuys mit einigen seiner Studenten das Hochschulsekretariat. Der im Zuge dessen erteilten Entlassung durch den nordrhein-westfälischen Wissenschaftsminister Johannes Rau begegnete Beuys mit einer langjährigen Klage vor dem Bundesarbeitsgericht. In dem ihm gerichtlich auf Lebenszeit zugesprochenen Raum 3 der Düsseldorfer Kunstakademie initiierte Joseph Beuys 1973 gemeinsam mit Willi Bongard, Georg Meistermann und Klaus Staeck die Freie Internationale Universität (FIU), die als freie Hochschule das bestehende Bildungssystem ergänzen sollte. Die FIU bestand bis zwei Jahre nach dem Tod von Joseph Beuys im Jahr 1986. Und dann wurde ich Rektor. Beuys gewann den Prozess gegen Johannes Rau und kriegte dickes Geld. Er durfte wieder in die Akademie, lebenslang sein Atelier halten, durfte aber nicht lehren. Zum 60. Geburtstag habe ich ihn zum Ehrenmitglied der Rinke-Klasse gemacht. Und Australien fand er immer sehr interessant – auch meine australische Sammlung in meinem Haus. Und 81 hatte ich die erste große Zeichnungsausstellung
Nachdem 1972 ein neues Zulassungsverfahren an der Akademie eingeführt wurde, besetzte Beuys mit einigen seiner Studenten das Hochschulsekretariat. Der im Zuge dessen erteilten Entlassung durch den nordrhein-westfälischen Wissenschaftsminister Johannes Rau begegnete Beuys mit einer langjährigen Klage vor dem Bundesarbeitsgericht. In dem ihm gerichtlich auf Lebenszeit zugesprochenen Raum 3 der Düsseldorfer Kunstakademie initiierte Joseph Beuys 1973 gemeinsam mit Willi Bongard, Georg Meistermann und Klaus Staeck die Freie Internationale Universität (FIU), die als freie Hochschule das bestehende Bildungssystem ergänzen sollte. Die FIU bestand bis zwei Jahre nach dem Tod von Joseph Beuys im Jahr 1986. Und dann wurde ich Rektor. Beuys gewann den Prozess gegen Johannes Rau und kriegte dickes Geld. Er durfte wieder in die Akademie, lebenslang sein Atelier halten, durfte aber nicht lehren. Zum 60. Geburtstag habe ich ihn zum Ehrenmitglied der Rinke-Klasse gemacht. Und Australien fand er immer sehr interessant – auch meine australische Sammlung in meinem Haus. Und 81 hatte ich die erste große Zeichnungsausstellung ![]() „Rinke – Hand – Zeichner. Die autonomen Werke von 1957–1980“, Staatsgalerie Stuttgart, 03. Juni – 02. August 1981. in der Staatsgalerie Stuttgart – mit einem dicken Katalog. Da habe ich die Ulrike Gauss
„Rinke – Hand – Zeichner. Die autonomen Werke von 1957–1980“, Staatsgalerie Stuttgart, 03. Juni – 02. August 1981. in der Staatsgalerie Stuttgart – mit einem dicken Katalog. Da habe ich die Ulrike Gauss ![]() Ulrike Gauss (* 1941 Tübingen) ist eine Kunsthistorikerin, die ab 1972 als Wissenschaftlerin an der Staatsgalerie Stuttgart arbeitete. 1990 übernahm sie dort die Leitung der Grafiksammlung, die sie bis zu ihrer Pensionierung 2006 betreute. gefragt: „Wer eröffnet eigentlich die Ausstellung?“ – „Der Grafikspezialist.“ Ich habe gesagt: „Der hat doch gar keine Ahnung von meiner Kunst.“ – „Wer denn sonst?“ Ich sagte: „Am besten irgendjemand, der gut zeichnen kann.“ – „Wer kann denn gut zeichnen?“ – „Der Beuys.“ Da hat sie hinter meinem Rücken Beuys angerufen und gesagt: „Rinke hat eine Ausstellung und hätte gerne, dass jemand, der gut zeichnen kann, die Ausstellung eröffnet.“ Darauf sagte Beuys: „Rinke und ich haben bis auf ein paar Schläuche nichts gemeinsam. Der soll sofort hier hoch kommen.“ Ich habe dann den Zug nach Düsseldorf genommen und Mucha
Ulrike Gauss (* 1941 Tübingen) ist eine Kunsthistorikerin, die ab 1972 als Wissenschaftlerin an der Staatsgalerie Stuttgart arbeitete. 1990 übernahm sie dort die Leitung der Grafiksammlung, die sie bis zu ihrer Pensionierung 2006 betreute. gefragt: „Wer eröffnet eigentlich die Ausstellung?“ – „Der Grafikspezialist.“ Ich habe gesagt: „Der hat doch gar keine Ahnung von meiner Kunst.“ – „Wer denn sonst?“ Ich sagte: „Am besten irgendjemand, der gut zeichnen kann.“ – „Wer kann denn gut zeichnen?“ – „Der Beuys.“ Da hat sie hinter meinem Rücken Beuys angerufen und gesagt: „Rinke hat eine Ausstellung und hätte gerne, dass jemand, der gut zeichnen kann, die Ausstellung eröffnet.“ Darauf sagte Beuys: „Rinke und ich haben bis auf ein paar Schläuche nichts gemeinsam. Der soll sofort hier hoch kommen.“ Ich habe dann den Zug nach Düsseldorf genommen und Mucha ![]() Reinhard Mucha (* 1950 Düsseldorf) ist ein deutscher Künstler aus dem Bereich der Objekt- und Konzeptkunst. Er studierte von 1975 bis 1982 an der Kunstakademie Düsseldorf bei Klaus Rinke und Joseph Beuys. und Drescher
Reinhard Mucha (* 1950 Düsseldorf) ist ein deutscher Künstler aus dem Bereich der Objekt- und Konzeptkunst. Er studierte von 1975 bis 1982 an der Kunstakademie Düsseldorf bei Klaus Rinke und Joseph Beuys. und Drescher ![]() Jürgen Drescher (* 1955 Karlsruhe) ist ein Künstler, der insbesondere für sein bildhauerisches Werk bekannt ist. Von 1979 bis 1984 absolvierte er seine künstlerische Ausbildung in der Klasse von Klaus Rinke an der Kunstakademie Düsseldorf. haben meine Ausstellung weiter aufgehängt. Mit dem Taxi kam ich am Drakeplatz bei Beuys an und wollte sofort anfangen zu reden, da sagte er: „Willst du einen Kaffee?“ Er hat an seinem Herd gestanden und Kaffee gemacht und ich sollte nicht reden, wenn er mit dem Rücken zu mir steht. Die Akademie war damals natürlich auch noch ein großes Thema und er sagte: „Zeichnungsausstellung und danach Akademie.“ Dann kam er mit der Tasse: „Willst du Milch?“ Und er schüttete mir Milch in den Kaffee. „Willst du Zucker? Ein Löffel, zwei Löffel?“ – „Ein Löffel.“ Er rührte auch noch bei mir um. Beuys war so ein ganz lieber Typ. Und dann haben wir zusammen gezeichnet und er sagte immer: „Klaus, wenn du etwas machst, dann ist das was. Ich formuliere das nie aus, bei mir müssen das die anderen machen.“ Da habe gesagt: „Ich will, dass das echt in der Realität, in der Welt steht.“ Er kam dann nach Stuttgart und wir haben ihn vom Flughafen abgeholt. Ich hatte eine Bühne aufgebaut und es waren 3.000 Leute da. Das war Wahnsinn. Die Grünen waren damals noch nicht im Bundestag und er war der Grüne für das Ruhrgebiet.
Jürgen Drescher (* 1955 Karlsruhe) ist ein Künstler, der insbesondere für sein bildhauerisches Werk bekannt ist. Von 1979 bis 1984 absolvierte er seine künstlerische Ausbildung in der Klasse von Klaus Rinke an der Kunstakademie Düsseldorf. haben meine Ausstellung weiter aufgehängt. Mit dem Taxi kam ich am Drakeplatz bei Beuys an und wollte sofort anfangen zu reden, da sagte er: „Willst du einen Kaffee?“ Er hat an seinem Herd gestanden und Kaffee gemacht und ich sollte nicht reden, wenn er mit dem Rücken zu mir steht. Die Akademie war damals natürlich auch noch ein großes Thema und er sagte: „Zeichnungsausstellung und danach Akademie.“ Dann kam er mit der Tasse: „Willst du Milch?“ Und er schüttete mir Milch in den Kaffee. „Willst du Zucker? Ein Löffel, zwei Löffel?“ – „Ein Löffel.“ Er rührte auch noch bei mir um. Beuys war so ein ganz lieber Typ. Und dann haben wir zusammen gezeichnet und er sagte immer: „Klaus, wenn du etwas machst, dann ist das was. Ich formuliere das nie aus, bei mir müssen das die anderen machen.“ Da habe gesagt: „Ich will, dass das echt in der Realität, in der Welt steht.“ Er kam dann nach Stuttgart und wir haben ihn vom Flughafen abgeholt. Ich hatte eine Bühne aufgebaut und es waren 3.000 Leute da. Das war Wahnsinn. Die Grünen waren damals noch nicht im Bundestag und er war der Grüne für das Ruhrgebiet. ![]() Joseph Beuys engagierte sich ab 1977 für die Grüne Liste und nahm im Januar 1980 an dem Gründungsparteitag der Partei Die Grünen teil. Im selben Jahr wurde er deren Spitzenkandidat für die Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen. 1982 erklärte er sich erneut bereit, für die Bundestagswahl zu kandidieren, zog seine Entscheidung jedoch kurze Zeit später zurück. Er blieb bis zu seinem Tod 1986 Parteimitglied. Siehe auch: Hans Peter Riegel, „Beuys. Die Biographie“, Berlin 2013, S. 479 ff.
Joseph Beuys engagierte sich ab 1977 für die Grüne Liste und nahm im Januar 1980 an dem Gründungsparteitag der Partei Die Grünen teil. Im selben Jahr wurde er deren Spitzenkandidat für die Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen. 1982 erklärte er sich erneut bereit, für die Bundestagswahl zu kandidieren, zog seine Entscheidung jedoch kurze Zeit später zurück. Er blieb bis zu seinem Tod 1986 Parteimitglied. Siehe auch: Hans Peter Riegel, „Beuys. Die Biographie“, Berlin 2013, S. 479 ff.
Wir waren zum Schluss echte Freunde und ich wollte ihn wieder in die Akademie holen, da sagte er: „Du wirst es nicht schaffen, deine Kollegen zu überzeugen.“ Ich war richtig angesagt, mich mochten sie alle. Obwohl Richter eifersüchtig war. Als ich Rektor wurde, war er gerade von Kasper König ins Nova Scotia College eingeladen worden und war ganz sauer, als er hörte, dass ich stellvertretender Rektor werden würde. ![]() Klaus Rinke wurde 1978 zum stellvertretenden Direktor der Kunstakademie Düsseldorf ernannt. Im selben Jahr lehrte Gerhard Richter als Gastprofessor am Nova Scotia College of Art and Design in Halifax. Der flippte richtig aus. Aber wenn ich ihn sehe, ist Richter immer wahnsinnig freundlich. Polke war der Ärmste von uns damals. Er kam am Fürstenwall immer zu mir zum Frühstück und klopfte ans Fenster: „Mach mal Kaffee und Brötchen.“ Er hatte schon zwei Kinder, da war er noch Student. Ganz arm. Er war ein „farfelu“, wie die Franzosen sagen. Ein Spinner. Der hat nichts ernst genommen. „Rinke, so nicht. So nicht.“ Ja! Aber so wie er! Er war der Erste, den ich in Düsseldorf kennengelernt habe. Konrad Fischer und ihn. Und Manfred Leve, den Fotografen. Damals war er noch Rechtsanwalt in Düsseldorf.
Klaus Rinke wurde 1978 zum stellvertretenden Direktor der Kunstakademie Düsseldorf ernannt. Im selben Jahr lehrte Gerhard Richter als Gastprofessor am Nova Scotia College of Art and Design in Halifax. Der flippte richtig aus. Aber wenn ich ihn sehe, ist Richter immer wahnsinnig freundlich. Polke war der Ärmste von uns damals. Er kam am Fürstenwall immer zu mir zum Frühstück und klopfte ans Fenster: „Mach mal Kaffee und Brötchen.“ Er hatte schon zwei Kinder, da war er noch Student. Ganz arm. Er war ein „farfelu“, wie die Franzosen sagen. Ein Spinner. Der hat nichts ernst genommen. „Rinke, so nicht. So nicht.“ Ja! Aber so wie er! Er war der Erste, den ich in Düsseldorf kennengelernt habe. Konrad Fischer und ihn. Und Manfred Leve, den Fotografen. Damals war er noch Rechtsanwalt in Düsseldorf.
Wo haben Sie Polke kennengelernt?
Über Manfred Leve. Ihn habe ich über Jean-Pierre Wilhelm kennengelernt. Als ich Frankreich verließ und nach Düsseldorf kam, hat Jean-Pierre Wilhelm mich dem Leve vorgestellt und der brachte Konrad und Dorothee Fischer mit in die Brauerei Füchschen in der Ratinger Straße. Die beiden waren noch sehr jung und frisch verheiratet. Richter und Polke waren ja beide bei Fischer. Er stammte aus einer sehr reichen Familie, das wusste nur keiner. Als ich aus Frankreich zurückkam, suchte ich ein Atelier. Es war Karneval 1964 und ich habe mir am Rosenmontag die „Rheinische Post“ gekauft, um die Immobilienanzeigen zu lesen. Ich stand auf der Königsallee, der Karnevalszug zog vorbei und in der Zeitung las ich: „Altbauwohnung zu vermieten, 175 Mark, Fürstenwall, mitten in der Stadt.“ Aus einer Telefonzelle habe ich angerufen – es war ein Apotheker auf der Luegallee in Oberkassel – und bin sofort mit der Straßenbahn hingefahren. Noch vor dem Einzug während der Renovierungsarbeiten stand ich auf der Leiter, schaute aus dem Fenster und sah, wie aus dem gegenüberliegenden Haus, aus der großen Einfahrt, Alfred Schmela kam. Bei den Nachbarn habe ich mich erkundigt: „Warum kommt der Galerist Schmela da raus?“ – „Dort haben andere Künstler ihre Ateliers.“ Uecker und Richter hatten dort ihre Ateliers und Polke lebte 150 Meter von mir entfernt auf der Kirchfeldstraße. 69 kam dann Palermo. Und ich hatte das Telefon. Das ist ganz wichtig. Uecker und Richter hatten kein Telefon. Die hatten auf dem Dach zwei Räume. Uecker nagelte und Richter malte seine grauen Bilder. 1965 malte er Röhrenbilder und Vorhänge ![]() Zwischen 1964 und 1967 entstanden 32 Gemälde Gerhard Richters mit dem Motiv eines Vorhangs. Die Röhrenbilder entstanden zwischen 1965 und 1968. , das kam von meinen Polyesterelementen. Er hatte mich gefragt: „Klaus, hast du etwas dagegen, wenn ich mal diese Röhren male?“ Ich sagte: „Male sie. Ich bin ja Bildhauer. Du kannst machen, was du willst.“ Oder meine Wasserfotos: „Hast du etwas dagegen, dass ich die Wasserfotos male.“ Und später hat er dann zu mir gesagt: „Nein, Wasser geht nicht. Meine Technik ist zu weich, das Wasser ist zu kristallin.“ Das ist Kunstgeschichte!
Zwischen 1964 und 1967 entstanden 32 Gemälde Gerhard Richters mit dem Motiv eines Vorhangs. Die Röhrenbilder entstanden zwischen 1965 und 1968. , das kam von meinen Polyesterelementen. Er hatte mich gefragt: „Klaus, hast du etwas dagegen, wenn ich mal diese Röhren male?“ Ich sagte: „Male sie. Ich bin ja Bildhauer. Du kannst machen, was du willst.“ Oder meine Wasserfotos: „Hast du etwas dagegen, dass ich die Wasserfotos male.“ Und später hat er dann zu mir gesagt: „Nein, Wasser geht nicht. Meine Technik ist zu weich, das Wasser ist zu kristallin.“ Das ist Kunstgeschichte!
Ich war auch mit den Scheidts in Kettwig befreundet, bei denen über zwei Jahre lang Tom Doyle und Eva Hesse wohnten. ![]() Zwischen 1964 und 1965 lebten Eva Hesse (1936 Hamburg – 1970 New York) und ihr Mann Tom Doyle bei dem Kunstsammler und Textilfabrikanten Friedrich Arnhard Scheidt und dessen Ehefrau Isabel in Kettwig an der Ruhr. Als ich aus Frankreich zurückgekehrt war, fuhr ich mit meinem Motorrad häufig durch Kettwig, und da habe ich Tom Doyle kennengelernt. Eva Hesse war nicht dabei, die traf ich erst später. Sie hat auch Beuys kennengelernt. Wir sind oft zusammen in die Disko gegangen und haben Ausstellungen besucht. Damals machte Eva Hesse gar keine Skulpturen, sondern Zeichnungen und Reliefs. Fast 15 Jahre lang habe ich später das Atelier von Tom Doyle und ihr in Kettwig gehabt. Sie hat meine Polyesterelemente und Günther Uecker mit seinen Nägeln gesehen, und das alles dann zu Eva Hesse verarbeitet. Das ist nicht negativ! Sie hat es auf ihre Art verarbeitet. Sie war ein sehr schönes Mädchen …
Zwischen 1964 und 1965 lebten Eva Hesse (1936 Hamburg – 1970 New York) und ihr Mann Tom Doyle bei dem Kunstsammler und Textilfabrikanten Friedrich Arnhard Scheidt und dessen Ehefrau Isabel in Kettwig an der Ruhr. Als ich aus Frankreich zurückgekehrt war, fuhr ich mit meinem Motorrad häufig durch Kettwig, und da habe ich Tom Doyle kennengelernt. Eva Hesse war nicht dabei, die traf ich erst später. Sie hat auch Beuys kennengelernt. Wir sind oft zusammen in die Disko gegangen und haben Ausstellungen besucht. Damals machte Eva Hesse gar keine Skulpturen, sondern Zeichnungen und Reliefs. Fast 15 Jahre lang habe ich später das Atelier von Tom Doyle und ihr in Kettwig gehabt. Sie hat meine Polyesterelemente und Günther Uecker mit seinen Nägeln gesehen, und das alles dann zu Eva Hesse verarbeitet. Das ist nicht negativ! Sie hat es auf ihre Art verarbeitet. Sie war ein sehr schönes Mädchen …
Die Einflüsse, die Sie auf andere hatten, so wie Sie es beschreiben, gab es das auch in die andere Richtung?
Ich habe versucht mich nicht einfangen zu lassen. Auch von Beuys habe ich mich nicht einfangen lassen.
Hat er probiert, Sie einzufangen?
Nein, im Gegenteil! Er ist zum Beispiel auf der documenta meinem Hinweis gefolgt: „Honig fließt nicht, Du musst destilliertes Wasser einfüllen.“ ![]() Für die „documenta 6“ (1977) entwickelte Joseph Beuys das Werk „Honigpumpe am Arbeitsplatz“. Dafür installierte er in der Rotunde des Fridericianums in Kassel ein vom Erdgeschoss bis zum Dach geführtes Schlauchsystem mit einer mechanischen Pumpe, die den Honig durch das System pumpen sollte. Komplementiert wurde die Arbeit durch einen ebenfalls in das Schlauchsystem integrierten Tagungsraum, in dem die Freie Internationale Universität (FIU) ein 100-tägiges Arbeitskollektiv etablierte. Siehe auch: Veit Loers/Pia Witzmann, „Honigpumpe am Arbeitsplatz“, in: „Joseph Beuys. Documenta. Arbeit”, hg. von dens., Ausst.-Kat. Museum Fridericianum Kassel, Stuttgart 1993, S. 157–167. Das habe ich auch meinen Studenten immer gesagt: „Jeder hat eine eigene Schrift, ein eigenes Innenleben, eine eigene Kindheit, eigene Eltern, eigene Geschwister … jeder wird in einer bestimmten Landschaft in einer bestimmten Kultur groß. Schau mal ganz tief in dein Inneres, da ist deine Kunst. Du musst alles wissen, aber auch alles vergessen.“
Für die „documenta 6“ (1977) entwickelte Joseph Beuys das Werk „Honigpumpe am Arbeitsplatz“. Dafür installierte er in der Rotunde des Fridericianums in Kassel ein vom Erdgeschoss bis zum Dach geführtes Schlauchsystem mit einer mechanischen Pumpe, die den Honig durch das System pumpen sollte. Komplementiert wurde die Arbeit durch einen ebenfalls in das Schlauchsystem integrierten Tagungsraum, in dem die Freie Internationale Universität (FIU) ein 100-tägiges Arbeitskollektiv etablierte. Siehe auch: Veit Loers/Pia Witzmann, „Honigpumpe am Arbeitsplatz“, in: „Joseph Beuys. Documenta. Arbeit”, hg. von dens., Ausst.-Kat. Museum Fridericianum Kassel, Stuttgart 1993, S. 157–167. Das habe ich auch meinen Studenten immer gesagt: „Jeder hat eine eigene Schrift, ein eigenes Innenleben, eine eigene Kindheit, eigene Eltern, eigene Geschwister … jeder wird in einer bestimmten Landschaft in einer bestimmten Kultur groß. Schau mal ganz tief in dein Inneres, da ist deine Kunst. Du musst alles wissen, aber auch alles vergessen.“
Paul Maenz erzählte von den Eigenheiten Konrad Fischers. ![]() Vgl. Paul Maenz. Was war Fischer für ein Typ?
Vgl. Paul Maenz. Was war Fischer für ein Typ?
Paul Maenz machte direkt neben Rolf Ricke ![]() Rolf Ricke (* 1934 Kassel) eröffnete 1963 die Kleine Galerie Kassel. Nach mehrfacher Umbenennung in Galerie Ursula Ricke, und ab 1965 Galerie Ricke, eröffnete er 1968 neue Räumlichkeiten in Köln im Galeriehaus in der Lindenstraße 18–22. Künstler des Galerieprogramms waren Richard Artschwager, Barry Flanagan, Donald Judd, Steven Parrino, David Reed, Richard Serra, Keith Sonnier. Klaus Rinke stellte Anfang der 1970er-Jahre in folgenden Ausstellungen in der Galerie Ricke, Köln aus: „Programm III“, 26. Juni – 01. September 1970; „Klaus Rinke. Wasserprozesse 1969–1970“, 04. Oktober – 02. November 1971; „Zeichnungen“, 15. April – 13. Mai 1972; „Klaus Rinke. Zeichnungen“, 28. April – 24. Mai 1973. eine Galerie auf und fing mit Rückriem an.
Rolf Ricke (* 1934 Kassel) eröffnete 1963 die Kleine Galerie Kassel. Nach mehrfacher Umbenennung in Galerie Ursula Ricke, und ab 1965 Galerie Ricke, eröffnete er 1968 neue Räumlichkeiten in Köln im Galeriehaus in der Lindenstraße 18–22. Künstler des Galerieprogramms waren Richard Artschwager, Barry Flanagan, Donald Judd, Steven Parrino, David Reed, Richard Serra, Keith Sonnier. Klaus Rinke stellte Anfang der 1970er-Jahre in folgenden Ausstellungen in der Galerie Ricke, Köln aus: „Programm III“, 26. Juni – 01. September 1970; „Klaus Rinke. Wasserprozesse 1969–1970“, 04. Oktober – 02. November 1971; „Zeichnungen“, 15. April – 13. Mai 1972; „Klaus Rinke. Zeichnungen“, 28. April – 24. Mai 1973. eine Galerie auf und fing mit Rückriem an. ![]() Paul Maenz eröffnete seine Galerie im Januar 1971 in der Lindenstraße 32 in Köln mit Werken von Hans Haacke. Im Mai desselben Jahres zeigte er eine Einzelausstellung von Ulrich Rückriem. Ich war bei Ricke, vermittelt von Gerry Schum. Das war ein Fehler. Ricke liebte meine Kunst … Richard Serra, Keith Sonnier, Barry Le Va – die waren ja alle bei Ricke. Konrad Fischer hatte mehr diese kalten Typen wie Sol LeWitt
Paul Maenz eröffnete seine Galerie im Januar 1971 in der Lindenstraße 32 in Köln mit Werken von Hans Haacke. Im Mai desselben Jahres zeigte er eine Einzelausstellung von Ulrich Rückriem. Ich war bei Ricke, vermittelt von Gerry Schum. Das war ein Fehler. Ricke liebte meine Kunst … Richard Serra, Keith Sonnier, Barry Le Va – die waren ja alle bei Ricke. Konrad Fischer hatte mehr diese kalten Typen wie Sol LeWitt ![]() Sol LeWitt (1928 Hartford, Connecticut – 2007 New York) war ein US-amerikanischer Künstler aus dem Bereich der Minimal Art. Er gilt als wichtiger Wegbereiter der Konzeptkunst. oder Hanne Darboven
Sol LeWitt (1928 Hartford, Connecticut – 2007 New York) war ein US-amerikanischer Künstler aus dem Bereich der Minimal Art. Er gilt als wichtiger Wegbereiter der Konzeptkunst. oder Hanne Darboven ![]() Hanne Darboven (1941 München – 2009 Rönneburg) war eine deutsche Konzeptkünstlerin. Bekannt wurde sie durch ihre Konstruktionszeichnungen, die auf komplexen Zahlenoperationen und dem rhythmischen Gebrauch von Linien basieren. . Konrad war ein komischer Typ. Er rief mich an: „Klaus, ich muss nach Antwerpen, hast du nicht Lust mit mir mit zu kommen, ich will da nicht alleine hin. Ich muss zur Wide White Space Gallery.“ Wir waren befreundet, aber wir hatten unterschiedliche Charaktere. Ich habe die Kunst immer heroisch gesehen, eine Marktgerechtigkeit gibt es nicht. Da sagte einmal Willi Bongard mit seinem Kunstkompass
Hanne Darboven (1941 München – 2009 Rönneburg) war eine deutsche Konzeptkünstlerin. Bekannt wurde sie durch ihre Konstruktionszeichnungen, die auf komplexen Zahlenoperationen und dem rhythmischen Gebrauch von Linien basieren. . Konrad war ein komischer Typ. Er rief mich an: „Klaus, ich muss nach Antwerpen, hast du nicht Lust mit mir mit zu kommen, ich will da nicht alleine hin. Ich muss zur Wide White Space Gallery.“ Wir waren befreundet, aber wir hatten unterschiedliche Charaktere. Ich habe die Kunst immer heroisch gesehen, eine Marktgerechtigkeit gibt es nicht. Da sagte einmal Willi Bongard mit seinem Kunstkompass ![]() Der Kunstkompass ist eine jährlich erscheinende Rangliste zu den weltweit bedeutendsten zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern. Sie wurde erstmals 1970 durch den Kunst- und Wirtschaftsjournalisten Willi Bongard (1931 Allendorf – 1985 Nymbrecht) für das Magazin „Capital“ erstellt. zu mir: „Sind Sie schon in der Sammlung Hock?“ Bongard nannten wir – das heißt wir Künstler – „Doktor Willi von der Blindenstraße“. Und Hock war ein Bankier, der Minimal Art kaufte. Meine Kunst war viel zu warmherzig für ihn. „Auf den Hock bin ich noch nicht gekommen“, habe ich gesagt. Aber heute kann ich sagen: Ich habe in einer Krefelder Kirche das „Tor zur Ewigkeit“ gemacht.
Der Kunstkompass ist eine jährlich erscheinende Rangliste zu den weltweit bedeutendsten zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern. Sie wurde erstmals 1970 durch den Kunst- und Wirtschaftsjournalisten Willi Bongard (1931 Allendorf – 1985 Nymbrecht) für das Magazin „Capital“ erstellt. zu mir: „Sind Sie schon in der Sammlung Hock?“ Bongard nannten wir – das heißt wir Künstler – „Doktor Willi von der Blindenstraße“. Und Hock war ein Bankier, der Minimal Art kaufte. Meine Kunst war viel zu warmherzig für ihn. „Auf den Hock bin ich noch nicht gekommen“, habe ich gesagt. Aber heute kann ich sagen: Ich habe in einer Krefelder Kirche das „Tor zur Ewigkeit“ gemacht. ![]() 1990 schuf Klaus Rinke für die Pax-Christi-Kirche in Krefeld ein Eingangstor aus schwarzem Granit. Es trägt den Namen „Tor zur Ewigkeit“. Und als Hock sehr schwer krebskrank wurde, ist er jeden Tag in die Kirche gekommen und hat sich vor mein „Tor zur Ewigkeit“ gesetzt. Ist das nicht besser, als in die Sammlung Hock zu kommen? Oder Johannes Cladders
1990 schuf Klaus Rinke für die Pax-Christi-Kirche in Krefeld ein Eingangstor aus schwarzem Granit. Es trägt den Namen „Tor zur Ewigkeit“. Und als Hock sehr schwer krebskrank wurde, ist er jeden Tag in die Kirche gekommen und hat sich vor mein „Tor zur Ewigkeit“ gesetzt. Ist das nicht besser, als in die Sammlung Hock zu kommen? Oder Johannes Cladders ![]() Johannes Cladders (1924 Krefeld – 2009 Krefeld) leitete von 1967 bis 1985 die Städtischen Kunstmuseen (ab 1982 Museum Abteiberg) in Mönchengladbach. Für die „documenta 5“ (1972) arbeitete er im Team von Harald Szeemann. Cladders war 1982 und 1984 kommissarischer Leiter des Deutschen Pavillons der Biennale von Venedig. Er gilt als wichtiger Vermittler des künstlerischen Werks von Joseph Beuys, Robert Filliou und Jannis Kounellis. , bei dem ich nie ausgestellt habe. Er wurde drei Tage im Sarg vor meinem „Tor zur Ewigkeit“ in der Krefelder Pax-Christi-Kirche aufgebahrt. Ist das nicht besser, als im Museum Mönchengladbach zu enden?
Johannes Cladders (1924 Krefeld – 2009 Krefeld) leitete von 1967 bis 1985 die Städtischen Kunstmuseen (ab 1982 Museum Abteiberg) in Mönchengladbach. Für die „documenta 5“ (1972) arbeitete er im Team von Harald Szeemann. Cladders war 1982 und 1984 kommissarischer Leiter des Deutschen Pavillons der Biennale von Venedig. Er gilt als wichtiger Vermittler des künstlerischen Werks von Joseph Beuys, Robert Filliou und Jannis Kounellis. , bei dem ich nie ausgestellt habe. Er wurde drei Tage im Sarg vor meinem „Tor zur Ewigkeit“ in der Krefelder Pax-Christi-Kirche aufgebahrt. Ist das nicht besser, als im Museum Mönchengladbach zu enden?
So! Jetzt sage ich was über Kunst. Muss es auf dem Kunstmarkt sein? Es kann auch ganz woanders sein. Da bin ich wie der Beuys. Ich finde diese Rattenfalle, in die Sie hereingelockt werden, ganz falsch. Die Kunst wird nicht mehr die Kunst sein. Es wird irgendwann eine ganz andere Kunst geben. Das hat sich getrennt. In der Musik ist das ziemlich eindeutig: E-Musik und U-Musik. Das gibt es jetzt auch in der Kunst: Die Ernste Kunst und die Unterhaltungskunst. Die Investmentkunst. Ich bin an dem Wahren interessiert – nicht an der Ware. Alle Worte sind ja so nah beieinander, es ist alles beieinander … man muss nur die Richtung wählen. Ein Künstler hat immer Probleme. Da kann einer 40 Millionen auf seinem Konto haben – Probleme hat er trotzdem. Und der, der fast bankrott ist, hat auch Probleme. Der Künstler wird immer Probleme haben!
Und alle anderen auch!
Es gibt Menschen, die gehen zum Ballermann nach Mallorca.
Auch die haben Probleme!
Wie wichtig waren in der Zeit und in der Szene Drogen?
Ich habe keine Drogen genommen. In San Francisco habe ich drei Monate in einer Künstlerkommune im Mission District gelebt. Das Haus gehörte meinem Galeristen Reese Palley. Der hatte Künstler wie Terry Fox, Howard Fried, Tom Marioni …. Chris Burden war noch Student in Berkeley und kam morgens oft zum Frühstück. Da lagen schon morgens auf dem Frühstücktisch ein Haufen Marihuana und ein Haufen Schnee. Ich habe es nicht genommen, war aber trotzdem akzeptiert.
Waren die Drogen in Düsseldorf an der Akademie nicht auch sehr präsent?
Sicher gab es Alkohol – so eine Art von Männersolidarität im Glas! Meine Droge war mein klarer Kopf … Wenn ich die Welt klarsehen konnte – und das ist heute noch meine Droge. Ich muss nicht benebelt sein. Ich war auch Hippie. Alle rauchten und ich habe in meinem Leben nur zweimal gezogen. Mein Vater war nach dem Krieg so ein Kettenraucher, das war nicht mehr auszuhalten.
Als VW den ersten Automatik-VW rausbrachte, saßen die Artdirectors und Texter bei mir im Atelier und redeten darüber. Dabei ist dieser Spruch entstanden: „Lassen Sie Ihre Hand am Steuer.“ Mit offenem Verdeck fuhr der Hippie den VW, neben ihm ein Minirock-Mädchen und dann stand da: „Lassen Sie Ihre Hand am Steuer.“ Weil man mit der Automatik eine Hand frei hatte, um dem Mädchen unter den Rock zu greifen. Dieser Slogan ist in meinem Atelier erfunden worden – und die waren natürlich voll drauf. Aus Solidarität habe ich irgendwann mal bei denen zu Hause geraucht und am nächsten Morgen wusste ich nicht mehr, wer ich war. Die hatten da so einen Afghanen reingetan, mit Opium oder irgendetwas. Ich habe mich totgelacht. Ich kannte meinen Namen nicht mehr. Da habe ich gesagt: „Verdammt, das mache ich nicht mehr, das ist ja nicht auszuhalten.“ Aber die Zeit war schon gut! Die Arte-povera-Gruppe ![]() Die Arte povera war eine italienische Kunstbewegung, die sich durch die künstlerische Verwendung „armer“ und alltäglicher Materialien auszeichnete. Erstmals öffentliche Verwendung fand die Bezeichnung im Rahmen der Ausstellung „Arte povera e IM spazio“, die im September 1967 von Germano Celant in Genua organisiert wurde und Arbeiten von Alighiero Boetti, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Pino Pascali, Giulio Paolini und Emilio Prini umfasste. Weitere zentrale Vertreter der Bewegung waren Giovanni Anselmo, Mario Merz, Michelangelo Pistoletto und Salvo. Siehe auch: „Che Fare? Arte povera. Die historischen Jahre“, hg. Friedemann Malsch, Ausst.-Kat. Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz, Heidelberg 2010. , Mario Merz, Anselmo, Tommaso Trini, diese berühmten Kritiker … wir kannten uns alle und waren wie Freunde. Ich habe in Rom vorgeführt und in Mailand ausgestellt – Kounellis und alle römischen Künstler sind gekommen. Wir waren alle verschwippt und verschwägert. Es gab keine Nationalitäten … das war dieser Hippieismus. Heute ist das wieder auseinanderdividiert. Jetzt kommen die und kaufen für ganz viel Geld meine Sachen. Nicht die Deutschen, sondern die Italiener! Die Franzosen, die Lateiner mögen mich, weil ich Deutsch bin. Das ist diese Nibelungengeschichte, der Siegfried-Komplex. Als die gesagt haben: „Sie sind Siegfried“, stimmte das. „Der muss kaputt gemacht werden. Was bildet der sich ein? So schön ist er doch gar nicht.“ Ich bilde mir gar nichts ein, sondern lebe nur weltweit mein Leben. Da wundern sie sich über den Rinke, „der schon 30 Jahre in Kalifornien am Ozean lebt“. In der Akademie sage ich: „Ich gehe jetzt mal zu meiner größten Skulptur.“ Denn wenn du etwas erkennst und begreifst, dann gehört es dir. Dann bist du es. Das ist wichtig.
Die Arte povera war eine italienische Kunstbewegung, die sich durch die künstlerische Verwendung „armer“ und alltäglicher Materialien auszeichnete. Erstmals öffentliche Verwendung fand die Bezeichnung im Rahmen der Ausstellung „Arte povera e IM spazio“, die im September 1967 von Germano Celant in Genua organisiert wurde und Arbeiten von Alighiero Boetti, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Pino Pascali, Giulio Paolini und Emilio Prini umfasste. Weitere zentrale Vertreter der Bewegung waren Giovanni Anselmo, Mario Merz, Michelangelo Pistoletto und Salvo. Siehe auch: „Che Fare? Arte povera. Die historischen Jahre“, hg. Friedemann Malsch, Ausst.-Kat. Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz, Heidelberg 2010. , Mario Merz, Anselmo, Tommaso Trini, diese berühmten Kritiker … wir kannten uns alle und waren wie Freunde. Ich habe in Rom vorgeführt und in Mailand ausgestellt – Kounellis und alle römischen Künstler sind gekommen. Wir waren alle verschwippt und verschwägert. Es gab keine Nationalitäten … das war dieser Hippieismus. Heute ist das wieder auseinanderdividiert. Jetzt kommen die und kaufen für ganz viel Geld meine Sachen. Nicht die Deutschen, sondern die Italiener! Die Franzosen, die Lateiner mögen mich, weil ich Deutsch bin. Das ist diese Nibelungengeschichte, der Siegfried-Komplex. Als die gesagt haben: „Sie sind Siegfried“, stimmte das. „Der muss kaputt gemacht werden. Was bildet der sich ein? So schön ist er doch gar nicht.“ Ich bilde mir gar nichts ein, sondern lebe nur weltweit mein Leben. Da wundern sie sich über den Rinke, „der schon 30 Jahre in Kalifornien am Ozean lebt“. In der Akademie sage ich: „Ich gehe jetzt mal zu meiner größten Skulptur.“ Denn wenn du etwas erkennst und begreifst, dann gehört es dir. Dann bist du es. Das ist wichtig.