Frankfurt am Main, 11. November 2015
Franziska Leuthäußer: Ich war letzte Woche bei Paul Maenz ![]() Paul Maenz (* 1939 Gelsenkirchen) ist ein deutscher Galerist und Kunstsammler. Er studierte ab 1959 bei Max Burchartz an der Folkwangschule für Gestaltung in Essen und war ab 1964 als Art Director in der Werbeagentur Young & Rubicam (Y&R) in Frankfurt am Main und New York tätig. 1971 eröffnete er eine Galerie in Köln. Sein Programm umfasste wichtige Positionen der Minimal Art und Konzeptkunst, darunter Hans Haacke und Joseph Kosuth, sowie Künstler der Mülheimer Freiheit und der Transavanguardia. In den 1980er-Jahren zeigte Maenz als erste Galerie in Deutschland Arbeiten von Keith Haring (1984) und Jeff Koons (1987). in Berlin. Da haben wir uns auch über das Gespräch unterhalten, das Sie mit ihm im Museum für Moderne Kunst hier in Frankfurt geführt haben.
Paul Maenz (* 1939 Gelsenkirchen) ist ein deutscher Galerist und Kunstsammler. Er studierte ab 1959 bei Max Burchartz an der Folkwangschule für Gestaltung in Essen und war ab 1964 als Art Director in der Werbeagentur Young & Rubicam (Y&R) in Frankfurt am Main und New York tätig. 1971 eröffnete er eine Galerie in Köln. Sein Programm umfasste wichtige Positionen der Minimal Art und Konzeptkunst, darunter Hans Haacke und Joseph Kosuth, sowie Künstler der Mülheimer Freiheit und der Transavanguardia. In den 1980er-Jahren zeigte Maenz als erste Galerie in Deutschland Arbeiten von Keith Haring (1984) und Jeff Koons (1987). in Berlin. Da haben wir uns auch über das Gespräch unterhalten, das Sie mit ihm im Museum für Moderne Kunst hier in Frankfurt geführt haben. ![]() „MMK Talk zum Werk von Peter Roehr – Thomas Bayrle trifft auf Paul Maenz“, Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main, 23. September 2015. Sie hatten offenbar wenig Kontakt damals? Obwohl Sie mit Peter Roehr
„MMK Talk zum Werk von Peter Roehr – Thomas Bayrle trifft auf Paul Maenz“, Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main, 23. September 2015. Sie hatten offenbar wenig Kontakt damals? Obwohl Sie mit Peter Roehr ![]() Peter Roehr (1944 Lauenburg, Pommern, heute Polen – 1968 Frankfurt am Main) war ein Künstler, der sich in seinem Werk vorwiegend mit dem Prinzip der Serialität beschäftigte. Von 1962 bis 1965 studierte er an der Werkkunstschule in Wiesbaden. Trotz seines frühen Tods hinterließ Roehr ein künstlerisches Werk mit mehr als 600 Arbeiten. befreundet waren und auch bei der Ausstellung „Serielle Formationen“
Peter Roehr (1944 Lauenburg, Pommern, heute Polen – 1968 Frankfurt am Main) war ein Künstler, der sich in seinem Werk vorwiegend mit dem Prinzip der Serialität beschäftigte. Von 1962 bis 1965 studierte er an der Werkkunstschule in Wiesbaden. Trotz seines frühen Tods hinterließ Roehr ein künstlerisches Werk mit mehr als 600 Arbeiten. befreundet waren und auch bei der Ausstellung „Serielle Formationen“ ![]() „Serielle Formationen“, Studiogalerie im Studentenhaus der Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 22. Mai – 30. Juni 1967. An der von Paul Maenz und Peter Roehr organisierten Ausstellung nahmen unter anderen Carl Andre, Thomas Bayrle, Hans Haacke, Frank Stella und Andy Warhol teil. , die Maenz und Roehr veranstaltet haben, dabei waren.
„Serielle Formationen“, Studiogalerie im Studentenhaus der Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 22. Mai – 30. Juni 1967. An der von Paul Maenz und Peter Roehr organisierten Ausstellung nahmen unter anderen Carl Andre, Thomas Bayrle, Hans Haacke, Frank Stella und Andy Warhol teil. , die Maenz und Roehr veranstaltet haben, dabei waren.
Thomas Bayrle: Ja, das stimmt. Paul Maenz kannten wir kaum und dementsprechend hatten wir wenig miteinander zu tun. Der Kontakt mit Peter Roehr beschränkte sich wesentlich auf die Zeit zwischen seinen beiden Ausstellungen bei Adam Seide ![]() Adam Seide (1929 Hannover – 2004 Limburg an der Lahn) war ein deutscher Galerist, Schriftsteller und Kunstkritiker. Ab 1958 betrieb er die Galerie Seide im alten Rathaus in Hannover-Linden. Nach seinem Umzug nach Frankfurt am Main 1962 führte er dort im Röderbergweg 64 im 2. Stock des ehemaligen Gumpertz’schen Siechenhauses einen Salon. Das Programm umfasste unter anderem Ausstellungen mit Werken von Thomas Bayrle, Otto Muehl und Gerhard Wittner. Peter Roehr stellte in der „Abendausstellung II“ 1965 und in der Ausstellung „Roehr bei Seide“ 1967 in der Galerie aus. – seiner ersten, 1965, und seiner letzten, 1967. Nach meiner Ausbildung in einer Weberei,
Adam Seide (1929 Hannover – 2004 Limburg an der Lahn) war ein deutscher Galerist, Schriftsteller und Kunstkritiker. Ab 1958 betrieb er die Galerie Seide im alten Rathaus in Hannover-Linden. Nach seinem Umzug nach Frankfurt am Main 1962 führte er dort im Röderbergweg 64 im 2. Stock des ehemaligen Gumpertz’schen Siechenhauses einen Salon. Das Programm umfasste unter anderem Ausstellungen mit Werken von Thomas Bayrle, Otto Muehl und Gerhard Wittner. Peter Roehr stellte in der „Abendausstellung II“ 1965 und in der Ausstellung „Roehr bei Seide“ 1967 in der Galerie aus. – seiner ersten, 1965, und seiner letzten, 1967. Nach meiner Ausbildung in einer Weberei, ![]() Thomas Bayrle absolvierte von 1956 bis 1958 in Göppingen eine Ausbildung zum Weber und Färber. einem Gebrauchsgrafikstudium in Offenbach und einer Zeit des „Büchermachens“ bei der Gulliver-Presse
Thomas Bayrle absolvierte von 1956 bis 1958 in Göppingen eine Ausbildung zum Weber und Färber. einem Gebrauchsgrafikstudium in Offenbach und einer Zeit des „Büchermachens“ bei der Gulliver-Presse ![]() Zusammen mit Bernhard Jäger (* 1935 München) gründete Thomas Bayrle 1961 den Verlag Gulliver-Presse, in dem bis 1966 Künstler- und Grafikbücher erschienen. Siehe auch: Bernd Slutzky (Hg.), „Bayrle & Jäger. Die Gulliver-Presse 1962–1966“, Frankfurt am Main 1997. in Bad Homburg war die rücksichtslose Präsentation seiner Arbeit 1965 bei Adam Seide für mich wie ein heilsamer Schock. Ich traf Peter Roehr genau zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschiedener in der Kunst bewegen wollte. Auf einigen langen Autofahrten kamen wir intensiv ins Gespräch. Peter Roehr redete wenig, aber absolut überzeugend. Beispielsweise riet er mir, der ich der Weberei eher den Rücken kehren wollte, ich sollte das gerade nicht tun. Er erkannte, wie wichtig diese Zeit für mich war. Vor allem die Erfahrung der Produktion mit den programmierten gestanzten Lochkarten interessierte ihn.
Zusammen mit Bernhard Jäger (* 1935 München) gründete Thomas Bayrle 1961 den Verlag Gulliver-Presse, in dem bis 1966 Künstler- und Grafikbücher erschienen. Siehe auch: Bernd Slutzky (Hg.), „Bayrle & Jäger. Die Gulliver-Presse 1962–1966“, Frankfurt am Main 1997. in Bad Homburg war die rücksichtslose Präsentation seiner Arbeit 1965 bei Adam Seide für mich wie ein heilsamer Schock. Ich traf Peter Roehr genau zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschiedener in der Kunst bewegen wollte. Auf einigen langen Autofahrten kamen wir intensiv ins Gespräch. Peter Roehr redete wenig, aber absolut überzeugend. Beispielsweise riet er mir, der ich der Weberei eher den Rücken kehren wollte, ich sollte das gerade nicht tun. Er erkannte, wie wichtig diese Zeit für mich war. Vor allem die Erfahrung der Produktion mit den programmierten gestanzten Lochkarten interessierte ihn.
Paul Maenz war in der Werbebranche tätig und auch Sie hatten damals Verbindungen zur Werbung …
Frankfurt war wirklich wie eine harte amerikanische Werbefiliale. Schon 1960 gab es hier 50 Werbeagenturen. Damals war es üblich, dass viele Werbeleute nach Amerika gingen. So auch Paul Maenz. Von New York aus konnte er Peter Roehr mit Wunschmaterial aus Anzeigen und später mit Werbefilmkopien versorgen.
Sie begannen 1958 Ihre Ausbildung an der Hochschule in Offenbach. Wie würden Sie die Stimmung in der Zeit dort beziehungsweise in Frankfurt am Main beschreiben?
Frankfurt hatte auf dem Gebiet der bildenden Kunst kaum etwas zu melden. Es gab die Quadriga ![]() Quadriga bezeichnet die Künstler K.O. Götz, Otto Greis, Heinz Kreutz und Bernard Schultze, deren erste gemeinsame Ausstellung mit dem Titel „Neuexpressionisten“ in der Frankfurter Zimmergalerie Franck 1952 als Geburtsstunde des deutschen Informel gilt. Der Begriff „Quadriga“ stammt von dem Literaten René Hinds, er verwendete diesen in seiner Eröffnungsrede zur Ausstellung. Vgl. Carolin Weber, „Quadriga – Die Auflösung des klassischen Formprinzips“, in: „Quadriga. Götz – Greis – Kreutz – Schultze“, Ausst.-Kat. Galerie Maulberger, München, München 2010, S. 8–33, hier S. 9 f. , mit Kreutz, Götz und Schultze, die sich aber bald nach Köln absetzte. Zentrum für uns war der Kreis um Hermann Goepfert
Quadriga bezeichnet die Künstler K.O. Götz, Otto Greis, Heinz Kreutz und Bernard Schultze, deren erste gemeinsame Ausstellung mit dem Titel „Neuexpressionisten“ in der Frankfurter Zimmergalerie Franck 1952 als Geburtsstunde des deutschen Informel gilt. Der Begriff „Quadriga“ stammt von dem Literaten René Hinds, er verwendete diesen in seiner Eröffnungsrede zur Ausstellung. Vgl. Carolin Weber, „Quadriga – Die Auflösung des klassischen Formprinzips“, in: „Quadriga. Götz – Greis – Kreutz – Schultze“, Ausst.-Kat. Galerie Maulberger, München, München 2010, S. 8–33, hier S. 9 f. , mit Kreutz, Götz und Schultze, die sich aber bald nach Köln absetzte. Zentrum für uns war der Kreis um Hermann Goepfert ![]() Hermann Goepfert (1926 Bad Nauheim – 1983 Antwerpen) war ein deutscher Künstler, der eng mit der ZERO-Bewegung verbunden war. Bekannt ist er insbesondere für seine monochromen „Weißbilder“, die ab 1960 entstanden. Enge Freundschaften verbanden ihn mit Piero Manzoni, Lucio Fontana und Jef Verheyen. Goepfert nahm an wichtigen Präsentationen mit Künstlern aus dem ZERO-Umfeld teil, dazu gehören die Ausstellung „Nul“ (1962) im Amsterdamer Stedelijk Museum sowie die „documenta 3“ (1964) in Kassel. , Bazon Brock
Hermann Goepfert (1926 Bad Nauheim – 1983 Antwerpen) war ein deutscher Künstler, der eng mit der ZERO-Bewegung verbunden war. Bekannt ist er insbesondere für seine monochromen „Weißbilder“, die ab 1960 entstanden. Enge Freundschaften verbanden ihn mit Piero Manzoni, Lucio Fontana und Jef Verheyen. Goepfert nahm an wichtigen Präsentationen mit Künstlern aus dem ZERO-Umfeld teil, dazu gehören die Ausstellung „Nul“ (1962) im Amsterdamer Stedelijk Museum sowie die „documenta 3“ (1964) in Kassel. , Bazon Brock ![]() Bazon Brock (eigtl. Jürgen Johannes Hermann Brock; * 1936 Stolp, Pommern, heute Polen) ist ein Künstler, Kunsttheoretiker und Philosoph. Ab 1957 studierte er Germanistik, Politikwissenschaften und Philosophie an den Universitäten in Zürich, Hamburg und Frankfurt am Main. Parallel absolvierte er eine Dramaturgie-Ausbildung am Landestheater Darmstadt bei Claus Bremer und Gustav Rudolf Sellner. Ab 1959 nahm Brock regelmäßig an Fluxus-Aktionen teil, unter anderem am „Festival der Neuen Kunst“ (1964) in Aachen sowie am „24-Stunden-Happening“ (1965) in der Galerie Parnass in Wuppertal. 1968 initiierte Brock für die „documenta 4“ in Kassel die erste Besucherschule, die er bis 1992 begleitend zu den documenta-Ausstellungen fortführte. Als Professor lehrte er unter anderem an der Hochschule für bildende Künste Hamburg (1965–1976) und der Bergischen Universität Wuppertal (1981–2001). 2011 gründete Brock in Berlin-Kreuzberg die „Denkerei“ mit dem „Amt für Arbeit an unlösbaren Problemen und Maßnahmen der hohen Hand“. und Rochus Kowallek
Bazon Brock (eigtl. Jürgen Johannes Hermann Brock; * 1936 Stolp, Pommern, heute Polen) ist ein Künstler, Kunsttheoretiker und Philosoph. Ab 1957 studierte er Germanistik, Politikwissenschaften und Philosophie an den Universitäten in Zürich, Hamburg und Frankfurt am Main. Parallel absolvierte er eine Dramaturgie-Ausbildung am Landestheater Darmstadt bei Claus Bremer und Gustav Rudolf Sellner. Ab 1959 nahm Brock regelmäßig an Fluxus-Aktionen teil, unter anderem am „Festival der Neuen Kunst“ (1964) in Aachen sowie am „24-Stunden-Happening“ (1965) in der Galerie Parnass in Wuppertal. 1968 initiierte Brock für die „documenta 4“ in Kassel die erste Besucherschule, die er bis 1992 begleitend zu den documenta-Ausstellungen fortführte. Als Professor lehrte er unter anderem an der Hochschule für bildende Künste Hamburg (1965–1976) und der Bergischen Universität Wuppertal (1981–2001). 2011 gründete Brock in Berlin-Kreuzberg die „Denkerei“ mit dem „Amt für Arbeit an unlösbaren Problemen und Maßnahmen der hohen Hand“. und Rochus Kowallek ![]() Rochus Kowallek (* 1926 Berlin) betrieb in Frankfurt am Main von 1961 bis 1962 die Galerie dato, im Anschluss bis 1964 die Galerie d. Als künstlerischer Direktor leitete er ab 1967 die neu eröffnete Galerie Ursula Lichter. Nach dem Austritt von Ursula Lichter 1972 führte Kowallek die Galerie bis zu ihrer Schließung 1973 eigenständig weiter. mit der Galerie dato.
Rochus Kowallek (* 1926 Berlin) betrieb in Frankfurt am Main von 1961 bis 1962 die Galerie dato, im Anschluss bis 1964 die Galerie d. Als künstlerischer Direktor leitete er ab 1967 die neu eröffnete Galerie Ursula Lichter. Nach dem Austritt von Ursula Lichter 1972 führte Kowallek die Galerie bis zu ihrer Schließung 1973 eigenständig weiter. mit der Galerie dato.
Von der geistig-literarischen Situation her war Frankfurt natürlich eine wichtige Stadt. Vor allem durch die Universität, die Frankfurter Schule, die durch die bekannten Figuren Adorno, Horkheimer et cetera – zurückgekehrt aus Amerika – möglich wurde. Das machte zusammen mit guten Tageszeitungen ein kritisches Klima aus, aber auch durch die ehemaligen jüdischen Institutionen, wie das Institut für Sozialforschung, das Sigmund-Freud-Institut und so weiter. Mit Fritz Bauer ![]() Fritz Bauer (1903 Stuttgart – 1968 Frankfurt am Main) war ein Jurist, der von 1956 bis zu seinem Tod 1968 das Amt des hessischen Generalstaatsanwalts innehatte. Auf seine Initiative hin wurde am 20. Dezember 1963 der erste Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main eröffnet, in dem sich 22 ehemalige SS-Männer des Konzentrationslagers Auschwitz für ihre Beteiligung am Holocaust vor Gericht zu verantworten hatten. Die 1965 verkündeten Urteile umfassten unter anderem 16 lebenslängliche Haftstrafen. Das Verfahren gilt als wegbereitend für zahlreiche weitere Prozesse in den folgenden Jahren. Siehe auch: Ralph Dobrawa, „Der Auschwitz-Prozess. Ein Lehrstück deutscher Geschichte“, Berlin 2013. wurden in Frankfurt dann die ersten Versuche gemacht, die NS-Vergangenheit aufzuarbeiten, was in keiner anderen deutschen Stadt der Fall war. Hier habe ich die eindrucksvollste Ausstellung über Auschwitz
Fritz Bauer (1903 Stuttgart – 1968 Frankfurt am Main) war ein Jurist, der von 1956 bis zu seinem Tod 1968 das Amt des hessischen Generalstaatsanwalts innehatte. Auf seine Initiative hin wurde am 20. Dezember 1963 der erste Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main eröffnet, in dem sich 22 ehemalige SS-Männer des Konzentrationslagers Auschwitz für ihre Beteiligung am Holocaust vor Gericht zu verantworten hatten. Die 1965 verkündeten Urteile umfassten unter anderem 16 lebenslängliche Haftstrafen. Das Verfahren gilt als wegbereitend für zahlreiche weitere Prozesse in den folgenden Jahren. Siehe auch: Ralph Dobrawa, „Der Auschwitz-Prozess. Ein Lehrstück deutscher Geschichte“, Berlin 2013. wurden in Frankfurt dann die ersten Versuche gemacht, die NS-Vergangenheit aufzuarbeiten, was in keiner anderen deutschen Stadt der Fall war. Hier habe ich die eindrucksvollste Ausstellung über Auschwitz ![]() „Auschwitz – Bilder und Dokumente“, Paulskirche, Frankfurt am Main, November/Dezember 1964. gesehen. Das war in der Paulskirche. Ich war damals einerseits stark politisch und gesellschaftlich interessiert und gleichzeitig mit Werbung, der krassen Gegenwelt, beschäftigt. Wirklich interessiert haben mich die enormen Widersprüche, die hier mit 40.000 Amerikanern, heimgekehrten Juden, Werbeagenturen, Verlagen, geldgierigen Hausbesitzern und Studenten aufeinandergeprallt sind: AFN
„Auschwitz – Bilder und Dokumente“, Paulskirche, Frankfurt am Main, November/Dezember 1964. gesehen. Das war in der Paulskirche. Ich war damals einerseits stark politisch und gesellschaftlich interessiert und gleichzeitig mit Werbung, der krassen Gegenwelt, beschäftigt. Wirklich interessiert haben mich die enormen Widersprüche, die hier mit 40.000 Amerikanern, heimgekehrten Juden, Werbeagenturen, Verlagen, geldgierigen Hausbesitzern und Studenten aufeinandergeprallt sind: AFN ![]() Das American Forces Network (AFN) war ein Verbund aus Radiosendern, die ab 1943 vom US-Militär in Europa etabliert wurden. Zwischen 1945 und 2017 diente der Sender AFN Frankfurt als Zentrale des Netzwerks. Die Sendung „Hillbilly Guesthouse“ gehörte zu den beliebtesten Produktionen des AFN. und „Hillbilly Guesthouse“, gemischt mit Heinz Schenk und Apfelwein. Frankfurt war billig und teuer, ehrlich und verlogen, alles oder nichts … Völlig verständlich, dass hier keiner herwollte. Durch Bazon Brock kannten meine Frau und ich damals einige Leute, die uns angeregt oder aufgeregt haben. Das war eine ganz andere Linie, die ziemlich frei war. Meine Frau hat tagsüber hart gearbeitet, um halb sieben ging sie aus dem Haus – zum Postscheckamt, wo sie mit 17 bereits Ausbildungsleiterin für die Angestellten war. Das heißt, wir haben ein richtiges Arbeitsleben geführt, und da war es wichtig ein paar Leute zu kennen, mit denen man auf künstlerischem Gebiet zu tun hatte. Dazu gehörte der Kreis um Hermann Goepfert und etwas später auch Adam Seide.
Das American Forces Network (AFN) war ein Verbund aus Radiosendern, die ab 1943 vom US-Militär in Europa etabliert wurden. Zwischen 1945 und 2017 diente der Sender AFN Frankfurt als Zentrale des Netzwerks. Die Sendung „Hillbilly Guesthouse“ gehörte zu den beliebtesten Produktionen des AFN. und „Hillbilly Guesthouse“, gemischt mit Heinz Schenk und Apfelwein. Frankfurt war billig und teuer, ehrlich und verlogen, alles oder nichts … Völlig verständlich, dass hier keiner herwollte. Durch Bazon Brock kannten meine Frau und ich damals einige Leute, die uns angeregt oder aufgeregt haben. Das war eine ganz andere Linie, die ziemlich frei war. Meine Frau hat tagsüber hart gearbeitet, um halb sieben ging sie aus dem Haus – zum Postscheckamt, wo sie mit 17 bereits Ausbildungsleiterin für die Angestellten war. Das heißt, wir haben ein richtiges Arbeitsleben geführt, und da war es wichtig ein paar Leute zu kennen, mit denen man auf künstlerischem Gebiet zu tun hatte. Dazu gehörte der Kreis um Hermann Goepfert und etwas später auch Adam Seide.
Woher kannten Sie Goepfert?
Goepfert war eine Persönlichkeit. Wir kannten ihn etwa seit 1960, auch durch Bazon Brock und Rochus Kowallek.
Woher kannten Sie Bazon Brock?
Wir haben uns 1960 kennengelernt. 1963 habe ich mit ihm bereits ein Buch ![]() Bazon Brock, „A. das geht ran“, Bad Homburg 1963. Mit einer Lithografie von Thomas Bayrle. in der Gulliver-Presse gemacht. Wir waren viel mit ihm und Rochus Kowallek zusammen. Kowallek war einer der wenigen, die immer aktuell informiert waren. Seine Galerie dato war ein fantastischer Ort. Durch ganz wenige Leute hat man sich hervorragend informieren können. Auf diesem Pflaster aus „Apfelwein und Geldgier“ waren vielleicht 2 Prozent bildende Kunst – gegenüber 98 Prozent literarisch-geistiger Interessen. In anderen Städten war es nahezu umgekehrt. In Köln liefen noch jahrelang nach ihrer Verurteilung in Frankreich gesuchte Nazis frei herum. Das muss man sich mal vorstellen: mitten in der Hochburg der freien Künste. Ich war auch in Hinblick auf meine künstlerische Arbeit interessiert, die Vergangenheit zu verstehen, was das ganze Dritte Reich an Desastern ausgelöst hatte.
Bazon Brock, „A. das geht ran“, Bad Homburg 1963. Mit einer Lithografie von Thomas Bayrle. in der Gulliver-Presse gemacht. Wir waren viel mit ihm und Rochus Kowallek zusammen. Kowallek war einer der wenigen, die immer aktuell informiert waren. Seine Galerie dato war ein fantastischer Ort. Durch ganz wenige Leute hat man sich hervorragend informieren können. Auf diesem Pflaster aus „Apfelwein und Geldgier“ waren vielleicht 2 Prozent bildende Kunst – gegenüber 98 Prozent literarisch-geistiger Interessen. In anderen Städten war es nahezu umgekehrt. In Köln liefen noch jahrelang nach ihrer Verurteilung in Frankreich gesuchte Nazis frei herum. Das muss man sich mal vorstellen: mitten in der Hochburg der freien Künste. Ich war auch in Hinblick auf meine künstlerische Arbeit interessiert, die Vergangenheit zu verstehen, was das ganze Dritte Reich an Desastern ausgelöst hatte.
Wie kamen Sie zur Kunst?
Das war nicht sofort fokussiert. Ich wollte etwas machen, aber ich bin nicht direkt auf irgendeine Form zugegangen. Zusammen mit Bernhard Jäger haben wir drei Jahre lang den Verlag, die Gulliver-Presse, als offene Plattform für Kunst und Literatur betrieben. Wir hatten Kontakt zu Konkreter Poesie, hauptsächlich nach Wien. Wir haben – über fast ein Jahr – mit Ernst Jandl ![]() Ernst Jandl (1925 Wien – 2000 Wien) war ein Schriftsteller und Dichter. Bekannt ist er insbesondere für seine Lautgedichte sowie seine Arbeiten im Bereich der visuellen Poesie. Zu seinen Veröffentlichungen gehören der Gedichtband „Laut und Luise“ (1966) und die Sprechoper „Aus der Fremde“ (1979), in der Gulliver-Presse „Hosi Anna“, Bad Homburg 1966. ein großes Werk gemacht, Bücher, Druckmappen et cetera, auch mit H. C. Artmann
Ernst Jandl (1925 Wien – 2000 Wien) war ein Schriftsteller und Dichter. Bekannt ist er insbesondere für seine Lautgedichte sowie seine Arbeiten im Bereich der visuellen Poesie. Zu seinen Veröffentlichungen gehören der Gedichtband „Laut und Luise“ (1966) und die Sprechoper „Aus der Fremde“ (1979), in der Gulliver-Presse „Hosi Anna“, Bad Homburg 1966. ein großes Werk gemacht, Bücher, Druckmappen et cetera, auch mit H. C. Artmann ![]() Hans Carl Artmann (1921 Wien – 2000 Wien). 1964 veröffentlichte die Gulliver-Presse „Artmann Brief. Graphik und Buch im Couvert“. und Franz Mon
Hans Carl Artmann (1921 Wien – 2000 Wien). 1964 veröffentlichte die Gulliver-Presse „Artmann Brief. Graphik und Buch im Couvert“. und Franz Mon ![]() Franz Mon (* 1926 Frankfurt am Main) ist ein deutscher Dichter aus dem Bereich der Konkreten Poesie. In seinen Arbeiten beschäftigt er sich mit dem Verhältnis von Wort und Fläche. Mon lehrte ab Mitte der 1990er-Jahre bis 2000 Visuelle Poesie an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. In der Gulliver-Presse erschien sein Buch „weiß wie weiß“, Bad Homburg 1964. . Das war sehr wichtig. Der Verlag war einige Jahre das Hauptinteresse. Große Kunstwerke herzustellen hatte ich überhaupt nicht im Sinn. Das Erste, was ich dann neben Büchern gemacht habe, waren diese Maschinen
Franz Mon (* 1926 Frankfurt am Main) ist ein deutscher Dichter aus dem Bereich der Konkreten Poesie. In seinen Arbeiten beschäftigt er sich mit dem Verhältnis von Wort und Fläche. Mon lehrte ab Mitte der 1990er-Jahre bis 2000 Visuelle Poesie an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. In der Gulliver-Presse erschien sein Buch „weiß wie weiß“, Bad Homburg 1964. . Das war sehr wichtig. Der Verlag war einige Jahre das Hauptinteresse. Große Kunstwerke herzustellen hatte ich überhaupt nicht im Sinn. Das Erste, was ich dann neben Büchern gemacht habe, waren diese Maschinen ![]() Ab 1964 realisierte Thomas Bayrle eine Reihe von bemalten Holzobjekten mit motorisierter Mechanik. Dazu gehören unter anderem „Mao und die Gymnasiasten“ (1964), „Super Colgate“ (1965) und „Nürnberger Orgie“ (1966).
Ab 1964 realisierte Thomas Bayrle eine Reihe von bemalten Holzobjekten mit motorisierter Mechanik. Dazu gehören unter anderem „Mao und die Gymnasiasten“ (1964), „Super Colgate“ (1965) und „Nürnberger Orgie“ (1966). 

Wieso unter dem Einfluss von Brock und Goepfert? Was hatten die mit Maschinen zu tun?
Die beiden hatten schon frühzeitig Kontakt zu Jean Tinguely ![]() Jean Tinguely (1925 Freiburg im Üechtland – 1991 Bern) war ein Schweizer Maler und Bildhauer und arbeitete im Umfeld der Nouveaux Réalistes. Bekannt ist er für seine großen mechanischen Skulpturen. Er zählt zu den Hauptvertretern der kinetischen Kunst. . Seine Arbeiten sahen wir erstmals in der Sammlung Hund. Das war für mich der Anfang, über motorisierte, selbst gebaute Gebilde nachzudenken. Für mich war die bewegte Stereotypie der Tinguely-Maschinen irgendwie wie Werbung, die direkt auf die plump-komische Situation im Adenauer-Deutschland passte. Ich wollte in der Umsetzung meiner Themen nicht amerikanisch sein, kein Andy-Warhol-Pop (so sehr mich das fasziniert hat), sondern deutsche Inhalte wählen, neben den Maos
Jean Tinguely (1925 Freiburg im Üechtland – 1991 Bern) war ein Schweizer Maler und Bildhauer und arbeitete im Umfeld der Nouveaux Réalistes. Bekannt ist er für seine großen mechanischen Skulpturen. Er zählt zu den Hauptvertretern der kinetischen Kunst. . Seine Arbeiten sahen wir erstmals in der Sammlung Hund. Das war für mich der Anfang, über motorisierte, selbst gebaute Gebilde nachzudenken. Für mich war die bewegte Stereotypie der Tinguely-Maschinen irgendwie wie Werbung, die direkt auf die plump-komische Situation im Adenauer-Deutschland passte. Ich wollte in der Umsetzung meiner Themen nicht amerikanisch sein, kein Andy-Warhol-Pop (so sehr mich das fasziniert hat), sondern deutsche Inhalte wählen, neben den Maos ![]() Ab 1964 taucht das Porträt von Mao Tse-tung als Motiv in verschiedenen Arbeiten Thomas Bayrles auf. Zu den bekanntesten Beispielen gehören „Mao und die Gymnasiasten“ (1964) und „Mao“ (1966).
Ab 1964 taucht das Porträt von Mao Tse-tung als Motiv in verschiedenen Arbeiten Thomas Bayrles auf. Zu den bekanntesten Beispielen gehören „Mao und die Gymnasiasten“ (1964) und „Mao“ (1966). 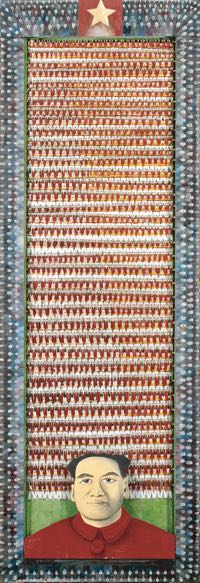 bewusst die Wirklichkeit deutscher Umgebung auswählen. Es war für mich damals ein echter Kommentar, aber ein lustiger, der auf die ganze Spießigkeit, die sich vom Dritten Reich auf die Waschmittelindustrie umgelegt hatte, abzielte. Diese Wirklichkeit erschien mir damals zugespitzt, dass es in unserem Land eigentlich keine „Verarbeitung“ gab, sondern nur ein Hebel umgelegt wurde, vom politischen Terror auf einen Waschzwang-Terror. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern. Aber zu 99 Prozent war es so. Dagegen gab es 1, 2 Prozent, die sehr kritisch waren. Und die waren hier in Frankfurt stark vertreten.
bewusst die Wirklichkeit deutscher Umgebung auswählen. Es war für mich damals ein echter Kommentar, aber ein lustiger, der auf die ganze Spießigkeit, die sich vom Dritten Reich auf die Waschmittelindustrie umgelegt hatte, abzielte. Diese Wirklichkeit erschien mir damals zugespitzt, dass es in unserem Land eigentlich keine „Verarbeitung“ gab, sondern nur ein Hebel umgelegt wurde, vom politischen Terror auf einen Waschzwang-Terror. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern. Aber zu 99 Prozent war es so. Dagegen gab es 1, 2 Prozent, die sehr kritisch waren. Und die waren hier in Frankfurt stark vertreten.
Die Kunst, die damals bei Kowallek gezeigt wurde, also Hermann Goepfert, Piero Manzoni, Lucio Fontana oder die ZERO-Künstler, schien mit Ihrer Arbeit wenig gemein zu haben. Wie würden Sie den Kontakt mit anderen Künstlern zu der Zeit beschreiben?
Wir waren oft bei Goepferts zu Hause. Der hatte ein offenes Haus und hat hier in Frankfurt den anderen Künstlern wirklich geholfen. Er war ein sehr freier Geist, der auch für die ganze Stimmung hier viel gemacht hat. Durch ihn haben wir zum Beispiel Lucio Fontana kennengelernt. Es gab aber nicht nur ZERO und die Neuen Realisten ![]() Nouveau Réalisme war eine Kunstströmung, die Ende der 1950er-Jahre in Frankreich entstand. In Abkehr vom Informel und anderen gestisch-abstrakten Ausdrucksweisen forderten die Künstler zunehmend die Hinwendung zur alltäglichen Lebenswelt. Konkret wurde dieser Anspruch zum Beispiel in der Verwendung von Alltagsgegenständen als Material in der Kunst sichtbar. Am 27. Oktober 1960 wurde in der Pariser Wohnung Yves Kleins das gleichnamige Manifest von Arman, François Dufrêne, Raymond Hains, Yves Klein, Martial Raysse, Pierre Restany, Daniel Spoerri, Jean Tinguely und Jacques de la Villeglé unterzeichnet. Siehe auch: „Nouveau Réalisme. Revolution des Alltäglichen“, hg. von Ulrich Krempel, Ausst.-Kat. Sprengel Museum Hannover, Ostfildern 2007. , sondern natürlich gelegentlich auch Pop und alles, was dazwischen lag. Ich habe bewusst eine ziemlich naive Position bezogen, die sozusagen auf meine gesellschaftliche Realität gepasst hat. Die Sachen sind einfach unreflektiert entstanden. Ganz spontan. Ich wusste nicht einmal, ob das Kunst sein kann. Wenn ich auf die Situation der Kunst zugearbeitet hätte, hätte ich mich präziser an die Regeln halten müssen, die in Düsseldorf und Köln gemacht wurden.
Nouveau Réalisme war eine Kunstströmung, die Ende der 1950er-Jahre in Frankreich entstand. In Abkehr vom Informel und anderen gestisch-abstrakten Ausdrucksweisen forderten die Künstler zunehmend die Hinwendung zur alltäglichen Lebenswelt. Konkret wurde dieser Anspruch zum Beispiel in der Verwendung von Alltagsgegenständen als Material in der Kunst sichtbar. Am 27. Oktober 1960 wurde in der Pariser Wohnung Yves Kleins das gleichnamige Manifest von Arman, François Dufrêne, Raymond Hains, Yves Klein, Martial Raysse, Pierre Restany, Daniel Spoerri, Jean Tinguely und Jacques de la Villeglé unterzeichnet. Siehe auch: „Nouveau Réalisme. Revolution des Alltäglichen“, hg. von Ulrich Krempel, Ausst.-Kat. Sprengel Museum Hannover, Ostfildern 2007. , sondern natürlich gelegentlich auch Pop und alles, was dazwischen lag. Ich habe bewusst eine ziemlich naive Position bezogen, die sozusagen auf meine gesellschaftliche Realität gepasst hat. Die Sachen sind einfach unreflektiert entstanden. Ganz spontan. Ich wusste nicht einmal, ob das Kunst sein kann. Wenn ich auf die Situation der Kunst zugearbeitet hätte, hätte ich mich präziser an die Regeln halten müssen, die in Düsseldorf und Köln gemacht wurden.
Wie haben Sie von diesen Regeln hier in Frankfurt erfahren?
Wir sind manchmal ins Rheinland gefahren, das ging nicht anders. Das waren unter anderem die Fahrten mit Peter Roehr. Nach Düsseldorf, nach Köln und weiter ins Ruhrgebiet. Wir haben Künstler kennengelernt und Ausstellungen angeschaut. Konrad Lueg, Polke, Richter und Beuys in der Galerie von Alfred Schmela. Durch Roehr mehr Minimal – und dann die Amerikaner bei Konrad Fischer ![]() Konrad Fischer (1939 Düsseldorf – 1996 Düsseldorf) war ein deutscher Künstler und Galerist. In seiner 1967 in der Düsseldorfer Altstadt eröffneten Galerie stellte er frühe Vertreter der Minimal Art und der Konzeptkunst vor, darunter Carl Andre, Hanne Darboven, Bruce Nauman und Lawrence Weiner. Als „Konrad Lueg“ war Fischer vor Gründung seiner Galerie als Künstler tätig und stellte mehrfach unter anderen mit Gerhard Richter aus. Die bekannteste künstlerische Aktion, an der Lueg beteiligt war, fand im Oktober 1963 im Düsseldorfer Möbelhaus Berges unter dem Titel „Leben mit Pop. Eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus“ statt. .
Konrad Fischer (1939 Düsseldorf – 1996 Düsseldorf) war ein deutscher Künstler und Galerist. In seiner 1967 in der Düsseldorfer Altstadt eröffneten Galerie stellte er frühe Vertreter der Minimal Art und der Konzeptkunst vor, darunter Carl Andre, Hanne Darboven, Bruce Nauman und Lawrence Weiner. Als „Konrad Lueg“ war Fischer vor Gründung seiner Galerie als Künstler tätig und stellte mehrfach unter anderen mit Gerhard Richter aus. Die bekannteste künstlerische Aktion, an der Lueg beteiligt war, fand im Oktober 1963 im Düsseldorfer Möbelhaus Berges unter dem Titel „Leben mit Pop. Eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus“ statt. .
Um informiert zu sein?
Im Gegensatz zu Roehr, der viel besser orientiert war als ich, habe ich mich einfach gefragt: „Was machst du? Hält das Zeug, was du machst, stand?“ Ich wollte nicht naiv sein oder irgendwie was Eigenes basteln, wollte aber auch nicht genau reinpassen. Sondern tolle Arbeiten mit dem verbinden, was ich in der Massengesellschaft, in der ich „schwamm“, richtig fand, auch politisch.
Haben Sie das mit Peter Roehr diskutiert?
Ja, das konnte man sehr genau mit ihm diskutieren. Er war kompromisslos. Ein viel schärferer und kritischerer Geist, als ich mich empfand. Ein wirklicher Intellektueller. Ich hatte mehr Glück als Verstand und er hatte mehr Verstand als Glück. Ich habe sehr viel durch seine geistige Realität und durch sein Denken gelernt. Meiner Empfindung nach war er im Konzept präziser als die Leute in Düsseldorf. Er hat eben nicht nur in ein Muster reinpassen wollen, sondern er hat tatsächlich eine gesellschaftliche Realität als Gesamtheit – vielleicht verkürzt – gesehen. Wenn er länger gelebt hätte, hätte er sicher noch eine ganz andere Entwicklung gehabt.
Können Sie sich an einzelne Ausstellungen erinnern, die Sie damals besonders beeindruckt haben?
Wir haben wichtige Ausstellungen bei Konrad Fischer gesehen, zum Beispiel Carl Andre ![]() Carl Andre (* 1935 Quincy, Massachusetts) ist ein Künstler, der zu den zentralen Vertretern der Minimal Art gehört. Bekanntheit erlangte er vor allem für seine Anordnungen von flachen, quadratischen Platten aus Stahl, Kupfer oder Blei. Ab 1967 zeigte er seine Werke regelmäßig im Programm der Konrad Fischer Galerie. und Richard Long
Carl Andre (* 1935 Quincy, Massachusetts) ist ein Künstler, der zu den zentralen Vertretern der Minimal Art gehört. Bekanntheit erlangte er vor allem für seine Anordnungen von flachen, quadratischen Platten aus Stahl, Kupfer oder Blei. Ab 1967 zeigte er seine Werke regelmäßig im Programm der Konrad Fischer Galerie. und Richard Long ![]() Richard Long (* 1945 Bristol) ist ein britischer Künstler, der zu den Mitbegründern der Land-Art zählt. Ab 1968 zeigte er regelmäßig Arbeiten in der Konrad Fischer Galerie in Düsseldorf, darunter in folgenden Ausstellungen: „Sculpture“, 21. September – 18. Oktober 1968; „Richard J. Long“, 05. Juli – 01. August 1969; „Eine Skulptur von Richard Long“, 11. Mai – 09. Juni 1970. . Das war nichts Gebasteltes, sondern das war ein neuer Zustand – ausgehend vom Einzelnen in der Massenproduktion, ein gesellschaftlicher Zustand der Produktion – in wunderbare Form gebracht! Das erinnerte mich an die Radikalität in der Fabrik. Sensibel – klar –, überzeugend brutal. Das war schon mit das Wichtigste. Und es gab ja auch nicht zig Kunstzeitschriften wie heute. Hinfahren war wirklich das Beste!
Richard Long (* 1945 Bristol) ist ein britischer Künstler, der zu den Mitbegründern der Land-Art zählt. Ab 1968 zeigte er regelmäßig Arbeiten in der Konrad Fischer Galerie in Düsseldorf, darunter in folgenden Ausstellungen: „Sculpture“, 21. September – 18. Oktober 1968; „Richard J. Long“, 05. Juli – 01. August 1969; „Eine Skulptur von Richard Long“, 11. Mai – 09. Juni 1970. . Das war nichts Gebasteltes, sondern das war ein neuer Zustand – ausgehend vom Einzelnen in der Massenproduktion, ein gesellschaftlicher Zustand der Produktion – in wunderbare Form gebracht! Das erinnerte mich an die Radikalität in der Fabrik. Sensibel – klar –, überzeugend brutal. Das war schon mit das Wichtigste. Und es gab ja auch nicht zig Kunstzeitschriften wie heute. Hinfahren war wirklich das Beste!
Wenn wir bei dem Beispiel Richard Long bleiben: Waren Sie dieser Kunst gegenüber offen oder haben Sie sich über das Programm in Düsseldorf auch etwas echauffiert?
Nein, nein, nicht im Geringsten. Wir waren eigentlich total offen. Wir fanden das sofort gut. Der Begriff von Kunst ist mit einem Schlag gesprengt worden. Da war nicht die geringste Kritik – man dachte lediglich darüber nach, wie man seine eigenen Produktionsmittel verändern musste.
Auch nicht an der Institutionalisierung der Kunst?
Es waren ja nur vier, fünf Galerien, mehr waren es nicht. Man konnte nicht von Institutionalisierung reden, auch die Kunstvereine, das kam alles erst viel später. Man musste nicht wie heute 80.000 Sachen angucken und sich das dann zusammensetzen, sondern da waren ein paar fantastische Persönlichkeiten, wie Konrad Lueg zum Beispiel, der erst unter diesem Namen ein guter Künstler war und dann umgeschaltet hat und dann als Konrad Fischer eben die Galerie machte. Auch bei Gerhard Richter war mir mit dem ersten Bild klar, dass das stimmte, das war drei Klassen besser als alles, was es drum herum gab. Dieser Umgang mit Malerei und Fotografie. Da ist wirklich eine Tür aufgestoßen worden. Das waren Düsseldorf und Köln, aber vor allem Düsseldorf.
Sie sagten eben, dort wurden die Regeln gemacht. Was genau meinen Sie damit?
Es gab zwei, drei fantastische Händler und es gab sehr gute Künstler und die entsprechenden Sammler. Das ganze System, von dem man an keinem anderen Ort sprechen konnte, war vielleicht mit 20 Leuten abgedeckt. Wir haben sofort gesehen: Das ist es. Obwohl der intellektuelle Roehr scharfe Kritik daran übte. Der war nicht nur begeistert. Außer ihm habe ich niemanden getroffen, der diese ideale Situation so stark und konsequent reflektiert hat. Er hat sämtliche Bewegungen und Möglichkeiten sofort erkannt.
Und Sie wollten zu den 20 Leuten, von denen Sie eben sprachen, nicht dazugehören?
Doch, doch. Aber das war natürlich nicht erreichbar. In Frankfurt, der Stadt, die auf diesem Gebiet nichts zu melden hatte, empfand man das Auftreten der Düsseldorfer ZERO-Gruppe zu Goepferts Zeiten als starkes Mauern. Als Konkurrenzkampf. Bis auf den Lichtblick der Ausstellung „Europäische Avantgarde“ ![]() „Europäische Avantgarde“, Galerie d in der Schwanenhalle, Frankfurt am Main, 09. Juli – 11. August 1963 (verlängert bis 25. August). Beteiligte Künstler waren unter anderen: Getulio Alviani, Bernard Aubertin, Hermann Bartels, Kilian Breier, Pol Bury, Enrico Castellani, Piero Dorazio, Lucio Fontana, Hermann Goepfert, Gotthard Graubner, Oskar Holweck, Yves Klein, Harry Kramer, Walter Leblanc, Adolf Luther, Heinz Mack, Piero Manzoni, Christian Megert, Bruno Munari, Herbert Oehm, Henk Peeters, Otto Piene, Uli Pohl, Arnulf Rainer, Dieter Roth, Hans Salentin, Jan J. Schoonhoven, Jesús Rafael Soto, Paul Talman, Jean Tinguely, Günther Uecker, Paul Van Hoeydonck, Jef Verheyen und Herman de Vries. , die Zimmergalerie
„Europäische Avantgarde“, Galerie d in der Schwanenhalle, Frankfurt am Main, 09. Juli – 11. August 1963 (verlängert bis 25. August). Beteiligte Künstler waren unter anderen: Getulio Alviani, Bernard Aubertin, Hermann Bartels, Kilian Breier, Pol Bury, Enrico Castellani, Piero Dorazio, Lucio Fontana, Hermann Goepfert, Gotthard Graubner, Oskar Holweck, Yves Klein, Harry Kramer, Walter Leblanc, Adolf Luther, Heinz Mack, Piero Manzoni, Christian Megert, Bruno Munari, Herbert Oehm, Henk Peeters, Otto Piene, Uli Pohl, Arnulf Rainer, Dieter Roth, Hans Salentin, Jan J. Schoonhoven, Jesús Rafael Soto, Paul Talman, Jean Tinguely, Günther Uecker, Paul Van Hoeydonck, Jef Verheyen und Herman de Vries. , die Zimmergalerie ![]() Die Zimmergalerie Franck wurde von 1949 bis 1961 von dem Versicherungsangestellten Klaus Franck (1906 Berlin – 1997 Bad Soden) in der Böhmerstraße 7 und ab 1954 in der Vilbeler Straße 29 in Frankfurt am Main geführt. Sein Programm umfasste vor allem frühe Positionen des deutschen Informel, darunter K.O. Götz, Otto Greis, Heinz Kreutz und Bernard Schultze. und die Galerie Cordier
Die Zimmergalerie Franck wurde von 1949 bis 1961 von dem Versicherungsangestellten Klaus Franck (1906 Berlin – 1997 Bad Soden) in der Böhmerstraße 7 und ab 1954 in der Vilbeler Straße 29 in Frankfurt am Main geführt. Sein Programm umfasste vor allem frühe Positionen des deutschen Informel, darunter K.O. Götz, Otto Greis, Heinz Kreutz und Bernard Schultze. und die Galerie Cordier ![]() Ab Oktober 1958 leitete der Historiker und Kunstsammler Daniel Cordier (* 1920 Bordeaux) eine Galerie in der Taunusanlage 21 in Frankfurt am Main. Bis 1963 zeigte er dort unter anderem Arbeiten von Jean Dubuffet, Öyvind Fahlström, K.O. Götz und Bernard Schultze. war Frankfurt aussichtslos abgehängt.
Ab Oktober 1958 leitete der Historiker und Kunstsammler Daniel Cordier (* 1920 Bordeaux) eine Galerie in der Taunusanlage 21 in Frankfurt am Main. Bis 1963 zeigte er dort unter anderem Arbeiten von Jean Dubuffet, Öyvind Fahlström, K.O. Götz und Bernard Schultze. war Frankfurt aussichtslos abgehängt.
Was war der Grund dafür?
Nach dem Krieg hatten wir hier, was die bildende Kunst anging, kaum internationalen Umgang. In Amerika und vor allen Dingen in Italien gab es eine lange Tradition, auch eine lange jüdische Tradition. Diese Tradition ist durch die Nazizeit unterbrochen worden. Und obwohl sie alles kaputtgemacht haben, waren die Deutschen in Deutschland, wie so oft, plötzlich wieder die Besten. Das ist ein unangenehmer Zug. Wobei ich sagen muss, ich erfuhr in Düsseldorf keine Anerkennung, dafür aber in Mailand. Dort habe ich Arturo Schwarz ![]() Arturo Schwarz (* 1924 Alexandria‚ Ägypten) ist ein italienischer Kunsthistoriker, Autor und Galerist, der von 1961 bis 1975 eine Galerie in Mailand führte. Mit der Präsentation künstlerischer Arbeiten von unter anderen Jean Arp, André Breton, Marcel Duchamp, Man Ray und Daniel Spoerri gilt seine Galerie als einer der wichtigsten Vermittlungsorte für die Strömungen des Dadaismus und des Surrealismus nach dem Zweiten Weltkrieg. oder Guido Le Noci
Arturo Schwarz (* 1924 Alexandria‚ Ägypten) ist ein italienischer Kunsthistoriker, Autor und Galerist, der von 1961 bis 1975 eine Galerie in Mailand führte. Mit der Präsentation künstlerischer Arbeiten von unter anderen Jean Arp, André Breton, Marcel Duchamp, Man Ray und Daniel Spoerri gilt seine Galerie als einer der wichtigsten Vermittlungsorte für die Strömungen des Dadaismus und des Surrealismus nach dem Zweiten Weltkrieg. oder Guido Le Noci ![]() Guido Le Noci (1904 Martina Franca – 1983 Mailand) war ein italienischer Unternehmer und Galerist, der von 1954 bis 1983 die Galleria Apollinaire in Mailand führte. Sein Programm umfasste vor allem Positionen des Nouveau Réalisme, darunter die Künstler Arman, Christo, Lucio Fontana, Yves Klein und Jean Tinguely. getroffen. Ich war 1966 dort, niemand kannte mich, aber Lucio Fontana sagte seinem Galeristen: „Stell den Jungen doch mal aus.“ Und Le Noci hat es tatsächlich gemacht.
Guido Le Noci (1904 Martina Franca – 1983 Mailand) war ein italienischer Unternehmer und Galerist, der von 1954 bis 1983 die Galleria Apollinaire in Mailand führte. Sein Programm umfasste vor allem Positionen des Nouveau Réalisme, darunter die Künstler Arman, Christo, Lucio Fontana, Yves Klein und Jean Tinguely. getroffen. Ich war 1966 dort, niemand kannte mich, aber Lucio Fontana sagte seinem Galeristen: „Stell den Jungen doch mal aus.“ Und Le Noci hat es tatsächlich gemacht. ![]() „Produzione Bayrle“, Galleria Apollinaire, Mailand, April 1968. Das wäre in Düsseldorf niemals möglich gewesen. Das sage ich nach einer lustigen Erfahrung mit Schmela, den ich 1966 zusammen mit dem Museumsdirektor aus Wiesbaden, Clemens Weiler, besucht habe. Er schien sehr interessiert und versprach einen Besuch in Frankfurt, der aber nie kam – ich selbst hätte meine Abneigung anders ausgedrückt.
„Produzione Bayrle“, Galleria Apollinaire, Mailand, April 1968. Das wäre in Düsseldorf niemals möglich gewesen. Das sage ich nach einer lustigen Erfahrung mit Schmela, den ich 1966 zusammen mit dem Museumsdirektor aus Wiesbaden, Clemens Weiler, besucht habe. Er schien sehr interessiert und versprach einen Besuch in Frankfurt, der aber nie kam – ich selbst hätte meine Abneigung anders ausgedrückt.
Sie haben Ihre Werke damals einfach ins Auto gepackt und sind nach Mailand gefahren?
Erst kam Guido Le Noci nach Frankfurt. Das war im Frühjahr 1967. Ein denkwürdiger Besuch. Ich habe überlegt: „Was machst du mit dem?“ Damals gab es keine Galerie in Frankfurt, die es wert war, einem Galeristen gezeigt zu werden. Eigentlich gab es überhaupt nichts zu zeigen. Auf der Straße gab es tolle Zeitungen, Buchhandlungen, eine sehr unruhige Universität und die Buchmesse, die aber erst im Herbst stattfand. Und dann gab es 40.000 Amerikaner, die überall in der Stadt anwesend waren. Ansonsten war diese Stadt eine richtig primitive Klitsche. Was habe ich also gemacht? Ich habe einfach das gezeigt, was da war, und bin mit ihm zu Meier-Gustl ![]() Das Meier-Gustl war ein bayerisches Bierhaus im Rotlichtviertel am Frankfurter Hauptbahnhof, das während der 1960er-Jahre zu einem beliebten Tanzlokal avancierte. gegangen. Da gab es Amis in Lederhosen und Tischtelefone. Das fand er große Klasse. So etwas hatte er noch nicht gesehen, so etwas Bizarres, Fertiges. Ich habe gar nicht erst versucht, ihm hier irgendeine Hochkultur vorzumachen.
Das Meier-Gustl war ein bayerisches Bierhaus im Rotlichtviertel am Frankfurter Hauptbahnhof, das während der 1960er-Jahre zu einem beliebten Tanzlokal avancierte. gegangen. Da gab es Amis in Lederhosen und Tischtelefone. Das fand er große Klasse. So etwas hatte er noch nicht gesehen, so etwas Bizarres, Fertiges. Ich habe gar nicht erst versucht, ihm hier irgendeine Hochkultur vorzumachen.
Obwohl Frankfurt so eine Wüste war, fand 1963 die legendäre Avantgarde-Ausstellung in der Schwanenhalle des Römer statt.
Die haben die Römerhallen genommen, weil das der einzige, repräsentative Ort in der Stadt war. Die Organisation war die Leistung von Goepfert und Rochus Kowallek. Hermann Goepfert hatte die Verbindungen nach Mailand, zu den Künstlern Manzoni und so weiter, und er wusste ganz genau, wie er sie einsetzen konnte. Es war bei ihm vielleicht auch so ein bisschen wie bei mir: Es hatte gar keinen Sinn, es mit Düsseldorf zu versuchen. Da wäre null für die Region hier herausgekommen. Deswegen hat er sich vor allem nach Belgien und nach Italien orientiert.
Warum gab es den Wunsch, so eine Ausstellung in Frankfurt zu veranstalten? Wer hat sich das angesehen?
Vom Ausland her gesehen war Frankfurt ja keine schlechte Stadt. Es hatte die einzige Börse, die gezählt hat, und man kannte die Börsen-Problematik aus einem frühen Fellini-Film. Das war eine ganz fantastische Ausstellung in der Schwanenhalle – bescheiden und klug inszeniert und wirklich international. Das war in Frankfurt ein ganz neues Format. Viele der Künstler waren zur Eröffnung hier. Damals lernten Helke, meine Frau, und ich dort eine Reihe von ihnen persönlich kennen.
Was hat Sie in der Ausstellung besonders beeindruckt?
Mich hat eigentlich die gesamte Sicht begeistert. Leute wie Bernard Aubertin ![]() Bernard Aubertin (1934 Fontenay-aux-Roses – 2015 Reutlingen) war ein französischer Künstler, der zum erweiterten Kreis der ZERO-Bewegung gehörte. oder die Nouveaux Réalistes aus Frankreich kannte ich vorher nicht. Die Italiener waren etwas besser bekannt. Mit Mimmo Rotella
Bernard Aubertin (1934 Fontenay-aux-Roses – 2015 Reutlingen) war ein französischer Künstler, der zum erweiterten Kreis der ZERO-Bewegung gehörte. oder die Nouveaux Réalistes aus Frankreich kannte ich vorher nicht. Die Italiener waren etwas besser bekannt. Mit Mimmo Rotella ![]() Mimmo Rotella (eigtl. Domenico Rotella; 1918 Catanzaro, Italien – 2006 Mailand) war ein Künstler, der insbesondere für seine Décollagen recycelter Plakate bekannt ist. Er wird dem Umfeld der Affichisten und der Nouveaux Réalistes zugerechnet. und solchen Leuten wurde dann auch klar, wer da was, wann, wo erfunden hatte. Das war zehn Jahre vor Wolf Vostell
Mimmo Rotella (eigtl. Domenico Rotella; 1918 Catanzaro, Italien – 2006 Mailand) war ein Künstler, der insbesondere für seine Décollagen recycelter Plakate bekannt ist. Er wird dem Umfeld der Affichisten und der Nouveaux Réalistes zugerechnet. und solchen Leuten wurde dann auch klar, wer da was, wann, wo erfunden hatte. Das war zehn Jahre vor Wolf Vostell ![]() Wolf Vostell (1932 Leverkusen – 1998 Berlin) war ein deutscher Künstler, der vor allem mit seinen Installationen und Happenings bekannt wurde. Ab 1953 absolvierte er zunächst eine Lehre als Fotolithograf in Wuppertal, wo er 1954 sein erstes Happening „Skelett“ veranstaltete, bevor er 1955 sein Studium der freien Kunst an der École nationale supérieure des beaux-arts in Paris begann. 1961 zeigte die Galerie Lauhus in Köln Vostells erste Einzelausstellung in Deutschland, 1963 folgte in der Smolin Gallery in New York die erste Einzelausstellung in den USA und 1964 war er erstmals mit einer Aktion in der neu gegründeten Galerie René Block vertreten. , da ist nichts dran zu rütteln. Was damals sehr deutlich wurde, war, dass speziell bei den Italienern durch den Krieg nichts unterbrochen worden war.
Wolf Vostell (1932 Leverkusen – 1998 Berlin) war ein deutscher Künstler, der vor allem mit seinen Installationen und Happenings bekannt wurde. Ab 1953 absolvierte er zunächst eine Lehre als Fotolithograf in Wuppertal, wo er 1954 sein erstes Happening „Skelett“ veranstaltete, bevor er 1955 sein Studium der freien Kunst an der École nationale supérieure des beaux-arts in Paris begann. 1961 zeigte die Galerie Lauhus in Köln Vostells erste Einzelausstellung in Deutschland, 1963 folgte in der Smolin Gallery in New York die erste Einzelausstellung in den USA und 1964 war er erstmals mit einer Aktion in der neu gegründeten Galerie René Block vertreten. , da ist nichts dran zu rütteln. Was damals sehr deutlich wurde, war, dass speziell bei den Italienern durch den Krieg nichts unterbrochen worden war.
Kamen zu dieser Ausstellung auch die Düsseldorfer nach Frankfurt?
Ja, sie waren ja selbst daran beteiligt. Die waren alle da.
Es gab diese Avantgarde-Ausstellung, es gab die „Seriellen Formationen“ und auch noch einiges andere. Warum gab es in Frankfurt dennoch so wenig Entwicklung in dieser Zeit? Auch die Städelschule blieb lange außen vor. Woran lag das?
Hier war lange Zeit ein wirklich mieser Geist zu Hause, das muss man mal sagen. Ernst Holzinger ![]() Ernst Holzinger (1901 Ulm – 1972 Zaun, Schweiz) war ein deutscher Kunsthistoriker und von 1938 bis 1972 Direktor des Städel Museums in Frankfurt am Main. hat das ganze Dritte Reich gut überstanden, als wäre nichts gewesen. Sowohl fürs Museum als auch für die Schule war es eine konservativ bis reaktionäre politische Linie, vor allem auch mit Hermann Josef Abs
Ernst Holzinger (1901 Ulm – 1972 Zaun, Schweiz) war ein deutscher Kunsthistoriker und von 1938 bis 1972 Direktor des Städel Museums in Frankfurt am Main. hat das ganze Dritte Reich gut überstanden, als wäre nichts gewesen. Sowohl fürs Museum als auch für die Schule war es eine konservativ bis reaktionäre politische Linie, vor allem auch mit Hermann Josef Abs ![]() Hermann Josef Abs (1901 Bonn – 1994 Bad Soden) war ein deutscher Bankier. Während des Zweiten Weltkriegs war er Mitglied im Aufsichtsrat der I.G. Farbenindustrie AG, die im großen Umfang von der Arbeitskraft der im Vernichtungslager Auschwitz inhaftierten KZ-Häftlinge profitierte. Von 1957 bis 1967 war Abs Vorstandssprecher der Deutschen Bank AG. Siehe auch: Eberhard Czichon, „Die Bank und die Macht. Hermann Josef Abs, die Deutsche Bank und die Politik“, Köln 1995. im Hintergrund. Diese Linie wurde hier länger durchgehalten als beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Das Städel mit seiner hervorragenden alten Sammlung mauerte gegen alles, was neu war. Von einem Anschluss an die 20er-Jahre, in denen Georg Swarzenski
Hermann Josef Abs (1901 Bonn – 1994 Bad Soden) war ein deutscher Bankier. Während des Zweiten Weltkriegs war er Mitglied im Aufsichtsrat der I.G. Farbenindustrie AG, die im großen Umfang von der Arbeitskraft der im Vernichtungslager Auschwitz inhaftierten KZ-Häftlinge profitierte. Von 1957 bis 1967 war Abs Vorstandssprecher der Deutschen Bank AG. Siehe auch: Eberhard Czichon, „Die Bank und die Macht. Hermann Josef Abs, die Deutsche Bank und die Politik“, Köln 1995. im Hintergrund. Diese Linie wurde hier länger durchgehalten als beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Das Städel mit seiner hervorragenden alten Sammlung mauerte gegen alles, was neu war. Von einem Anschluss an die 20er-Jahre, in denen Georg Swarzenski ![]() Georg Swarzenski (1876 Dresden – 1957 Brookline, Massachusetts) war ab 1906 Direktor des Städelschen Kunstinstituts in Frankfurt am Main, wo er die Sammlung vor allem durch zeitgenössische Werke der Impressionisten, der Expressionisten sowie der abstrakten Malerei ergänzte. Nachdem er 1933 durch die Nationalsozialisten aller städtischen Ämter enthoben worden war, emigrierte er 1938 in die USA. Während der 1950er-Jahre war er als Kurator am Museum of Fine Arts in Boston tätig. im Museum und Fritz Wichert
Georg Swarzenski (1876 Dresden – 1957 Brookline, Massachusetts) war ab 1906 Direktor des Städelschen Kunstinstituts in Frankfurt am Main, wo er die Sammlung vor allem durch zeitgenössische Werke der Impressionisten, der Expressionisten sowie der abstrakten Malerei ergänzte. Nachdem er 1933 durch die Nationalsozialisten aller städtischen Ämter enthoben worden war, emigrierte er 1938 in die USA. Während der 1950er-Jahre war er als Kurator am Museum of Fine Arts in Boston tätig. im Museum und Fritz Wichert ![]() Fritz Wichert (1878 Mainz – 1957 Kampen) leitete von 1909 bis 1922 die Kunsthalle Mannheim und war ab 1923 Direktor der Städelschule in Frankfurt am Main. Dort konnte er unter anderem Willi Baumeister und Max Beckmann als Professoren für die Schule gewinnen. 1933 wurde Wichert von den Nationalsozialisten offiziell beurlaubt. Von 1946 bis 1948 war er Bürgermeister der Gemeinde Kampen auf Sylt. in der Schule die ganze Stadt kulturell nach vorne gebracht hatten, kann überhaupt nicht die Rede sein! Da war eher die Werkkunstschule Offenbach von Bedeutung. Die war viel freier. Viel wichtiger für die Stadt waren die Presse und die Buchmesse.
Fritz Wichert (1878 Mainz – 1957 Kampen) leitete von 1909 bis 1922 die Kunsthalle Mannheim und war ab 1923 Direktor der Städelschule in Frankfurt am Main. Dort konnte er unter anderem Willi Baumeister und Max Beckmann als Professoren für die Schule gewinnen. 1933 wurde Wichert von den Nationalsozialisten offiziell beurlaubt. Von 1946 bis 1948 war er Bürgermeister der Gemeinde Kampen auf Sylt. in der Schule die ganze Stadt kulturell nach vorne gebracht hatten, kann überhaupt nicht die Rede sein! Da war eher die Werkkunstschule Offenbach von Bedeutung. Die war viel freier. Viel wichtiger für die Stadt waren die Presse und die Buchmesse.
Bot die Sammlung des Städel Museums Ihnen damals dennoch Anregung für die eigene Arbeit?
Mir persönlich hat auch die konservative Sammlung teilweise viel gebracht. Ich konnte – und kann sie bis heute – in bestimmten Werken wie ein Nachschlagewerk lesen. Ich habe auch mit Klaus Gallwitz ![]() Klaus Gallwitz (* 1930 Pillnitz) ist ein deutscher Kunsthistoriker und Kurator, der von 1967 bis 1974 die Kunsthalle Baden-Baden leitete. Von 1974 bis 1994 war er Direktor am Städel Museum in Frankfurt am Main, von 1995 bis 2002 leitete er das Künstlerhaus Schloss Balmoral in Bad Ems. Ab 2004 war er unter anderem als Gründungsdirektor des Museums Frieder Burda in Baden-Baden und des Arp Museums Bahnhof Rolandseck in Remagen tätig. Zwischen 1976 und 1980 betreute Gallwitz dreimal den Deutschen Pavillon auf der Biennale von Venedig, wo er Ausstellungen mit Joseph Beuys (1976), Jochen Gerz (1976), Reiner Ruthenbeck (1976), Dieter Krieg (1978), Ulrich Rückriem (1978), Georg Baselitz (1980) und Anselm Kiefer (1980) verantwortete. eine Zeit lang viel zu tun gehabt. Zusammen mit einem Kollegen, René Vogelsinger, habe ich drei oder vier Kataloge für ihn gestaltet, und die allgemeine Öffnung des Museums in Richtung Kiefer, Baselitz, Uecker miterlebt. Gallwitz hat die allererste Kiefer-Ausstellung
Klaus Gallwitz (* 1930 Pillnitz) ist ein deutscher Kunsthistoriker und Kurator, der von 1967 bis 1974 die Kunsthalle Baden-Baden leitete. Von 1974 bis 1994 war er Direktor am Städel Museum in Frankfurt am Main, von 1995 bis 2002 leitete er das Künstlerhaus Schloss Balmoral in Bad Ems. Ab 2004 war er unter anderem als Gründungsdirektor des Museums Frieder Burda in Baden-Baden und des Arp Museums Bahnhof Rolandseck in Remagen tätig. Zwischen 1976 und 1980 betreute Gallwitz dreimal den Deutschen Pavillon auf der Biennale von Venedig, wo er Ausstellungen mit Joseph Beuys (1976), Jochen Gerz (1976), Reiner Ruthenbeck (1976), Dieter Krieg (1978), Ulrich Rückriem (1978), Georg Baselitz (1980) und Anselm Kiefer (1980) verantwortete. eine Zeit lang viel zu tun gehabt. Zusammen mit einem Kollegen, René Vogelsinger, habe ich drei oder vier Kataloge für ihn gestaltet, und die allgemeine Öffnung des Museums in Richtung Kiefer, Baselitz, Uecker miterlebt. Gallwitz hat die allererste Kiefer-Ausstellung ![]() „Anselm Kiefer. Über Räume und Völker“, Städel Museum, Frankfurt am Main, Februar – Mai 1990. im Städel gemacht (mit einem immer im Hintergrund brummenden Abs). Er hat ja auch 1980 auf der Biennale von Venedig Baselitz und Kiefer gezeigt.
„Anselm Kiefer. Über Räume und Völker“, Städel Museum, Frankfurt am Main, Februar – Mai 1990. im Städel gemacht (mit einem immer im Hintergrund brummenden Abs). Er hat ja auch 1980 auf der Biennale von Venedig Baselitz und Kiefer gezeigt.
Gab es andere Museen in Deutschland, die Sie damals besucht haben?
Die Museen waren ja noch nicht so weit. Die kamen erst langsam und wurden dann von guten Händlern beliefert, das war aber 20 Jahre später. Nach Morsbroich, Wiesbaden und anderen Fachmuseen würde ich da prominent die Sammlung Ludwig ![]() Ab 1969 baute das Industriellenpaar Peter (1925 Koblenz – 1996 Aachen) und Irene (1927 Aachen – 2010 Aachen) Ludwig eine der bedeutendsten Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst auf. Neben den Strömungen der Pop-Art und der abstrakten Malerei umfasste diese auch Positionen aus dem Bereich der Konzeptkunst, der russischen Avantgarde und des Expressionismus. Durch Schenkungen und Leihgaben etablierte das Ehepaar Ludwig zahlreiche Kooperationen zwischen öffentlichen Trägern und ihrer Privatsammlung. So erhielt die Stadt Köln 1976 einen umfangreichen Sammlungsbestand unter der Voraussetzung, einen eigenen Präsentationsort – das heutige Museum Ludwig – zu errichten. 1982 gründeten Peter und Irene Ludwig die Ludwig Stiftung für Kunst und internationale Verständigung, die nach dem Tod Peter Ludwigs 1996 in die Peter und Irene Ludwig Stiftung überging. nennen. Die haben wir uns natürlich reingezogen. Da konnte man sehr gut Pop, generell amerikanische Kunst, sehen. Das war auch die erste Konzeption, die mal anders war. Ein großer Sammler hat da seine Werke platziert und damit das amerikanische Modell des „Kunst-Sammelns“ in Deutschland hochgezogen. Köln und das Rheinland waren wirklich führend, auch auf dem Gebiet der Museen. Das waren die ersten Orte, wo alles zu sehen, alles zu hören war und eben auch offiziell geschätzt worden ist.
Ab 1969 baute das Industriellenpaar Peter (1925 Koblenz – 1996 Aachen) und Irene (1927 Aachen – 2010 Aachen) Ludwig eine der bedeutendsten Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst auf. Neben den Strömungen der Pop-Art und der abstrakten Malerei umfasste diese auch Positionen aus dem Bereich der Konzeptkunst, der russischen Avantgarde und des Expressionismus. Durch Schenkungen und Leihgaben etablierte das Ehepaar Ludwig zahlreiche Kooperationen zwischen öffentlichen Trägern und ihrer Privatsammlung. So erhielt die Stadt Köln 1976 einen umfangreichen Sammlungsbestand unter der Voraussetzung, einen eigenen Präsentationsort – das heutige Museum Ludwig – zu errichten. 1982 gründeten Peter und Irene Ludwig die Ludwig Stiftung für Kunst und internationale Verständigung, die nach dem Tod Peter Ludwigs 1996 in die Peter und Irene Ludwig Stiftung überging. nennen. Die haben wir uns natürlich reingezogen. Da konnte man sehr gut Pop, generell amerikanische Kunst, sehen. Das war auch die erste Konzeption, die mal anders war. Ein großer Sammler hat da seine Werke platziert und damit das amerikanische Modell des „Kunst-Sammelns“ in Deutschland hochgezogen. Köln und das Rheinland waren wirklich führend, auch auf dem Gebiet der Museen. Das waren die ersten Orte, wo alles zu sehen, alles zu hören war und eben auch offiziell geschätzt worden ist.
1969 fand in der Kunsthalle Bern die Ausstellung „When Attitudes Become Form“ ![]() „Live in Your Head. When Attitudes Become Form“, Kunsthalle Bern, 22. März – 27. April 1969. Die von Harald Szeemann kuratierte Ausstellung vereinte erstmals eine Anzahl internationaler künstlerischer Positionen, deren Werke sich durch Prozesshaftigkeit, materielle Transformationen und den Bezug zu situativen Kontexten auszeichneten. Die Präsentation gilt als wegweisende Verortung eines erweiterten Kunstbegriffs, wie er zu diesem Zeitpunkt insbesondere in der Arte povera, der Minimal Art, der Konzeptkunst und der Land-Art verhandelt wurde. An der Ausstellung beteiligt waren unter anderen Carl Andre, Giovanni Anselmo, Joseph Beuys, Michael Buthe, Hanne Darboven, Walter De Maria, Jan Dibbets, Ger van Elk, Hans Haacke, Eva Hesse, Yves Klein, Jannis Kounellis, Bernd Lohaus, Mario Merz, Robert Morris, Bruce Nauman, Reiner Ruthenbeck, Franz Erhard Walther und Lawrence Weiner. statt.
„Live in Your Head. When Attitudes Become Form“, Kunsthalle Bern, 22. März – 27. April 1969. Die von Harald Szeemann kuratierte Ausstellung vereinte erstmals eine Anzahl internationaler künstlerischer Positionen, deren Werke sich durch Prozesshaftigkeit, materielle Transformationen und den Bezug zu situativen Kontexten auszeichneten. Die Präsentation gilt als wegweisende Verortung eines erweiterten Kunstbegriffs, wie er zu diesem Zeitpunkt insbesondere in der Arte povera, der Minimal Art, der Konzeptkunst und der Land-Art verhandelt wurde. An der Ausstellung beteiligt waren unter anderen Carl Andre, Giovanni Anselmo, Joseph Beuys, Michael Buthe, Hanne Darboven, Walter De Maria, Jan Dibbets, Ger van Elk, Hans Haacke, Eva Hesse, Yves Klein, Jannis Kounellis, Bernd Lohaus, Mario Merz, Robert Morris, Bruce Nauman, Reiner Ruthenbeck, Franz Erhard Walther und Lawrence Weiner. statt.
Ja, die waren schon weiter. Daran sah man, die Schweizer hatten keinen Krieg. Das war eine tolle Ausstellung, von der ich allerdings nur den Katalog gesehen habe. Danach ging es dann wirklich los. Kunst wurde zu dem, was Beuys und andere in Aussicht gestellt hatten: Sie veränderte die gesamte Gesellschaft. Da fallen mir jedoch nicht nur Kunstwerke und Studentenrevolten ein, sondern auch Figuren wie Franz Dahlem ![]() Franz Dahlem (* 1938 München) gründete 1963 gemeinsam mit Heiner und Six Friedrich die Galerie Friedrich & Dahlem in München. Zum Jahreswechsel 1966/67 eröffnete er eine eigene Galerie in Darmstadt und lernte dort den Sammler Karl Ströher kennen. Gemeinsam mit Heiner Friedrich vermittelte er Ströher im Jahr 1968 die Sammlung des US-amerikanischen Versicherungsmaklers Leon Kraushar. Dahlem gilt als enger Vertrauter und wichtiger Vermittler der Kunst von Georg Baselitz, Joseph Beuys, Uwe Lausen und Blinky Palermo. . Der hatte so eine subversive Haltung, die sehr gesund für mich war. Er war ja Berater von Karl Ströher in Darmstadt. Sie kennen sicher die Geschichte von Dahlem, wie er den Sammler Ströher auf einem Flug nach Amerika umgebogen hat, anstatt einer Briefmarkensammlung die Kraushar-Sammlung zu kaufen.
Franz Dahlem (* 1938 München) gründete 1963 gemeinsam mit Heiner und Six Friedrich die Galerie Friedrich & Dahlem in München. Zum Jahreswechsel 1966/67 eröffnete er eine eigene Galerie in Darmstadt und lernte dort den Sammler Karl Ströher kennen. Gemeinsam mit Heiner Friedrich vermittelte er Ströher im Jahr 1968 die Sammlung des US-amerikanischen Versicherungsmaklers Leon Kraushar. Dahlem gilt als enger Vertrauter und wichtiger Vermittler der Kunst von Georg Baselitz, Joseph Beuys, Uwe Lausen und Blinky Palermo. . Der hatte so eine subversive Haltung, die sehr gesund für mich war. Er war ja Berater von Karl Ströher in Darmstadt. Sie kennen sicher die Geschichte von Dahlem, wie er den Sammler Ströher auf einem Flug nach Amerika umgebogen hat, anstatt einer Briefmarkensammlung die Kraushar-Sammlung zu kaufen. ![]() Vgl. Katrin Sauerländer, „Die Sammlung 1968 Karl Ströher. Rudolf Zwirner im Interview“, in: dies. (Hg.), „Karl Ströher. Eine Sammlergeschichte“, Frankfurt am Main 2005, S. 117–128, hier S. 123. So war er und so hat er auch den „Block Beuys“
Vgl. Katrin Sauerländer, „Die Sammlung 1968 Karl Ströher. Rudolf Zwirner im Interview“, in: dies. (Hg.), „Karl Ströher. Eine Sammlergeschichte“, Frankfurt am Main 2005, S. 117–128, hier S. 123. So war er und so hat er auch den „Block Beuys“ ![]() „Block Beuys“ bezeichnet den größten zusammenhängenden Werkkomplex des Künstlers Joseph Beuys, der in den Jahren 1967 bis 1969 in mehreren Ankäufen von Karl Ströher erworben wurde und seit 1970 dauerhaft in sieben Räumen des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt präsentiert wird. Den Kern des Werkkomplexes bildet eine Anzahl von Arbeiten, die erstmals 1967 in der Ausstellung „Parallelprozeß I“ im Städtischen Museum in Mönchengladbach gezeigt wurden. In seiner heutigen Form umfasst der „Block Beuys“ sowohl Plastiken und Arbeiten auf Papier wie auch zahlreiche Relikte aus Aktionen des Künstlers. nach Darmstadt gebracht. Der hat, aus einer subversiven Haltung heraus, etwas unglaublich Wichtiges gemacht. Und er war eben kein Museumsdirektor, sondern ein ehemaliger Bierbrauer. Der kam wirklich von unten. Für mich gehört Franz Dahlem zu den wichtigsten Persönlichkeiten in Deutschland nach dem Krieg. Weil er selbst wie ein Künstler gearbeitet hat. Man muss erst einmal dazu kommen, jemandem, der zwei Millionen in der Tasche hat, zu sagen: „Komm, lass die Briefmarken, kauf lieber die Sammlung Kraushar.“ Das Frankfurter MMK wäre um vieles ärmer, wenn es diese Sammlung nicht in die Hände bekommen hätte.
„Block Beuys“ bezeichnet den größten zusammenhängenden Werkkomplex des Künstlers Joseph Beuys, der in den Jahren 1967 bis 1969 in mehreren Ankäufen von Karl Ströher erworben wurde und seit 1970 dauerhaft in sieben Räumen des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt präsentiert wird. Den Kern des Werkkomplexes bildet eine Anzahl von Arbeiten, die erstmals 1967 in der Ausstellung „Parallelprozeß I“ im Städtischen Museum in Mönchengladbach gezeigt wurden. In seiner heutigen Form umfasst der „Block Beuys“ sowohl Plastiken und Arbeiten auf Papier wie auch zahlreiche Relikte aus Aktionen des Künstlers. nach Darmstadt gebracht. Der hat, aus einer subversiven Haltung heraus, etwas unglaublich Wichtiges gemacht. Und er war eben kein Museumsdirektor, sondern ein ehemaliger Bierbrauer. Der kam wirklich von unten. Für mich gehört Franz Dahlem zu den wichtigsten Persönlichkeiten in Deutschland nach dem Krieg. Weil er selbst wie ein Künstler gearbeitet hat. Man muss erst einmal dazu kommen, jemandem, der zwei Millionen in der Tasche hat, zu sagen: „Komm, lass die Briefmarken, kauf lieber die Sammlung Kraushar.“ Das Frankfurter MMK wäre um vieles ärmer, wenn es diese Sammlung nicht in die Hände bekommen hätte. ![]() Durch die Initiative des Gründungsdirektors des Museums für Moderne Kunst (MMK) Peter Iden konnten 1981 70 Werke der Sammlung Ströher für das neu entstandene MMK in Frankfurt am Main erstanden werden. Zu den erworbenen Arbeiten zählen unter anderem Francis Bacons „Nude“ (1960), Yves Kleins „Monochrome Bleu IKB 88“ (1959), Robert Morris’ „Fountain“ (1963), Gerhard Richters „Fußgänger“ (1963) und Andy Warhols „One Hundred Campbell’s Soup Cans“ (1962). Siehe auch: Christmut Präger, „Das Museum für Moderne Kunst und die Sammlung Ströher“, in: Jean-Christophe Ammann/Christmut Präger, „Museum für Moderne Kunst und Sammlung Ströher“, Schriften zur Sammlung des Museums für Moderne Kunst, Frankfurt am Main 1991, S. 61–91, hier S. 84.
Durch die Initiative des Gründungsdirektors des Museums für Moderne Kunst (MMK) Peter Iden konnten 1981 70 Werke der Sammlung Ströher für das neu entstandene MMK in Frankfurt am Main erstanden werden. Zu den erworbenen Arbeiten zählen unter anderem Francis Bacons „Nude“ (1960), Yves Kleins „Monochrome Bleu IKB 88“ (1959), Robert Morris’ „Fountain“ (1963), Gerhard Richters „Fußgänger“ (1963) und Andy Warhols „One Hundred Campbell’s Soup Cans“ (1962). Siehe auch: Christmut Präger, „Das Museum für Moderne Kunst und die Sammlung Ströher“, in: Jean-Christophe Ammann/Christmut Präger, „Museum für Moderne Kunst und Sammlung Ströher“, Schriften zur Sammlung des Museums für Moderne Kunst, Frankfurt am Main 1991, S. 61–91, hier S. 84.
Woher kannten Sie Franz Dahlem?
Durch die Galerie Friedrich & Dahlem. Da war ich einmal bei einer Gruppenausstellung ![]() „Buchstaben – Schreibspuren – Signale“, Galerie Friedrich & Dahlem, München, 16. Januar – 13. Februar 1965. An der Ausstellung beteiligt waren: Franz Mon, Klaus Burkhardt, Thomas Bayrle, Bernhard Jäger, Gerhard Hoehme, Herbert Hajek, Winfred Gaul, Georg Karl Pfahler, Peter Brüning, Wolfgang Schmidt, K.O. Götz, Werner Schreib. dabei. Das war so eine Pop-Sache, eine Accrochage in München, 1965. Mit sieben, acht Künstlern und darunter eben auch Bayrle/Jäger. Seitdem kannte ich Dahlem. Er wohnte, nachdem er der Berater von Ströher geworden war, in einem Schulhaus in Darmstadt. Wir waren öfter bei ihm zu Hause. Da gab es einen langen Gang und da standen links vielleicht 40, 50 Bilder, in Formaten bis zu einem Meter – und rechts mindestens 60, 70 Bilder, kleinere Formate. Alle mit dem Gesicht zur Wand. Vorne in dem circa 20 Meter langen Gang lag eine große Arbeit von Tom Wesselmann auf dem glatten schwarzen Boden. Dahlem sagte: „Jetzt zeige ich euch mal, was kommen wird“, nahm Anlauf von mehreren Metern und kickte den Wesselmann durch den ganzen Schulraum, bis hinten an die Wand! Die Wucht von seinem Tritt auf das Ding war so groß, dass es fast auseinandergebrochen ist.Anschließend hat er die Bilder, die mit dem Gesicht zur Wand standen, umgedreht: rund 50 Kuh-Bilder
„Buchstaben – Schreibspuren – Signale“, Galerie Friedrich & Dahlem, München, 16. Januar – 13. Februar 1965. An der Ausstellung beteiligt waren: Franz Mon, Klaus Burkhardt, Thomas Bayrle, Bernhard Jäger, Gerhard Hoehme, Herbert Hajek, Winfred Gaul, Georg Karl Pfahler, Peter Brüning, Wolfgang Schmidt, K.O. Götz, Werner Schreib. dabei. Das war so eine Pop-Sache, eine Accrochage in München, 1965. Mit sieben, acht Künstlern und darunter eben auch Bayrle/Jäger. Seitdem kannte ich Dahlem. Er wohnte, nachdem er der Berater von Ströher geworden war, in einem Schulhaus in Darmstadt. Wir waren öfter bei ihm zu Hause. Da gab es einen langen Gang und da standen links vielleicht 40, 50 Bilder, in Formaten bis zu einem Meter – und rechts mindestens 60, 70 Bilder, kleinere Formate. Alle mit dem Gesicht zur Wand. Vorne in dem circa 20 Meter langen Gang lag eine große Arbeit von Tom Wesselmann auf dem glatten schwarzen Boden. Dahlem sagte: „Jetzt zeige ich euch mal, was kommen wird“, nahm Anlauf von mehreren Metern und kickte den Wesselmann durch den ganzen Schulraum, bis hinten an die Wand! Die Wucht von seinem Tritt auf das Ding war so groß, dass es fast auseinandergebrochen ist.Anschließend hat er die Bilder, die mit dem Gesicht zur Wand standen, umgedreht: rund 50 Kuh-Bilder ![]() Nach seinem Umzug von Berlin in das ländliche Gebiet bei Worms Mitte der 1960er-Jahre unterzog Georg Baselitz in den sogenannten „Frakturbildern“ seine Alltagswelt zunehmend einer malerischen Analyse und fertigte im Zuge dessen zwischen 1967 und 1969 eine Serie von Kuh-Bildern an. Dazu gehören „Die Kuh“ (1967), „Drei Streifen, zwei Kühe“ (1967) und „Eine Kuh abwärts“ (1969). Siehe auch: Christian Malycha, „Das Motiv ohne Inhalt. Malerei bei Georg Baselitz 1959–1969“, Bielefeld 2008, S. 167 ff.
Nach seinem Umzug von Berlin in das ländliche Gebiet bei Worms Mitte der 1960er-Jahre unterzog Georg Baselitz in den sogenannten „Frakturbildern“ seine Alltagswelt zunehmend einer malerischen Analyse und fertigte im Zuge dessen zwischen 1967 und 1969 eine Serie von Kuh-Bildern an. Dazu gehören „Die Kuh“ (1967), „Drei Streifen, zwei Kühe“ (1967) und „Eine Kuh abwärts“ (1969). Siehe auch: Christian Malycha, „Das Motiv ohne Inhalt. Malerei bei Georg Baselitz 1959–1969“, Bielefeld 2008, S. 167 ff.  von Georg Baselitz und die etwas kleineren Standart-Bilder
von Georg Baselitz und die etwas kleineren Standart-Bilder ![]() Ab 1970 entwickelte A.R. Penck (1939 Dresden – 2017 Zürich) für seine Malerei ein Zeichensystem, das jedem Betrachter die Lesbarkeit und Dechiffrierbarkeit seiner Bilder ermöglichen sollte. Unter dem Begriff „Standart“ fasste Penck sein Bildkonzept zusammen. Vgl. Eric Darragon, „Logik des Filzes, Logik des Sinns“, in: „A.R. Penck. Filzarbeiten und Zeichnungen 1972–1995“, hg. von Kasper König/Paola Malavassi, Ausst.-Kat. Museum Ludwig, Köln, Köln 2011, S. 12–15, hier S. 13 f. von A.R. Penck, der damals noch „drüben“ war. Die hatte Franz Dahlem vermutlich durch Geschäfte und Freundschaften mit den Künstlern besorgt. Neben Adam Seide war er wirklich lange einer der Wichtigsten für mich, bis ich Anfang der 80er-Jahre Kasper König getroffen habe. In den 70er-Jahren hat Dahlem dann hier in Frankfurt im Westend gewohnt. Da ist er im rechtmäßigen Sinne verkommen. Das war typisch für Frankfurt. Man konnte hier nur verkommen, wenn man so radikal war wie er.
Ab 1970 entwickelte A.R. Penck (1939 Dresden – 2017 Zürich) für seine Malerei ein Zeichensystem, das jedem Betrachter die Lesbarkeit und Dechiffrierbarkeit seiner Bilder ermöglichen sollte. Unter dem Begriff „Standart“ fasste Penck sein Bildkonzept zusammen. Vgl. Eric Darragon, „Logik des Filzes, Logik des Sinns“, in: „A.R. Penck. Filzarbeiten und Zeichnungen 1972–1995“, hg. von Kasper König/Paola Malavassi, Ausst.-Kat. Museum Ludwig, Köln, Köln 2011, S. 12–15, hier S. 13 f. von A.R. Penck, der damals noch „drüben“ war. Die hatte Franz Dahlem vermutlich durch Geschäfte und Freundschaften mit den Künstlern besorgt. Neben Adam Seide war er wirklich lange einer der Wichtigsten für mich, bis ich Anfang der 80er-Jahre Kasper König getroffen habe. In den 70er-Jahren hat Dahlem dann hier in Frankfurt im Westend gewohnt. Da ist er im rechtmäßigen Sinne verkommen. Das war typisch für Frankfurt. Man konnte hier nur verkommen, wenn man so radikal war wie er.
Die Gründung der Galerie in München und das Programm, das Friedrich & Dahlem gemacht haben, zeugt von großer Leidenschaft für die Kunst und sicher von ebenso großer Risikobereitschaft. Sie gelten aber gleichermaßen auch als hartnäckige Händler.
Mit der Zeit war es überall marktgetrieben. Ich will das gar nicht vertiefen. Ich möchte nur meine eigene Skepsis an dem ganzen Betrieb deutlich machen. Der Betrieb ist nicht alles. Mir geht es vor allem um die Existenzfrage. Ich lebe nur einmal und ich möchte eine künstlerische Existenz nicht nur predigen. Das ist mir das Wichtigste. Und das war vielleicht auch das, was ich versucht habe, mit den Studenten zu praktizieren, ihnen klarzumachen, dass der Betrieb nicht alles ist, sondern dass es eigentlich um die altmodische Sache geht, um die Existenz. Und das muss eben jeder selbst fertigbringen. Ich war nie 100 Prozent auf dem Betrieb drauf. Ich war immer bei 80 und dann habe ich schon gemerkt, es wird anstrengend, es wird wirklich zur Religion. Und das muss nicht sein.
Ist das auch ein Grund, dass Sie hiergeblieben sind?
Ja, völlig richtig. Ich muss nicht irgendwo am Drücker sitzen. Ich bin ja in Berlin geboren, ich hätte ja immer hingekonnt, aber ich sehe es einfach nicht ein, dass ich da bei dem anstrengenden Wolfsgeheule mitheulen soll. Leben kann ich überall, wo eine bestimmte Dichte gegeben ist. Und wo ich das auch existenziell so auffächern kann, dass es nicht nur zur Landplage wird. Die politische Skepsis ist bei mir sehr tief. Und die war mir einige Jahre wichtiger als das ganze andere Theater. Deswegen habe ich einen „Fehler“ gemacht, den man nicht machen darf – man muss immer fleißig dranbleiben, und das habe ich nicht immer gemacht.
Das war Ihre Entscheidung. Würden Sie das heute als Fehler bezeichnen?
Nein. Im Gegenteil. Ein wichtiger Künstler hier in Frankfurt war Wolfgang Schmidt ![]() Wolfgang Schmidt (1929 Fulda – 1995 Witzenhausen) war ein deutscher Maler und Grafiker, der vor allem für das Gestaltungskonzept der Frankfurter U-Bahn bekannt ist. . Es ist unglaublich, dass der nicht beachtet wird. Mit ihm habe ich zum Beispiel in Offenbach, als ich dort ein Praktikum machte, den ersten Kinderplaneten organisiert.
Wolfgang Schmidt (1929 Fulda – 1995 Witzenhausen) war ein deutscher Maler und Grafiker, der vor allem für das Gestaltungskonzept der Frankfurter U-Bahn bekannt ist. . Es ist unglaublich, dass der nicht beachtet wird. Mit ihm habe ich zum Beispiel in Offenbach, als ich dort ein Praktikum machte, den ersten Kinderplaneten organisiert. ![]() 1971 haben Thomas Bayrle und Wolfgang Schmidt gemeinsam mit Studierenden der Hochschule für Gestaltung in Offenbach einen „Kinderplaneten“, bestehend aus einem Spiel- und Aktionsfeld in der Frankfurter Messe, organisiert.
1971 haben Thomas Bayrle und Wolfgang Schmidt gemeinsam mit Studierenden der Hochschule für Gestaltung in Offenbach einen „Kinderplaneten“, bestehend aus einem Spiel- und Aktionsfeld in der Frankfurter Messe, organisiert. 
Gab es außer Peter Roehr und Charlotte Posenenske weitere Künstler, mit denen Sie zu tun hatten? Sie kannten Goepfert, Sie waren bei Fontana. Aber gab es auch aus Ihrer Generation noch jemanden, mit dem Sie sich austauschen konnten?
Ich war natürlich mit Jäger zusammen, das war der Verlag. Das war eine geistig interessante Situation. Wir waren eine Anlaufstelle für sehr viele konkrete Künstler, Konkrete Poesie und so weiter. Ansonsten muss ich sagen, so eng wie mit Roehr ist es mit niemandem mehr geworden. Ich habe natürlich sehr viele Künstler kennen- und auch schätzen gelernt, zum Beispiel Niele Toroni, eine ganz tolle Persönlichkeit. Das waren auch alles Skeptiker, also Künstler, die ihre Existenz infrage stellten. Oder die Studentenbewegung – das klingt heute alles modisch – ist natürlich total wichtig gewesen. Da ist man bis an die Grenze oder über die Grenze hinaus, die erträglich war. Das waren für mich wichtige Erfahrungen, dass man zum Beispiel jemanden wie den Jan-Carl Raspe ![]() Jan-Carl Raspe (1944 Seefeld, Österreich – 1977 Stuttgart) war ein deutscher Soziologe, der 1966 zu den Mitbegründern der Kommune 2 in Berlin-Charlottenburg gehörte. Seine Wohnung diente ab 1970 für die erste Generation der Roten-Armee-Fraktion (RAF) als Zufluchtsort. Gemeinsam mit Andreas Baader und Holger Meins wurde Jan-Carl Raspe 1972 in Frankfurt am Main verhaftet und starb am 18. Oktober 1977 in der sogenannten „Todesnacht von Stammheim“. kennengelernt hat. Da wurde einem klar, das sind nicht nur irgendwelche Freaks, die eben mal die 65. Ausstellung hinter sich gebracht haben, sondern die stellen ganz andere Fragen. Dass man dann auch mal in die Bredouille geraten ist und zu weit ging, ist auch klar. Für mich war immer wichtig, dass eine Existenz mindestens ein Drittel Entscheidungsfreiheit behält. Auch wenn man mal Pech gehabt hat, dann war es eben so. Dann hat etwas halt nicht geklappt, dafür hat etwas anderes geklappt. Ich habe dafür andere Erfahrungen gemacht, die andere 100 Prozent nicht gemacht haben. Diese Erfahrungen sind mir sehr wichtig.
Jan-Carl Raspe (1944 Seefeld, Österreich – 1977 Stuttgart) war ein deutscher Soziologe, der 1966 zu den Mitbegründern der Kommune 2 in Berlin-Charlottenburg gehörte. Seine Wohnung diente ab 1970 für die erste Generation der Roten-Armee-Fraktion (RAF) als Zufluchtsort. Gemeinsam mit Andreas Baader und Holger Meins wurde Jan-Carl Raspe 1972 in Frankfurt am Main verhaftet und starb am 18. Oktober 1977 in der sogenannten „Todesnacht von Stammheim“. kennengelernt hat. Da wurde einem klar, das sind nicht nur irgendwelche Freaks, die eben mal die 65. Ausstellung hinter sich gebracht haben, sondern die stellen ganz andere Fragen. Dass man dann auch mal in die Bredouille geraten ist und zu weit ging, ist auch klar. Für mich war immer wichtig, dass eine Existenz mindestens ein Drittel Entscheidungsfreiheit behält. Auch wenn man mal Pech gehabt hat, dann war es eben so. Dann hat etwas halt nicht geklappt, dafür hat etwas anderes geklappt. Ich habe dafür andere Erfahrungen gemacht, die andere 100 Prozent nicht gemacht haben. Diese Erfahrungen sind mir sehr wichtig.
In einem Gespräch, das Sie anlässlich der Ausstellung „The World Goes Pop“ ![]() „The EY Exhibition. The World Goes Pop“, Tate Modern, London, 17. September 2015 – 24. Januar 2016. in der Tate geführt haben, sagten Sie, dass Sie sich für den Kunstmarkt nicht sicher genug fühlten.
„The EY Exhibition. The World Goes Pop“, Tate Modern, London, 17. September 2015 – 24. Januar 2016. in der Tate geführt haben, sagten Sie, dass Sie sich für den Kunstmarkt nicht sicher genug fühlten.
Nein, da war ich nicht so sicher.
Was genau heißt das? Waren Sie sich mit Ihrer Arbeit nicht sicher?
Heinz Mack und diese Leute haben sich ein richtiges Image zugelegt. Ich finde das in Ordnung, nur für mich würde es nicht passen, weil ich wichtig finde, dass in einer künstlerischen Existenz ein Drittel unsicher bleibt. Ich weiß doch, dass ich sterbe, ich weiß doch, dass ich hier heute noch sitze und morgen bin ich schon in Milliarden von Teilchen zerlegt, weil ich zum Beispiel verbrannt worden bin. Das ist eine Tatsache, die muss man doch nicht einfach wegschieben. Und es ist toll, dass es so ist. Das ging mir jetzt mit Jean-Christophe Ammann ![]() Jean-Christophe Ammann (1939 Berlin – 2015 Frankfurt am Main) war ein Kunsthistoriker und Ausstellungsmacher. Er war Direktor des Kunstmuseums Luzern (1968–1977), der Kunsthalle Basel (1978–1988) sowie des Frankfurter Museums für Moderne Kunst (1989–2001). 1972 war Ammann als Mitarbeiter Harald Szeemanns an der „documenta 5“ beteiligt und 1995 kommissarischer Leiter des Deutschen Pavillons auf der „46. Biennale von Venedig“. Ab 1998 lehrte er als Honorarprofessor an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. auch so. Erst war er noch da und dann, drei Tage später, war er verbrannt. Was heißt das? Der ist in die „ewigen Jagdgründe“ nicht nur eingegangen, sondern das ist die atomare Realität dieses Lebens. Wer die verliert, der verliert etwas ganz Wichtiges. Etwas Wichtigeres gibt es nicht. Und da entstehen auch für mich die sogenannten „moralischen Fragen“. Was hat das mit religiösen Vorstellungen zu tun und was hat das langfristig mit einer Kultur zu tun? Diese Fragen hat ZERO zum Beispiel nicht im Geringsten transportiert. Das war nach dem Krieg auch verständlich. Für mich aber ist wichtig, dass Maserati toll ist und eine Verbrennung ist auch toll.
Jean-Christophe Ammann (1939 Berlin – 2015 Frankfurt am Main) war ein Kunsthistoriker und Ausstellungsmacher. Er war Direktor des Kunstmuseums Luzern (1968–1977), der Kunsthalle Basel (1978–1988) sowie des Frankfurter Museums für Moderne Kunst (1989–2001). 1972 war Ammann als Mitarbeiter Harald Szeemanns an der „documenta 5“ beteiligt und 1995 kommissarischer Leiter des Deutschen Pavillons auf der „46. Biennale von Venedig“. Ab 1998 lehrte er als Honorarprofessor an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. auch so. Erst war er noch da und dann, drei Tage später, war er verbrannt. Was heißt das? Der ist in die „ewigen Jagdgründe“ nicht nur eingegangen, sondern das ist die atomare Realität dieses Lebens. Wer die verliert, der verliert etwas ganz Wichtiges. Etwas Wichtigeres gibt es nicht. Und da entstehen auch für mich die sogenannten „moralischen Fragen“. Was hat das mit religiösen Vorstellungen zu tun und was hat das langfristig mit einer Kultur zu tun? Diese Fragen hat ZERO zum Beispiel nicht im Geringsten transportiert. Das war nach dem Krieg auch verständlich. Für mich aber ist wichtig, dass Maserati toll ist und eine Verbrennung ist auch toll.
Haben Sie die ZERO-Bewegung damals verfolgt?
Ja. Ich fand das gut, aber ich fand es auch anstrengend und ich fand es zu wenig.
Und Fluxus ![]() Fluxus ist eine Kunstströmung, die sich ab Ende der 1950er-Jahre in New York entwickelte und sich insbesondere durch die Verschränkung musischer, darstellerischer und literarischer Ausdrucksformen auszeichnet. Improvisation gehört durchaus zum „fließenden“ Konzept, genauso wie der Übergang von Kunst und Leben. ? Haben Sie an den Veranstaltungen teilgenommen?
Fluxus ist eine Kunstströmung, die sich ab Ende der 1950er-Jahre in New York entwickelte und sich insbesondere durch die Verschränkung musischer, darstellerischer und literarischer Ausdrucksformen auszeichnet. Improvisation gehört durchaus zum „fließenden“ Konzept, genauso wie der Übergang von Kunst und Leben. ? Haben Sie an den Veranstaltungen teilgenommen?
Teilgenommen nicht. Aber es war ganz wichtig. Das Festival in Wiesbaden ![]() „Fluxus – Internationale Festspiele Neuester Musik“, Städtisches Museum Wiesbaden, 01.–23. September 1962. An dem Festival beteiligt waren unter anderen Dick Higgins, George Maciunas, Nam June Paik, Benjamin Patterson, Wolf Vostell und Emmett Williams. Es gilt als erste offizielle Manifestation der Fluxus-Bewegung. Vgl. „1962 Wiesbaden Fluxus 1982. Eine kleine Geschichte von Fluxus in drei Teilen“, hg. von René Block, Ausst.-Kat. u. a. Museum Wiesbaden, Wiesbaden 1983. war wahnsinnig gut. Da waren George Maciunas und Dick Higgins und noch zwei, drei. Die haben sich in Wiesbaden auf der Air Base gelangweilt und sind dann zu Clemens Weiler, dem Direktor des Museums in Wiesbaden, mit dem ich ja auch viel zu tun hatte, und haben ihn gefragt: „Können wir hier mal was machen?“ Der sagte: „Ihr könnt alles machen.“ Er hatte nämlich vorher gerade eine hervorragende Geschichte erlebt: Nach dem Krieg wurden ja alle Nazis ausgetauscht, die Angestellten wurden durch Gewerkschaftler ersetzt und so weiter. Und eines Tages ging er durch das Museum Wiesbaden und sieht ganze Stöße von Papier am Telefon als Schmierpapier liegen. Das waren alles zerschnittene Grafiken; die Kollegen waren einfach in den Keller gegangen und haben Grafikmappen von Jawlensky zerschnitten, weil sie blöd waren und keine Ahnung hatten. Da hat der Weiler gesagt: „Raus mit euch Arschlöchern! Alle raus!“ Das hat er mir so erzählt. Und genau in dem Moment kamen die Fluxus-Leute und da hat er gesagt: „Ja, ihr könnt hier alles machen.“ Das ist so typisch Rhein-Main. Dass überhaupt solche Armleuchter in ein Museum gesetzt werden, um dort die Hilfestellung zu leisten. Es ist unglaublich.
„Fluxus – Internationale Festspiele Neuester Musik“, Städtisches Museum Wiesbaden, 01.–23. September 1962. An dem Festival beteiligt waren unter anderen Dick Higgins, George Maciunas, Nam June Paik, Benjamin Patterson, Wolf Vostell und Emmett Williams. Es gilt als erste offizielle Manifestation der Fluxus-Bewegung. Vgl. „1962 Wiesbaden Fluxus 1982. Eine kleine Geschichte von Fluxus in drei Teilen“, hg. von René Block, Ausst.-Kat. u. a. Museum Wiesbaden, Wiesbaden 1983. war wahnsinnig gut. Da waren George Maciunas und Dick Higgins und noch zwei, drei. Die haben sich in Wiesbaden auf der Air Base gelangweilt und sind dann zu Clemens Weiler, dem Direktor des Museums in Wiesbaden, mit dem ich ja auch viel zu tun hatte, und haben ihn gefragt: „Können wir hier mal was machen?“ Der sagte: „Ihr könnt alles machen.“ Er hatte nämlich vorher gerade eine hervorragende Geschichte erlebt: Nach dem Krieg wurden ja alle Nazis ausgetauscht, die Angestellten wurden durch Gewerkschaftler ersetzt und so weiter. Und eines Tages ging er durch das Museum Wiesbaden und sieht ganze Stöße von Papier am Telefon als Schmierpapier liegen. Das waren alles zerschnittene Grafiken; die Kollegen waren einfach in den Keller gegangen und haben Grafikmappen von Jawlensky zerschnitten, weil sie blöd waren und keine Ahnung hatten. Da hat der Weiler gesagt: „Raus mit euch Arschlöchern! Alle raus!“ Das hat er mir so erzählt. Und genau in dem Moment kamen die Fluxus-Leute und da hat er gesagt: „Ja, ihr könnt hier alles machen.“ Das ist so typisch Rhein-Main. Dass überhaupt solche Armleuchter in ein Museum gesetzt werden, um dort die Hilfestellung zu leisten. Es ist unglaublich.
Haben Sie das Festival in Wiesbaden besucht?
Nein, da war ich nicht. Ich weiß bis heute nicht, warum ich nicht da war. Wir mussten irgendwie sehen, dass wir durchkamen. Wir haben ja schon 62 geheiratet und von daher war ich total mit meiner Existenz und mit meinem Leben beschäftigt. Ich habe es einfach gar nicht mitgekriegt. Obwohl es direkt vor der Tür war.
Roehr ist ja in die Werkkunstschule in Wiesbaden gegangen. Wir haben aber überhaupt nicht über das Festival geredet – ich bin sicher, er war auch nicht da. Es hat ihn auch nicht beeindruckt, glaube ich. Er hat viel strenger an einer Werkvorstellung gearbeitet, die mit dieser Freiheit der Fluxus-Leute gar nichts zu tun hatte.
Waren Sie zum Festival der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik ![]() Die 1922 von Rudolf Réti und Egon Wellesz gegründete Internationale Gesellschaft für Neue Musik (IGNM) gilt als älteste Dachorganisation zur Förderung der Neuen Musik. Das Festival World New Music Days fand 1960 vom 10. bis zum 19. Juni in Köln statt. in Köln?
Die 1922 von Rudolf Réti und Egon Wellesz gegründete Internationale Gesellschaft für Neue Musik (IGNM) gilt als älteste Dachorganisation zur Förderung der Neuen Musik. Das Festival World New Music Days fand 1960 vom 10. bis zum 19. Juni in Köln statt. in Köln?
Nein, da war ich auch nicht. Musik hat uns schon interessiert, aber nicht unbedingt Karlheinz Stockhausen.
John Cage?
Ja. Um Cage haben wir uns hier auch gekümmert, der war ja in Donaueschingen. Und ich habe auch später noch einen sehr guten Kontakt zu ihm gehabt. Ich weiß noch genau, als hier das Opernhaus abgebrannt ist: Da sollte seine Aufführung stattfinden. ![]() In der Nacht des 12. November 1987 kam es in der Frankfurter Oper zu einem Brand, der das komplette Bühnenhaus zerstörte. Die geplante Uraufführung von John Cages „Europeras 1 & 2“ musste abgesagt werden. Tagelang saß er am Hintereingang auf der Treppe. Dort habe ich mich stundenlang mit ihm unterhalten. Das ist auch eine Haltung, die mich sehr beeindruckt hat. Beuys und Cage hatten noch unheimlich viel Zeit. Das war nicht wie heute, um 8.10 Uhr ankommen und um 9.10 Uhr wieder auf den Flughafen rasen. Die hatten wochenlang Zeit.
In der Nacht des 12. November 1987 kam es in der Frankfurter Oper zu einem Brand, der das komplette Bühnenhaus zerstörte. Die geplante Uraufführung von John Cages „Europeras 1 & 2“ musste abgesagt werden. Tagelang saß er am Hintereingang auf der Treppe. Dort habe ich mich stundenlang mit ihm unterhalten. Das ist auch eine Haltung, die mich sehr beeindruckt hat. Beuys und Cage hatten noch unheimlich viel Zeit. Das war nicht wie heute, um 8.10 Uhr ankommen und um 9.10 Uhr wieder auf den Flughafen rasen. Die hatten wochenlang Zeit.
Was hat Cage in Frankfurt gemacht?
Der wollte hier ein Theaterstück machen, und eine Nacht vor der Premiere ist das Theater abgebrannt. Irgendein Penner ist eingeschlafen und hat das ganze Ding abbrennen lassen. Cage ist dann aber nicht beleidigt oder sonst wie abgedampft, sondern ist einfach dageblieben. Seine Existenz war ihm viel wichtiger. Da zählte jede Minute. Stundenlang saßen wir da auf der Treppe im Dunkeln und ohne Heizung. Das will ich auch noch mal sagen: Die eigentlichen Geschenke sind die Luftblasen. Und diese Blasen sind nicht nur Reflexionszeiten, sondern entscheidende Leerräume oder Leerstellen, die einfach großartig sind und die man nie vergisst. Das einzige Mal, dass ich wirklich von einer Galerie bezahlt worden bin, war 1968. Guido Le Noci hat mich nach Hause eingeladen, mir den Käse über die Spaghetti gerieben und am nächsten Tag gesagt: „So, jetzt gehen wir zur Bank, ich kaufe die Ausstellung.“ Er hat die ganze Ausstellung gekauft. Das ist mir nie wieder passiert, nie vorher und nie nachher. Er ist mit mir zur Bank gegangen und hat mir die ganze Ausstellung ausbezahlt.
Wie viele Werke waren das?
Das waren die „Mäntel“ ![]() Thomas Bayrle, „Mantel“, Multiple in verschiedenen Farben, 1968. Gemeinsam mit dem Frankfurter Modeatelier Lukowsky & Ohanian entwickelte Bayrle 1968 mehrere Modelle für transparente Regenmäntel, die er mit unterschiedlichen Motiven bedrucken ließ.
Thomas Bayrle, „Mantel“, Multiple in verschiedenen Farben, 1968. Gemeinsam mit dem Frankfurter Modeatelier Lukowsky & Ohanian entwickelte Bayrle 1968 mehrere Modelle für transparente Regenmäntel, die er mit unterschiedlichen Motiven bedrucken ließ. 
![]() Marcello Mastroianni (1924 Fontana Liri, Italien – 1996 Paris) war ein italienischer Schauspieler, der insbesondere durch seine Rolle des Marcello Rubini in Federico Fellinis Film „La Dolce Vita“ (1960) bekannt wurde. raus und sagt: „Für den arbeite ich auch.“ Das ist etwas, was hier sehr unangenehm ist, was mir auch immer wieder unangenehm auffällt: Hier wird die Karte zuerst ganzseitig in der „F.A.Z.“ veröffentlicht, bevor überhaupt irgendetwas passiert. Das ist ein Beispiel, um zu zeigen, was für tolle Geschichten es gibt, auch in der Kunst. Und das ist auch ein bisschen mein Umgang mit meinen Künstlerfreunden in der Schule geworden. Nicht: „… Einer wie der Sergej Jensen, der ist ja viel besser wie du … “ – Was soll das? Das ist doch fantastisch, es gibt Bessere als mich, das ist doch logisch.
Marcello Mastroianni (1924 Fontana Liri, Italien – 1996 Paris) war ein italienischer Schauspieler, der insbesondere durch seine Rolle des Marcello Rubini in Federico Fellinis Film „La Dolce Vita“ (1960) bekannt wurde. raus und sagt: „Für den arbeite ich auch.“ Das ist etwas, was hier sehr unangenehm ist, was mir auch immer wieder unangenehm auffällt: Hier wird die Karte zuerst ganzseitig in der „F.A.Z.“ veröffentlicht, bevor überhaupt irgendetwas passiert. Das ist ein Beispiel, um zu zeigen, was für tolle Geschichten es gibt, auch in der Kunst. Und das ist auch ein bisschen mein Umgang mit meinen Künstlerfreunden in der Schule geworden. Nicht: „… Einer wie der Sergej Jensen, der ist ja viel besser wie du … “ – Was soll das? Das ist doch fantastisch, es gibt Bessere als mich, das ist doch logisch.
Kann man das so messen?
Nein, nein … Doch, doch … Ich sage das nur deshalb, weil es so gesagt wird, als müsste man sich davor hüten, dass man sich ja keine Blöße gibt. Ich habe Blößen. Und ich finde die auch nicht schlecht. Das sind auch solche Leerräume, wie das Auf-der-Treppe-Sitzen. Ich denke, Kunst ist eine Atmung. In dieser Atmung sind Leerstellen, und wenn die alle voll sind, dann wird es eine Notsituation. Ich glaube, das ist jetzt die Schwierigkeit. Ich verstehe ja – das sind alles Wahnsinnige, denen steht das Wasser bis zum Hals. Weil es Handel ist, ist es wirklich eine unglaublich schwierige Situation. Aber das muss ich mir nicht antun.
Sie haben Beuys gerade schon erwähnt. Welches Verhältnis hatten Sie zu ihm? Wie war Ihre erste Begegnung mit seinem Werk?
Ich habe ihn öfter getroffen. Am Anfang hat er immer gesagt: „Ach, das ist der mit den Holzkästen.“ Er hat diese Maschinen gut und lustig gefunden. Ich hatte dann mit ihm sehr viel bei dieser Ausstellung „Beuys und seine Schüler“ ![]() „Mit, neben, gegen … Joseph Beuys und seine Schüler“, Frankfurter Kunstverein, Steinernes Haus am Römerberg, Frankfurt am Main, 05. November 1976 – 01. Februar 1977. , die Georg Bussmann hier im Kunstverein machte, zu tun. Da kam Beuys wochenlang jeden Tag von Düsseldorf hierher, hat sich zwei, drei Stunden hingesetzt und mit den Leuten diskutiert. Anschließend ist er wieder nach Hause gefahren. Wochenlang. Zuletzt habe ich ihn bei der „von hier aus“-Ausstellung gesehen.
„Mit, neben, gegen … Joseph Beuys und seine Schüler“, Frankfurter Kunstverein, Steinernes Haus am Römerberg, Frankfurt am Main, 05. November 1976 – 01. Februar 1977. , die Georg Bussmann hier im Kunstverein machte, zu tun. Da kam Beuys wochenlang jeden Tag von Düsseldorf hierher, hat sich zwei, drei Stunden hingesetzt und mit den Leuten diskutiert. Anschließend ist er wieder nach Hause gefahren. Wochenlang. Zuletzt habe ich ihn bei der „von hier aus“-Ausstellung gesehen. ![]() „von hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf“, Halle 13 der Messe Düsseldorf, 29. September – 02. Dezember 1984. Er hat mir auch immer wieder angeboten, er würde gerne mal etwas tauschen. Aber der wurde dermaßen belagert, genauso wie Jörg Immendorff. Ich habe mit denen dann doch nichts getauscht, weil klar wurde, das ist ein Hype und das muss ich nicht haben. Von Beuys habe ich eigentlich sehr viel gelernt. Er war ja fünfzüngig, nicht nur dreizüngig oder zweizüngig. Der hatte eine unglaubliche Weisheit. Und er war nie arrogant, sodass man das Gefühl gehabt hätte, jetzt bist du da nicht mehr dabei oder so. Er war eine Existenz: Wenn ich in einem Palmengarten bin, sind alle anderen Pflanzen auch noch da und auch wichtig für mich. So war Beuys.
„von hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf“, Halle 13 der Messe Düsseldorf, 29. September – 02. Dezember 1984. Er hat mir auch immer wieder angeboten, er würde gerne mal etwas tauschen. Aber der wurde dermaßen belagert, genauso wie Jörg Immendorff. Ich habe mit denen dann doch nichts getauscht, weil klar wurde, das ist ein Hype und das muss ich nicht haben. Von Beuys habe ich eigentlich sehr viel gelernt. Er war ja fünfzüngig, nicht nur dreizüngig oder zweizüngig. Der hatte eine unglaubliche Weisheit. Und er war nie arrogant, sodass man das Gefühl gehabt hätte, jetzt bist du da nicht mehr dabei oder so. Er war eine Existenz: Wenn ich in einem Palmengarten bin, sind alle anderen Pflanzen auch noch da und auch wichtig für mich. So war Beuys.
Sein radikaler Werkbegriff ![]() Das erweiterte Kunstverständnis von Joseph Beuys findet seinen Ausdruck vor allem in dem von ihm geprägten Begriff der „Sozialen Plastik“. Darunter fällt jegliches Handeln, das formend in die Gesellschaft eingreift. Damit wird jeder Mensch, der handelt und formt, zum Künstler. Siehe auch: Volker Harlan/Rainer Rappmann/Peter Schata, „Soziale Plastik. Materialien zu Joseph Beuys“, Krefeld 1984. forderte eine größtmögliche Offenheit. Wie offen war er aber dem Werk anderer Künstler gegenüber?
Das erweiterte Kunstverständnis von Joseph Beuys findet seinen Ausdruck vor allem in dem von ihm geprägten Begriff der „Sozialen Plastik“. Darunter fällt jegliches Handeln, das formend in die Gesellschaft eingreift. Damit wird jeder Mensch, der handelt und formt, zum Künstler. Siehe auch: Volker Harlan/Rainer Rappmann/Peter Schata, „Soziale Plastik. Materialien zu Joseph Beuys“, Krefeld 1984. forderte eine größtmögliche Offenheit. Wie offen war er aber dem Werk anderer Künstler gegenüber?
In dem Sinn bin ich kein ebenbürtiger Kollege für ihn gewesen, sondern jemand, der an anderer Stelle auch etwas machte. Natürlich sind gestandene Kollegen ihm auch an den Karren gefahren. Da gab es ja auch Auseinandersetzungen, vor allem in der Akademie. ![]() Nachdem 1972 ein neues Zulassungsverfahren an der Akademie eingeführt worden war, besetzte Beuys mit einigen seiner Studenten das Hochschulsekretariat. Der im Zuge dessen erteilten Entlassung durch den nordrhein-westfälischen Wissenschaftsminister Johannes Rau begegnete Beuys mit einer langjährigen Klage vor dem Bundesarbeitsgericht. In dem ihm gerichtlich auf Lebenszeit zugesprochenen Raum 3 der Düsseldorfer Kunstakademie initiierte Joseph Beuys 1973 gemeinsam mit Willi Bongard, Georg Meistermann und Klaus Staeck die Freie Internationale Universität (FIU), die als freie Hochschule das bestehende Bildungssystem ergänzen sollte. Die FIU bestand bis zwei Jahre nach dem Tod von Joseph Beuys im Jahr 1986. Das war nicht jedermanns Sache, aber ich hatte dafür schon was übrig. Es war auch modisch, dass man es so exzessiv betrieb, bis ein normaler Akademiebetrieb nicht mehr funktionierte. Aber ich steckte da nicht drin. Ich konnte das von außen sehen und konnte es auch von außen gut finden.
Nachdem 1972 ein neues Zulassungsverfahren an der Akademie eingeführt worden war, besetzte Beuys mit einigen seiner Studenten das Hochschulsekretariat. Der im Zuge dessen erteilten Entlassung durch den nordrhein-westfälischen Wissenschaftsminister Johannes Rau begegnete Beuys mit einer langjährigen Klage vor dem Bundesarbeitsgericht. In dem ihm gerichtlich auf Lebenszeit zugesprochenen Raum 3 der Düsseldorfer Kunstakademie initiierte Joseph Beuys 1973 gemeinsam mit Willi Bongard, Georg Meistermann und Klaus Staeck die Freie Internationale Universität (FIU), die als freie Hochschule das bestehende Bildungssystem ergänzen sollte. Die FIU bestand bis zwei Jahre nach dem Tod von Joseph Beuys im Jahr 1986. Das war nicht jedermanns Sache, aber ich hatte dafür schon was übrig. Es war auch modisch, dass man es so exzessiv betrieb, bis ein normaler Akademiebetrieb nicht mehr funktionierte. Aber ich steckte da nicht drin. Ich konnte das von außen sehen und konnte es auch von außen gut finden.
Die nahezu uneingeschränkte Begeisterung für Beuys hält bei vielen Ihrer Zeitgenossen bis heute an. Ich weiß nicht, ob die jüngere Generation das Werk von Beuys überhaupt verstehen kann. Aber es scheint für die Welt, die wir hier in Deutschland gerne sehen wollen, zu funktionieren. Ich bin da gar nicht so sicher.
Ich auch nicht. Andy Warhol war nämlich viel wichtiger. Also der Bezug zur Massenproduktion oder zu modernen Produktionsmethoden und gesellschaftlichen Ausformungen waren bei Warhol nach meinem Empfinden viel stärker vorhanden. Ich habe Warhol nie getroffen und auch mit Beuys waren das höchstens mal Viertelstunden-Gespräche bei irgendeiner Ausstellung oder so. Zu seinem Werk habe ich wenig Beziehung und auch zu diesem Mystizismus. Das liegt mir eigentlich nicht. Ich hatte schon eher Beziehungen zu dem, was ans Vulgäre grenzt oder ans gesellschaftlich Genormte oder da ganz abrutscht und gar nicht mehr im Bereich der Kunst ist. Diese Grenze ist für mich sehr wichtig. Wo es um die Frage geht: Hat das noch etwas damit zu tun oder nicht? An dem Punkt, an dem es auch in Werbung übergeht. Ich hatte keine Angst vor Werbung. Das war einfach die Öffnung in die anderen gesellschaftlichen Bereiche. Und zwar nicht irgendwie religiös oder geformt, das lag mir nicht.
Würden Sie sagen, dass bei Beuys die Persönlichkeit stärker gewirkt hat als sein Werk?
Das war schon beides. Was mich etwas gestört hat, war dieses sehr Deutsche. Ich habe zu unserer Vergangenheit eine sehr skeptische Position und die deutsche Mentalität ist wieder zu einer strengen Formulierung geworden. Während ich es lieber am Rande des Zerfallens habe, da, wo es in andere Bereiche übergeht und nicht mehr in der Hochkultur hängt. Von daher waren die Andy-Warhol-Geschichten lapidarer, breiter und auch plumper. Das mag ich eigentlich sehr gerne, weil es öffnet. Es öffnet so, dass man irgendwelche „silly things“ auch noch miteinbeziehen kann, die normalerweise draußen bleiben müssen, weil sie nicht zur Hochkultur gehören. Ich möchte nicht gerne so eine haargenaue Strenge haben: Wo fängt es an und wo hört es auf? Sondern ich möchte das offen lassen, weicher lassen.
Wo haben Sie Warhols Werke das erste Mal gesehen?
Das war das Erste, was ich verfolgt habe. Ich habe es bei Schmela gesehen und natürlich auch in Publikationen. Das hat mich sofort interessiert. Was er machte und wie er es machte, vor allem auch die lapidar erscheinende Form, die hier ganz und gar nicht angesagt war. Warhol hat ja auch viel Asiatisches, die „Sein“-Fragen, aber auf Amerikanisch. Asiatische Fragestellungen, zum Beispiel wie Existenzfragen in Asien gestellt werden, interessieren mich sehr. Das habe ich auch durch mein Elternhaus mitbekommen. Und dann natürlich der Maoismus. Dafür hat sich ja vor 68 keiner interessiert. Ich habe aber schon seit 64 verfolgt, was da läuft, und habe gesehen, dass gesellschaftliche Fragen auch ganz anders gehen. Dass es eben nicht entweder/oder ist wie bei uns, sondern sowohl/als auch. Das ist eine „Clutch“: Die amerikanische Kupplung ist weich. Da hängt sich der Gang weich rein. Diese harten Ja/Nein-Sachen kann ich nicht aushalten. Ich lehne sie nicht ab, ich kann sie gar nicht aushalten. Und ich finde sie auch nicht richtig. Dieses sich immer mehr verdünnende Yin, wo man nicht mehr genau weiß, wo fängt denn jetzt das Yang an? Das ist eine sehr wichtige Mentalität. Das ist meine Grundmentalität. Ich weiß gar nicht, wo ich sie herhabe, es hat auch nichts mit Duldung zu tun, sondern mit der Realität des Lebens. Das Leben ist nicht nur ein Strich, wo es richtig ist und wo es falsch ist. Sondern es ist immer noch eine kleine Toleranzzone darin. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Wann waren Sie das erste Mal in den USA?
Spät. Ich war vorher in Japan.
Wann waren Sie in Japan?
1978 war ich lange in Japan. In den USA war ich erst 1980. Ich habe dort sehr viele Freunde gehabt, aber ich war selbst nicht da. Asien hat mich eigentlich mehr interessiert.
Wie kamen Sie auf Japan?
Das kam durch meine Eltern. Die waren ja beide im Frobenius-Institut ![]() Das Frobenius-Institut ist eine 1898 durch den Ethnologen Leo Frobenius ins Leben gerufene Forschungseinrichtung, die seit 1925 mit der Goethe-Universität in Frankfurt am Main assoziiert ist. Der Schwerpunkt des Instituts liegt in der ethnologischen Erforschung des afrikanischen Kontinents sowie der südostasiatischen und südamerikanischen Länder. und haben auch Forschungsreisen nach Afrika und so weiter gemacht. Da war Asien nicht weit hergeholt. Damals habe ich mich schon für Edgar Snow
Das Frobenius-Institut ist eine 1898 durch den Ethnologen Leo Frobenius ins Leben gerufene Forschungseinrichtung, die seit 1925 mit der Goethe-Universität in Frankfurt am Main assoziiert ist. Der Schwerpunkt des Instituts liegt in der ethnologischen Erforschung des afrikanischen Kontinents sowie der südostasiatischen und südamerikanischen Länder. und haben auch Forschungsreisen nach Afrika und so weiter gemacht. Da war Asien nicht weit hergeholt. Damals habe ich mich schon für Edgar Snow ![]() Edgar Snow (1905 Kansas City, Missouri – 1972 Genf) war ein amerikanischer Journalist, der insbesondere durch den in seinem Buch „Roter Stern über China“ (1937) veröffentlichten Erfahrungsbericht über die persönliche Begegnung mit Mao Tse-tung bekannt wurde. und solche Leute interessiert. Als noch kein Mensch das für möglich hielt, das muss ich wirklich mal sagen. Die haben alle gesagt: „Ach, du spinnst doch, wir sind doch viel besser.“ Und ich konnte nicht belegen, dass wir nicht besser sind, aber ich habe irgendwie gedacht, da wird schon noch eine Überraschung kommen. Das war eigentlich eine sehr wichtige Sache, das Interesse für Asien und Amerika, und eine große Skepsis gegenüber unserer deutschen Kultur. Nach dem Dritten Reich – wer so einen Horror heraufbeschwört, der hat sie nicht mehr alle. Da muss ganz tief etwas falsch liegen, wenn man das durchziehen kann, was da durchgezogen worden ist. Und ich sage ganz offen, ich habe bis heute Probleme mit manchem, was hier gemacht wird oder gedacht wird. Ich habe ja eine Lehre als Weber gemacht und dieses Weben ist für mich eine Metapher geworden. Da habe ich gesehen: Das ist Präzision, Fläche und Komplexheit. Also in der Fläche totale Komplexheit. Ich erinnere mich, dass das einer der Ausgangspunkte mit Roehr war. Ich hatte eigentlich nie eine Beziehung zur Vertikalität, überhaupt nicht. Hochhäuser haben mich nicht interessiert, sondern nur Fläche. Fläche, Intarsie
Edgar Snow (1905 Kansas City, Missouri – 1972 Genf) war ein amerikanischer Journalist, der insbesondere durch den in seinem Buch „Roter Stern über China“ (1937) veröffentlichten Erfahrungsbericht über die persönliche Begegnung mit Mao Tse-tung bekannt wurde. und solche Leute interessiert. Als noch kein Mensch das für möglich hielt, das muss ich wirklich mal sagen. Die haben alle gesagt: „Ach, du spinnst doch, wir sind doch viel besser.“ Und ich konnte nicht belegen, dass wir nicht besser sind, aber ich habe irgendwie gedacht, da wird schon noch eine Überraschung kommen. Das war eigentlich eine sehr wichtige Sache, das Interesse für Asien und Amerika, und eine große Skepsis gegenüber unserer deutschen Kultur. Nach dem Dritten Reich – wer so einen Horror heraufbeschwört, der hat sie nicht mehr alle. Da muss ganz tief etwas falsch liegen, wenn man das durchziehen kann, was da durchgezogen worden ist. Und ich sage ganz offen, ich habe bis heute Probleme mit manchem, was hier gemacht wird oder gedacht wird. Ich habe ja eine Lehre als Weber gemacht und dieses Weben ist für mich eine Metapher geworden. Da habe ich gesehen: Das ist Präzision, Fläche und Komplexheit. Also in der Fläche totale Komplexheit. Ich erinnere mich, dass das einer der Ausgangspunkte mit Roehr war. Ich hatte eigentlich nie eine Beziehung zur Vertikalität, überhaupt nicht. Hochhäuser haben mich nicht interessiert, sondern nur Fläche. Fläche, Intarsie ![]() Die Intarsie ist eine Dekorationstechnik, bei der eine plane Fläche durch das Arrangement verschiedenfarbiger Hölzer gleichmäßig ausgestaltet wird. Typischerweise findet die Technik vor allem in der Ausarbeitung von Holzböden, Möbeln, Chorgestühlen und Flügeln Anwendung. und Komplexheit in der Fläche. Und das habe ich sofort gesellschaftlich gesehen. Als ich vor diesen Webmaschinen stand, habe ich sofort eine Stadt darin gesehen. Mit 18 hatte ich noch nicht einmal was von Los Angeles gehört, aber für mich war klar, das sind Millionen von Unter- und Überführungen. Das war so radikal, dass es alles übertroffen hat. Nach New York fahren war dagegen läppisch. Ein Stück Stoff war 60 Mal Los Angeles. Und ich habe dann gesehen, dass diese Radikalität für mich das Leben ist. Weil jeder Atemzug zählt.
Die Intarsie ist eine Dekorationstechnik, bei der eine plane Fläche durch das Arrangement verschiedenfarbiger Hölzer gleichmäßig ausgestaltet wird. Typischerweise findet die Technik vor allem in der Ausarbeitung von Holzböden, Möbeln, Chorgestühlen und Flügeln Anwendung. und Komplexheit in der Fläche. Und das habe ich sofort gesellschaftlich gesehen. Als ich vor diesen Webmaschinen stand, habe ich sofort eine Stadt darin gesehen. Mit 18 hatte ich noch nicht einmal was von Los Angeles gehört, aber für mich war klar, das sind Millionen von Unter- und Überführungen. Das war so radikal, dass es alles übertroffen hat. Nach New York fahren war dagegen läppisch. Ein Stück Stoff war 60 Mal Los Angeles. Und ich habe dann gesehen, dass diese Radikalität für mich das Leben ist. Weil jeder Atemzug zählt.
Ich muss sagen, ich war sehr einsam und war auch gerne einsam. Ich hatte gar keine Lust, mit anderen Künstlerkollegen so viel zu teilen. Schon als Kind habe ich Sven Hedin ![]() Sven Anders Hedin (1865 Stockholm – 1952 Stockholm) war ein schwedischer Geograf, Entdeckungsreisender und Schriftsteller. Die Ergebnisse seiner langjährigen Forschungsreisen durch Zentralasien bildeten die wichtigste Grundlage für den 1966 erschienenen „Central Asia Atlas“. gelesen. Eine völlig andere Welt. Natürlich Buddhismus und Lamaismus, Hinduismus, diese ganzen Sachen haben mich sehr interessiert. Übrigens konnte man auch mit Dahlem sehr gut über Hinduismus und solche Dinge sprechen. Natürlich auch über das Judentum. Wir sind ja schließlich eine Sekte. Und ich stehe zu dieser christlichen Sekte. Das ist die erste monotheistische Sicht. Die jüdische Sicht. Und das dermaßen zu Schanden zu reiten, das war wirklich unmöglich.
Sven Anders Hedin (1865 Stockholm – 1952 Stockholm) war ein schwedischer Geograf, Entdeckungsreisender und Schriftsteller. Die Ergebnisse seiner langjährigen Forschungsreisen durch Zentralasien bildeten die wichtigste Grundlage für den 1966 erschienenen „Central Asia Atlas“. gelesen. Eine völlig andere Welt. Natürlich Buddhismus und Lamaismus, Hinduismus, diese ganzen Sachen haben mich sehr interessiert. Übrigens konnte man auch mit Dahlem sehr gut über Hinduismus und solche Dinge sprechen. Natürlich auch über das Judentum. Wir sind ja schließlich eine Sekte. Und ich stehe zu dieser christlichen Sekte. Das ist die erste monotheistische Sicht. Die jüdische Sicht. Und das dermaßen zu Schanden zu reiten, das war wirklich unmöglich.
Wie ist man Ihnen, dem Deutschen, damals begegnet?
Nicht besonders. Die haben uns wahrscheinlich alle gleich eingeschätzt und ich habe mich auch nicht geoutet. Was sollte ich mich jetzt noch gegenüber Juden outen? Da muss man erst mal Beispiele setzen und nicht so viel erzählen. Und das habe ich gemacht. Mir ging das auch ein bisschen zu schnell, wie wir das alles wieder reparieren wollten. Auch die Künstler, die waren ganz schnell wieder in Ordnung. So einfach geht das nicht, das dauert. 50 Jahre dauert das.
Würden Sie sagen, dass die deutschen Künstler es in den 60er-, 70er-Jahren schwerer hatten, in den USA einen Fuß in die Tür zu bekommen, als Künstler aus anderen europäischen Ländern, weil der Kunsthandel zu großen Teilen auch in jüdischer Hand war?
Ich würde es denen nicht unterstellen. Ich kannte zum Beispiel Ileana Sonnabend ![]() Ileana Sonnabend (1914 Bukarest – 2007 New York) war eine Galeristin. Von 1932 bis 1959 lebte sie in einer Ehe mit dem Kunsthändler und Galeristen Leo Castelli. 1962 eröffnete Sonnabend eine Galerie in Paris, wo sie insbesondere auch die amerikanische Pop-Art vertrat. 1971 gründete sie eine weitere Galerie in New York und zeigte dort junge europäische Kunst. Sie stellte unter anderen aus: Georg Baselitz, Bernd und Hilla Becher, Gilbert & George, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg und Andy Warhol. sehr gut. Die habe ich schon 1966 in Paris kennengelernt, als sie noch in der Rue Mazarine war. Und da habe ich es überhaupt nicht so empfunden. Die Frage kam eigentlich gar nicht auf. Das wäre eher peinlich gewesen, so etwas überhaupt ins Spiel zu bringen. Was ich eigentlich gut fand, war, das von unten zu erleben – auch hier in Frankfurt. Da kamen ja massenhaft polnische Juden, die hier Bars aufgemacht haben und dann mit den GIs ein paar Jahre Geld verdienten. Ich habe solche Bars mal mit ausgestattet, das heißt, drei Tage Dekoration. Die haben die GIs ausgenommen und nach zehn Jahren haben sie genug Geld gehabt und sind wieder abgehauen.
Ileana Sonnabend (1914 Bukarest – 2007 New York) war eine Galeristin. Von 1932 bis 1959 lebte sie in einer Ehe mit dem Kunsthändler und Galeristen Leo Castelli. 1962 eröffnete Sonnabend eine Galerie in Paris, wo sie insbesondere auch die amerikanische Pop-Art vertrat. 1971 gründete sie eine weitere Galerie in New York und zeigte dort junge europäische Kunst. Sie stellte unter anderen aus: Georg Baselitz, Bernd und Hilla Becher, Gilbert & George, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg und Andy Warhol. sehr gut. Die habe ich schon 1966 in Paris kennengelernt, als sie noch in der Rue Mazarine war. Und da habe ich es überhaupt nicht so empfunden. Die Frage kam eigentlich gar nicht auf. Das wäre eher peinlich gewesen, so etwas überhaupt ins Spiel zu bringen. Was ich eigentlich gut fand, war, das von unten zu erleben – auch hier in Frankfurt. Da kamen ja massenhaft polnische Juden, die hier Bars aufgemacht haben und dann mit den GIs ein paar Jahre Geld verdienten. Ich habe solche Bars mal mit ausgestattet, das heißt, drei Tage Dekoration. Die haben die GIs ausgenommen und nach zehn Jahren haben sie genug Geld gehabt und sind wieder abgehauen.
Wann hat sich der internationale Kunstmarkt für die deutsche Kunst geöffnet?
Wir haben hier ein unheimliches Potenzial. Ein geistiges Potenzial oder auch ein künstlerisches Potenzial. Und dass das bemerkt worden ist, ist toll und auch gerechtfertigt. Ich sehe das vor allen Dingen in der Städelschule: Wir sind eher widersprüchlich, im positiven Sinn. Was der eine richtig findet, findet der andere total falsch. Da entsteht eine große Individualität und auch eine große Öffnung für Möglichkeiten, die eben nicht genormt sind. Und damit entsteht auch eine große Freiheit.
Können Sie sagen, wann dieses Potenzial erkannt worden ist?
Das ist mindestens mit dem ersten Kunstmarkt ![]() Auf Bestreben der Galeristen Hein Stünke und Rudolf Zwirner fand der erste Kölner Kunstmarkt unter Beteiligung von 18 Galerien vom 13. bis 17. September 1967 in den Räumen der historischen Festhalle Gürzenich statt. geschehen. Da ist bemerkt worden, dass es einfach tolle Leute gibt. Durchgesetzt hat es sich natürlich erst später. Aber ich denke, es ist ab 1970 schon international genau beobachtet worden und auch gesehen worden, dass es sehr, sehr tolle Leute gibt, ob es Reinhard Mucha ist oder wer auch immer. Das sind ganz unterschiedliche Charaktere, ganz unterschiedliche Leute, abgesehen von Polke, Richter, Lueg und so weiter. Da gab es auch kleinkariertes Zeug, das heißt kleiner Grafikkram und Gepopel. Wir haben alles, wir haben klein-klein und groß-groß und mittel-mittel. Es ist eigentlich schon gut, wie es ist.
Auf Bestreben der Galeristen Hein Stünke und Rudolf Zwirner fand der erste Kölner Kunstmarkt unter Beteiligung von 18 Galerien vom 13. bis 17. September 1967 in den Räumen der historischen Festhalle Gürzenich statt. geschehen. Da ist bemerkt worden, dass es einfach tolle Leute gibt. Durchgesetzt hat es sich natürlich erst später. Aber ich denke, es ist ab 1970 schon international genau beobachtet worden und auch gesehen worden, dass es sehr, sehr tolle Leute gibt, ob es Reinhard Mucha ist oder wer auch immer. Das sind ganz unterschiedliche Charaktere, ganz unterschiedliche Leute, abgesehen von Polke, Richter, Lueg und so weiter. Da gab es auch kleinkariertes Zeug, das heißt kleiner Grafikkram und Gepopel. Wir haben alles, wir haben klein-klein und groß-groß und mittel-mittel. Es ist eigentlich schon gut, wie es ist.
Sie haben 1967, so heißt es, aufgehört zu malen? Das war eine Zeit, als die Malerei, vor allem die figurative Malerei, wieder etwas Aufschwung bekam. Haben Sie das gesehen, dass das sozusagen gegenläufig passierte? Die Arbeiten von Richter, Polke, Lueg kannten sie. Kannten Sie auch die Malerei von Baselitz, Lüpertz und Schönebeck, von den Berlinern?
Ich fand das schon gut, aber ich habe auch gesehen, dass das nicht mein Ding ist. Ich habe mich für grafische Methoden und für Montagemethoden entschieden. Meine Position war, in einer noch analogen Zeit schon digitale Realität vorauszuspüren. Das war mir einfach klar. Das war zwar alles noch analog gemacht, aber analog, als wäre es digital. Weder das eine noch das andere Begriffselement war da. Ich habe einfach versucht, eine Art Maschinensprache zu fokussieren. Und zwar nicht, weil es sein musste, sondern weil ich davon begeistert war. Man weiß doch gar nicht, warum man etwas macht. Warum habe ich Bilder meiner Mutter mit irgendwelchen Telefonen überzogen? ![]() Thomas Bayrle, „Telefonbau – Normalzeit“, 1970.
Thomas Bayrle, „Telefonbau – Normalzeit“, 1970. 
Vor Kurzem sagten Sie in einem Interview, dass Sie, gerade in Bezug auf das Mapping, das Gefühl hatten, etwas wirklich Neues zu machen, dass es aber wenig Zuspruch von Dritten gab und Sie es daher wenig gezeigt haben. ![]() Vgl. „Artist Interview – Thomas Bayrle“, Tate Modern, London, September 2015, unter: http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/ey-exhibition-world-goes-pop/artist-interview/thomas-bayrle (eingesehen am 23.11.2016).
Vgl. „Artist Interview – Thomas Bayrle“, Tate Modern, London, September 2015, unter: http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/ey-exhibition-world-goes-pop/artist-interview/thomas-bayrle (eingesehen am 23.11.2016).
Das stimmt, man fand das total langweilig und blöd. Schwachsinn. Ich machte ja immer dasselbe. Ich habe es dann irgendwann tatsächlich auch gedacht: „Vielleicht ist das Schwachsinn.“ Aber mich hat es irgendwie begeistert. Es hat lange gedauert, bis es durchkam. Eigentlich kam es nur durch die Computerentwicklung, da war ich dann der Verrückte, der da schon vorher rumgebastelt hat.
Hatten Sie in Ihrem Umfeld Unterstützer, Dahlem zum Beispiel? Er kannte ja sicher Ihre Sachen?
Ja, der fand das gut. Wir haben uns nicht darüber unterhalten, aber wir hätten uns nicht so gut verstanden, wenn er nicht gedacht hätte, dass das schon irgendwie merkwürdiges Zeug ist. Dahlem ist zwar für Malerei zuständig, aber er war kein Apologet, dem war es völlig egal, was einer machte, wenn es nur irgendwie aus der Reihe gefallen ist. Und das hat er, glaube ich, gesehen, dass meine Arbeiten irgendwie aus der Reihe fallen. Diese Verrücktheit oder Fanatik, auf den letzten freien Fleck immer noch irgendeine Tasse oder einen Becher zu knallen. Das vollzuknallen hatte eigentlich, auch für mich selbst, etwas Zwanghaftes.
1980 war ich ein Jahr mit meiner Familie in Kalifornien. Damals haben mich Computerleute nach Palo Alto eingeladen. Die wollten mein Zeug sehen, die ganze Grafik, alles. Und da rannte immer einer hin und her, ein 25-jähriger Typ, Perl Matter, der damals schon acht Computersprachen konnte. Ein Wahnsinn. Die haben meine Arbeiten sehr begierig eingesaugt und letztendlich sind die Programme ja genauso geworden. Ich hatte später einen Studenten (Stefan Mück), dem ich dann auch geraten habe: „Studiere lieber Mathematik!“
1984 waren Sie in der Ausstellung „von hier aus“ mit einer sehr großen Arbeit vertreten. ![]() In der Ausstellung „von hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf“ (1984) zeigte Thomas Bayrle „Flugzeug“ (1982/83).
In der Ausstellung „von hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf“ (1984) zeigte Thomas Bayrle „Flugzeug“ (1982/83).  Wie haben Sie Ihr Werk im Kontext der Arbeiten anderer Künstler gesehen? Beuys hatte dort eine große Installation und Richter sagt heute, dass die Ausstellung für seinen internationalen Durchbruch sehr wichtig war.
Wie haben Sie Ihr Werk im Kontext der Arbeiten anderer Künstler gesehen? Beuys hatte dort eine große Installation und Richter sagt heute, dass die Ausstellung für seinen internationalen Durchbruch sehr wichtig war. ![]() Vgl. Gerhard Richter. Das hatte alles mit dem, womit Sie sich zu der Zeit beschäftigten, relativ wenig zu tun.
Vgl. Gerhard Richter. Das hatte alles mit dem, womit Sie sich zu der Zeit beschäftigten, relativ wenig zu tun.
Das ist richtig. Aber es war toll, dass ich es überhaupt so durchziehen konnte. Die Arbeit hat ja drei Sprünge: das ganz kleine Flugzeug, das mittlere und das größere. Und das auch noch organisch. Die Arbeit ist super wichtig gewesen. Als Kasper König das gesehen hat, hat er sofort kapiert, dass da was los ist, dass da was kommt. Das „Flugzeug“ hat eigentlich auch etwas Plumpes, total Analoges. Durch und durch analog und trotzdem schon irgendwie eine Art Aufblähung wie ein Techno-Gehirn. Es hatte so eine schöne Plumpheit, die schon etwas hat, was Digitalität auch hat, aber ohne diese Langeweile. Ich habe einfach gemerkt, da steckt wahnsinnig viel Power drin. Und wenn es einmal von Maschinen gemacht sein wird, dann erst recht.
Sie haben die Ausstellungen, in denen Sie vertreten waren, sicher auch besucht? Die „documenta 6“ 1977 war die sogenannte „Medien-documenta“. Wie sahen Sie die medienbasierte Kunst in Bezug auf Ihr eigenes Schaffen?
Ich habe eigentlich immer gesehen, dass es tolle Sachen gibt, die ich nicht machen kann. Ich habe eine technische Dimension angestrebt, aber eine, die emotional begeistert. Nach Eero Saarinen: „Wenn etwas zu hart ist, mach es härter, wenn etwas zu lang ist, mach es länger.“ ![]() Eero Saarinen (1910 Kirkkonummi, Finnland – 1961 Ann Arbor, Michigan) war ein US-amerikanischer Architekt und Designer finnischer Abstammung. Er entwarf unter anderem den international bekannten „Tulpenstuhl“ (1955), das Gebäude des Milwaukee Art Museum (1957) sowie den „Gateway Arch“ (1966) in St. Louis. Das unbelegte, aber gemeinhin Saarinen zugeschriebene Zitat lautet: „If something is too short: make it shorter. If something is too long: make it longer.“ Also das Ganze noch mal dehnen. Jetzt ist es so wahnsinnig gedehnt, das man es kaum fassen kann. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, wie weit Material ausgedehnt werden kann. Das ist wahnsinnig. Und mit welcher Geschwindigkeit! Das hatte sich alles aufgestaut.
Eero Saarinen (1910 Kirkkonummi, Finnland – 1961 Ann Arbor, Michigan) war ein US-amerikanischer Architekt und Designer finnischer Abstammung. Er entwarf unter anderem den international bekannten „Tulpenstuhl“ (1955), das Gebäude des Milwaukee Art Museum (1957) sowie den „Gateway Arch“ (1966) in St. Louis. Das unbelegte, aber gemeinhin Saarinen zugeschriebene Zitat lautet: „If something is too short: make it shorter. If something is too long: make it longer.“ Also das Ganze noch mal dehnen. Jetzt ist es so wahnsinnig gedehnt, das man es kaum fassen kann. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, wie weit Material ausgedehnt werden kann. Das ist wahnsinnig. Und mit welcher Geschwindigkeit! Das hatte sich alles aufgestaut.
Finden Sie die Zusammenstellung von großen Überblicksausstellungen wie „von hier aus“ oder „Westkunst“ ![]() „Westkunst. Zeitgenössische Kunst seit 1939“, Rheinhallen, Köln, 30. Mai – 16. August 1981. sinnvoll? „von hier aus“ hatte eigentlich kein eigenes Thema, sondern war die Antwort der Düsseldorfer auf die „Westkunst“, die vorher in Köln stattgefunden hatte. Das war eher eine politische Maßnahme, angestoßen von der Stadt. Gibt es bei diesen Großausstellungen noch einen Dialog oder sind sie vor allem nahe am Kunstmarkt dran?
„Westkunst. Zeitgenössische Kunst seit 1939“, Rheinhallen, Köln, 30. Mai – 16. August 1981. sinnvoll? „von hier aus“ hatte eigentlich kein eigenes Thema, sondern war die Antwort der Düsseldorfer auf die „Westkunst“, die vorher in Köln stattgefunden hatte. Das war eher eine politische Maßnahme, angestoßen von der Stadt. Gibt es bei diesen Großausstellungen noch einen Dialog oder sind sie vor allem nahe am Kunstmarkt dran?
Ja, das ist schwierig. Ich sehe da eigentlich den Wunsch, dass da noch was zusammengezogen wird. Das ist schon legitim. Aber ich sehe es auch nicht, wenn es keine Verbindung zwischen den Künstlern gibt. Natürlich ist irgendwie der Wunsch nach einer gewissen Herstellung von einer zusammenhängenden geistigen und materiellen Welt da. Ich habe tatsächlich das Gefühl, sobald man irgendwie falsche Vokabeln benutzt, ist es schon aus. Man kann es nicht Religion nennen, aber die Triebfeder hinter der Herstellung von 1.000 Jahren Kunst im Westen ist für mich ziemlich sicher – seit der Gotik – eine technische. Das heißt, seit der Gotik läuft das Technische auf das Fließband klar drauf zu. Es läuft auf Massenproduktion, auf Fließband und auf diversifiziertes Produzieren und Zusammenführen hin. Das heißt also, Programme, die auf die modernen Wirtschaftsprogramme zulaufen. Aber die haben natürlich die geistige Dimension, die dahinterstand, vergessen. Das ist die der Klöster. Diese Klöster müssen meiner Meinung nach wieder dazu. Wir können hier nicht einfach nur einen tollen Produktionsladen haben, ohne zu wissen wofür. Da sind diese ganzen Umweltfragen und die ganzen inhaltlichen Fragen, religiöse Fragen, moralische Fragen. Von daher verstehe ich den Wunsch, große Ausstellungen zu machen, wo versucht wird, das wieder zusammenzubringen. Aber ich muss ehrlich sagen, erstens finde ich, es gelingt nicht, und zweitens muss es auch in der Künstlerpersönlichkeit selbst stattfinden. Es ist eben eine Entscheidung, dass der Richter gesagt hat: „Ich mache dieses Fenster in Köln. Ich will das machen.“ ![]() Das aus 11.263 Farbquadraten bestehende sogenannte „Richter-Fenster“ im Südquerhaus des Kölner Doms wurde am 25. August 2007 im Rahmen einer Messfeier eingeweiht. Siehe auch: „Gerhard Richter. Zufall. Das Kölner Domfenster und 4900 Farben“, hg. vom Museum Ludwig/Metropolitankapitel der Hohen Domkirche Köln, Köln 2007. Solche Entscheidungen will ich auch treffen. Ich möchte mich damit auseinandersetzen und will wissen, was zwei Billionen Smartphones mit Jesus Christus zu tun haben. Das will ich einfach wissen. Der Papst arbeitet ja auch daran. Es ist nicht irgendein Papst, sondern es ist jemand, der in alle mögliche Scheiße reingreift. Und das ist bewundernswert und wenn er hundert Mal als Populist oder was verschrien wird.
Das aus 11.263 Farbquadraten bestehende sogenannte „Richter-Fenster“ im Südquerhaus des Kölner Doms wurde am 25. August 2007 im Rahmen einer Messfeier eingeweiht. Siehe auch: „Gerhard Richter. Zufall. Das Kölner Domfenster und 4900 Farben“, hg. vom Museum Ludwig/Metropolitankapitel der Hohen Domkirche Köln, Köln 2007. Solche Entscheidungen will ich auch treffen. Ich möchte mich damit auseinandersetzen und will wissen, was zwei Billionen Smartphones mit Jesus Christus zu tun haben. Das will ich einfach wissen. Der Papst arbeitet ja auch daran. Es ist nicht irgendein Papst, sondern es ist jemand, der in alle mögliche Scheiße reingreift. Und das ist bewundernswert und wenn er hundert Mal als Populist oder was verschrien wird.
Ich will einfach nur mal so zart eine Skizze machen. Die Skizze muss sein, dass die geistige Welt und die materielle Welt jetzt nicht per Druck oder per Hauruck-Leistungen zusammengewirbelt werden. Sie müssen zusammenwachsen. Es ist der Wahnsinn, der jetzt läuft. Ich will einfach nur warnen, dass das Ganze nicht kollabiert. Der ganze Psycho dieser medialen Realität, in der alles nur noch von drei Minuten zu drei Minuten weiterkolportiert wird, dann wieder verifiziert werden muss, um sofort ein neues Ding zu starten. Eigentlich geht es darum, dass es so großartig ist, dass wir es nicht mehr schaffen. Wir müssen darauf achten, dass wir … ich kann jetzt nicht empfehlen, in die Kirche zu gehen, weil die ja selber nicht weiß, was sie machen soll, aber ich muss so und so viele Atemzüge in der Minute machen, damit es weitergeht, ich muss essen, schlafen, trinken, ich habe diese ganzen altmodischen Sachen noch dabei. Die gehen auch nicht weg und die sollen auch nicht weggehen. Von daher sehe ich eigentlich jetzt eine Notwendigkeit, dass das zusammengeschoben wird. Der ganze Kram muss wirklich, nicht gewaltsam, sondern organisch, ineinandergeschoben werden. Von daher ist das Städel Museum total wichtig, denn es ist ein Ort, wo ich Caravaggio und von Wilhelm Leibl bis Gott weiß was alles sehen kann. Ich habe aber eben auch dieses Leben, ich muss Geld verdienen und 50 E-Mails am Tag lesen und schreiben. Dass das nicht reaktionär ausgespielt wird, was nämlich jetzt, mit diesen Flüchtlingssachen zum Beispiel, eine Gefahr ist – da kommen total reaktionäre Arschlöcher wieder raus –, sondern dass das einfach ein moderner Emulgator wird. Es muss neu emulgiert werden. Da ist, glaube ich, die Kunst selbst gefragt. Aber eben auch diese Großausstellungen. Die haben das nur selber noch nicht einmal als Ziel. Jedenfalls habe ich das Gefühl, die wissen es noch nicht. Da sind, glaube ich, auch Salben nötig. Also diese Ausdrucksweise, dass es so eine Art Materie wird, die wie Salbe oder ein bisschen härter als Salbe ist, wie zum Beispiel das Zeug bei Matthew Barney. ![]() Matthew Barney (* 1967 San Francisco) ist ein amerikanischer Künstler, dessen Arbeiten sich vornehmlich durch mythologische Thematiken sowie eine enge Verbindung installativer, performativer und filmischer Elemente auszeichnen. Das Zeug, mit dem der geschmiert hat, ist ein Emulgator. Ich will jetzt nicht durcheinander reden, aber ich meine, dass die Sachen, die jetzt getrennt sind, zusammengeschoben werden müssen, da bin ich ganz sicher.
Matthew Barney (* 1967 San Francisco) ist ein amerikanischer Künstler, dessen Arbeiten sich vornehmlich durch mythologische Thematiken sowie eine enge Verbindung installativer, performativer und filmischer Elemente auszeichnen. Das Zeug, mit dem der geschmiert hat, ist ein Emulgator. Ich will jetzt nicht durcheinander reden, aber ich meine, dass die Sachen, die jetzt getrennt sind, zusammengeschoben werden müssen, da bin ich ganz sicher.
Würden Sie sagen, dass die documenta die Aufgabe hat, Themen anzugehen? Noch in den 70er-Jahren ging es darum, Dinge wiederzuentdecken, eine Zugänglichkeit zu schaffen. Heute ist alles überall verfügbar, die Mobilität hat zugenommen, die Kanäle der Verbreitung sind zahlreicher.
Wir waren voriges Jahr ein bisschen länger in Hongkong. Da wird ein neues Museum gebaut und dann werden da erst einmal die Marktsegmente reingepackt und vorgestellt. Das ist nicht die Aufgabe der documenta. Es ist eine Emulsion nötig, ein Emulgieren, ein neues Zusammenschließen von bekannten Realitäten. Das ist sehr schwer, aber das muss sein. Die pure Vorstellung ist längst gelaufen, das läuft auf allen Märkten. Der Handel ist da und der will natürlich verkaufen, aber dafür ist die documenta nicht zuständig. Die muss eine Massageleistung bringen, die sehr, sehr schwierig ist. Es gibt ja Künstler, die das auch machen, die da auch dran sind, auch Kuratoren haben das im Sinn. Es ist nur sehr schwer, das in richtig neue Formen zu gießen. Das werden die wahrscheinlich probieren, das probiert vielleicht auch der Kasper jetzt wieder in Münster ![]() Kasper König ist seit 1977 an der Organisation der Großausstellung Skulptur-Projekte Münster, die alle zehn Jahre stattfindet, beteiligt. , aber man kann eben nicht versprechen, ob es klappt.
Kasper König ist seit 1977 an der Organisation der Großausstellung Skulptur-Projekte Münster, die alle zehn Jahre stattfindet, beteiligt. , aber man kann eben nicht versprechen, ob es klappt.
An der Städelschule hatten Sie sehr engen Kontakt mit Kasper König, Gerhard Richter war – wenn auch nur kurz – als Professor an der Schule und auch Per Kirkeby. ![]() Von 1989 bis 2000 leitete Kasper König als Direktor die Städelschule in Frankfurt am Main. Per Kirkeby war dort von 1989 bis 2000 als Professor tätig und Gerhard Richter war 1988 als Gastprofessor an der Frankfurter Kunstakademie. Dass die Professoren auf die Karrieren der Nachwuchsgenerationen erheblichen Einfluss haben, ist eine Entwicklung, die man vor allem in Deutschland beobachten kann.
Von 1989 bis 2000 leitete Kasper König als Direktor die Städelschule in Frankfurt am Main. Per Kirkeby war dort von 1989 bis 2000 als Professor tätig und Gerhard Richter war 1988 als Gastprofessor an der Frankfurter Kunstakademie. Dass die Professoren auf die Karrieren der Nachwuchsgenerationen erheblichen Einfluss haben, ist eine Entwicklung, die man vor allem in Deutschland beobachten kann.
Es ist wirklich ein toller Glücksfall gewesen. Ich hatte das schon vorbereitet, bevor König kam, indem ich da ziemlich viele Leute eingeladen habe. Damals konnte man das noch einfach über Einladungen machen. In dem Fall war es eben eine kleine Schule, es waren total verschiedene Charaktere und auch verschiedene Vorstellungen, aber es konnte eine Emulsion gemischt werden: Und zwar eben einfach durch die Kleinheit und durch die Extremheit. Ich weiß, dass man bei uns am Tisch Sachen sagen konnte, die woanders unmöglich gewesen wären. Zum Beispiel bei Prüfungen, ich denke an Kirkeby, wie der nach der 300. Arbeit sagte: „Ach, wenn doch mal endlich einer einen Blumenstrauß malen würde.“ Das ist so schön gewesen, dass jeder seine Skepsis, seine Launen und auch seine Utopie da reinbringen und die dann auch durchziehen konnte. Jeder hat es halt gemacht, wie er konnte. Es ist wahrscheinlich schwer, so etwas immer durchzuhalten, aber es ist auf jeden Fall das kleine Modell, was auch jetzt in Hamburg versucht wird. Andreas Slominski ![]() Andreas Slominski (* 1959 Meppen) ist ein Maler und Objektkünstler, der insbesondere durch seine „Fallen-Objekte“ bekannt wurde. Nachdem er sieben Jahre als Professor an der Kunstakademie Karlsruhe gelehrt hatte, übernahm er 2004 die Klasse für Bildhauerei an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. macht das ziemlich klug. Dass eine umfassende Individualität mit einer umfassenden Strukturwelt in ganz bestimmte einfache, verschraubte Formen gebracht wird.
Andreas Slominski (* 1959 Meppen) ist ein Maler und Objektkünstler, der insbesondere durch seine „Fallen-Objekte“ bekannt wurde. Nachdem er sieben Jahre als Professor an der Kunstakademie Karlsruhe gelehrt hatte, übernahm er 2004 die Klasse für Bildhauerei an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. macht das ziemlich klug. Dass eine umfassende Individualität mit einer umfassenden Strukturwelt in ganz bestimmte einfache, verschraubte Formen gebracht wird.
Und dann sind die natürlich alle allein, die sind alle allein. Jedem erzählt man was anderes und man macht auch Fehler, aber wichtig ist, dass man ehrlich ist. Also wirklich ehrlich. Und dass man sieht, es gibt 100-prozentig voneinander verschiedene Möglichkeiten, der eine macht es wirklich 100 Prozent anders wie der andere, also, dass es hochindividuell ist und dass auch die Empfehlungen hochindividuell und total widersprüchlich sein können. Ich bin überzeugt, dass jemand wie Tobias Rehberger das auch hervorragend macht, auf eine ganz andere Art, oder einer wie Michael Krebber. ![]() Michael Krebber (* 1954 Köln) war von 2002 bis 2016 Professor für Malerei an der Städelschule in Frankfurt am Main. Tobias Rehberger (* 1966 Esslingen) ist ebenda seit 2001 Professor für Bildhauerei.
Michael Krebber (* 1954 Köln) war von 2002 bis 2016 Professor für Malerei an der Städelschule in Frankfurt am Main. Tobias Rehberger (* 1966 Esslingen) ist ebenda seit 2001 Professor für Bildhauerei.
An sich ist die deutsche Akademie schon noch eine tolle Sache, glaube ich. Die Städelschule war eine supertolle Sache und die hatten wir dem Kasper zu verdanken. Der war in Hochform, als er kam, und er hat es mit einer Stadt zu tun gehabt, die total wabbelig, weich war und für seine Vorstellung zugänglich. Die haben ja alles gemacht, was er wollte. Wir kannten uns seit 1970. In Köln hat er in der Galerie Tobiès & Silex mal eine Arbeit von mir gekauft. Schon damals fand ich, dass er eine gute Persönlichkeit war. Auch dieses Sprunghafte, das er hatte. Und dann haben wir uns immer mal wieder getroffen und mir war ganz klar, an die Städelschule muss jemand wie er, wenn sich wirklich mal was ändern soll. Ich kannte den Hilmar Hoffmann ![]() Hilmar Hoffmann (* 1925 Bremen) ist ein deutscher Kulturpolitiker. Er war von 1970 bis 1990 Kulturstadtrat in Frankfurt am Main. gut und der war auf dem Ohr hellhörig. Ich bin kein Manager, aber ich habe einfach gesehen: jetzt oder nie. Und habe es wirklich auch vorangetrieben, dass es sich radikal änderte. Es waren schon gute Leute da und auch verträglich und liebevoll und alles, aber es reichte nicht. Es musste etwas passieren. Und es war sowieso eine Aufbruchsstimmung hier in der Stadt. Ich weiß noch, wie das mit dem Portikus losging. Manfred Stumpf
Hilmar Hoffmann (* 1925 Bremen) ist ein deutscher Kulturpolitiker. Er war von 1970 bis 1990 Kulturstadtrat in Frankfurt am Main. gut und der war auf dem Ohr hellhörig. Ich bin kein Manager, aber ich habe einfach gesehen: jetzt oder nie. Und habe es wirklich auch vorangetrieben, dass es sich radikal änderte. Es waren schon gute Leute da und auch verträglich und liebevoll und alles, aber es reichte nicht. Es musste etwas passieren. Und es war sowieso eine Aufbruchsstimmung hier in der Stadt. Ich weiß noch, wie das mit dem Portikus losging. Manfred Stumpf ![]() Manfred Stumpf (* 1957 Alsfeld) ist ein deutscher Konzeptkünstler. Er studierte ab 1976 bei Thomas Bayrle an der Städelschule in Frankfurt, ab 1978 bei Hans Haake an der Cooper Union in New York und ab 1979 bei Bazon Brock an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Seit 1995 lehrt er als Professor des Studiengangs Visuelle Kommunikation an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. und ich, wir haben das sozusagen vorgeschlagen, wir sind da vorbeigefahren und haben gesagt, da müsste man was dahinter bauen, das wäre das Beste. Das haben wir dem Kasper gesagt und er war sofort dafür. Innerhalb von einer halben Stunde war er überzeugt. Und dann ging es um die Architektur. Es gab ja Richard Meier und andere Superstars, die alle schon wahnsinnig viel Geld kosteten. Da habe ich gefragt: „Soll der Architekt jetzt drei- oder viermal so viel kosten wie der Portikus?“ Damals saß die Marie-Theres Deutsch dabei, eine Absolventin der Städelschule, und ich sagte: „Nimm doch die Frau!“ Und Kasper hat es gemacht. Die hatte bis dahin noch nichts gebaut. Das Ganze hat kaum etwas gekostet. Und so konnten die Ideen umgesetzt werden. Der Portikus mit den wechselnden Kuratoren war wirklich ein neues Modell, was heute natürlich in vielen Fällen kopiert wird oder ähnlich gemacht wird. Ich glaube nicht, dass man so etwas noch mal herstellen kann. Jetzt ist es viel komplexer und auch diffuser. Es wird sehr auf die einzelnen Künstler ankommen, die sich in einem unglaublich umfassenden Sinne als Unternehmer darstellen müssen, wenn sie wirklich was durchziehen wollen. Also ich denke, um es vielleicht abschließend zu sagen, eigentlich ist man eine ziemlich wabbelige Flasche. Aber ein paar Sachen will man durchziehen. Und die müssen durchgedrückt werden, mit viel Geduld und viel Energie. Es geht nicht um Show, sondern darum, dass man Millimeter für Millimeter etwas vorwärts drückt. Deswegen bin ich auch für stille Sachen und für langfristige Entwicklungen. Auf jeden Fall! „Long distance“!
Manfred Stumpf (* 1957 Alsfeld) ist ein deutscher Konzeptkünstler. Er studierte ab 1976 bei Thomas Bayrle an der Städelschule in Frankfurt, ab 1978 bei Hans Haake an der Cooper Union in New York und ab 1979 bei Bazon Brock an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Seit 1995 lehrt er als Professor des Studiengangs Visuelle Kommunikation an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. und ich, wir haben das sozusagen vorgeschlagen, wir sind da vorbeigefahren und haben gesagt, da müsste man was dahinter bauen, das wäre das Beste. Das haben wir dem Kasper gesagt und er war sofort dafür. Innerhalb von einer halben Stunde war er überzeugt. Und dann ging es um die Architektur. Es gab ja Richard Meier und andere Superstars, die alle schon wahnsinnig viel Geld kosteten. Da habe ich gefragt: „Soll der Architekt jetzt drei- oder viermal so viel kosten wie der Portikus?“ Damals saß die Marie-Theres Deutsch dabei, eine Absolventin der Städelschule, und ich sagte: „Nimm doch die Frau!“ Und Kasper hat es gemacht. Die hatte bis dahin noch nichts gebaut. Das Ganze hat kaum etwas gekostet. Und so konnten die Ideen umgesetzt werden. Der Portikus mit den wechselnden Kuratoren war wirklich ein neues Modell, was heute natürlich in vielen Fällen kopiert wird oder ähnlich gemacht wird. Ich glaube nicht, dass man so etwas noch mal herstellen kann. Jetzt ist es viel komplexer und auch diffuser. Es wird sehr auf die einzelnen Künstler ankommen, die sich in einem unglaublich umfassenden Sinne als Unternehmer darstellen müssen, wenn sie wirklich was durchziehen wollen. Also ich denke, um es vielleicht abschließend zu sagen, eigentlich ist man eine ziemlich wabbelige Flasche. Aber ein paar Sachen will man durchziehen. Und die müssen durchgedrückt werden, mit viel Geduld und viel Energie. Es geht nicht um Show, sondern darum, dass man Millimeter für Millimeter etwas vorwärts drückt. Deswegen bin ich auch für stille Sachen und für langfristige Entwicklungen. Auf jeden Fall! „Long distance“!
Kasper König hat seine Kollegen damals sehr in diese Sachen miteinbezogen?
Doch, das hat er. Das war damals wirklich eine richtige Familie. Der hat alle einbezogen: Raimer Jochims, Christa Näher und Peter Kubelka, der damals Direktor war und dann gesagt hat: „Ich trete freiwillig zurück, wenn der König das Amt übernehmen will.“
Sie haben 1970 ein interessantes Buch mitherausgegeben: „Sexfront“ ![]() Günter Amendt, „Sexfront“, Frankfurt am Main 1970. Thomas Bayrle war vor allem an der grafischen Gestaltung des Buchs beteiligt. .
Günter Amendt, „Sexfront“, Frankfurt am Main 1970. Thomas Bayrle war vor allem an der grafischen Gestaltung des Buchs beteiligt. .
Ich kannte Günter Amendt und ich kannte den Verlag, weil ich da selber schon eine Arbeit gemacht hatte. Und dann habe ich gedacht: „Das ist ja super, wenn die was für Schulen machen, mache ich mit.“
Das war von Anfang an als Lehrbuch konzipiert?
Das war für die Schule, ja. Das war der Wahnsinn, das Land Hessen war damals so frei, dass die gesagt haben: Wir machen eine Publikation für Sexerziehung, Sexaufklärung, aber eine ganz freie. Das hat das Land Hessen dann verteilt. Solche Sachen haben mich immer interessiert, mit Gruppen zu arbeiten, wo etwas passiert. Also auch in politischen Zusammenhängen etwas zu machen. Das war so frisch, das war wirklich toll. Das Ganze war eine private Initiative vom März Verlag und von Günter Amendt, aber die haben es dem Land Hessen so serviert, dass sie es verteilt haben.
Hatten Sie eigentlich irgendwelche Beziehungen in die DDR?
Nein, eigentlich gar nicht. Ich hatte Probleme mit dem sowjetischen Muster des Kommunismus. Mich hat das chinesische Modell interessiert.
Waren Sie damals in Berlin? Kannten Sie zum Beispiel René Block ![]() René Block (* 1942 Velbert) ist ein deutscher Galerist und Kurator, der zu den wichtigsten Vermittlern der deutschen Nachkriegskunst zählt. Anfang 1964 eröffnete er in Berlin das Grafische Cabinet René Block, aus dem noch im gleichen Jahr die Galerie René Block hervorging. Dort zeigte er bis 1979 unter anderem Ausstellungen und Aktionen von Joseph Beuys, Bazon Brock, Stanley Brouwn, Sigmar Polke, Gerhard Richter und Wolf Vostell. In den Folgejahren organisierte René Block als Kurator zahlreiche Ausstellungen für die daadgalerie in Berlin sowie für das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) in Stuttgart, bevor er 1997 die Direktion des Fridericianums in Kassel übernahm. Seit 2008 führt René Block die auf Editionen spezialisierte Galerie Edition Block in Berlin. ?
René Block (* 1942 Velbert) ist ein deutscher Galerist und Kurator, der zu den wichtigsten Vermittlern der deutschen Nachkriegskunst zählt. Anfang 1964 eröffnete er in Berlin das Grafische Cabinet René Block, aus dem noch im gleichen Jahr die Galerie René Block hervorging. Dort zeigte er bis 1979 unter anderem Ausstellungen und Aktionen von Joseph Beuys, Bazon Brock, Stanley Brouwn, Sigmar Polke, Gerhard Richter und Wolf Vostell. In den Folgejahren organisierte René Block als Kurator zahlreiche Ausstellungen für die daadgalerie in Berlin sowie für das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) in Stuttgart, bevor er 1997 die Direktion des Fridericianums in Kassel übernahm. Seit 2008 führt René Block die auf Editionen spezialisierte Galerie Edition Block in Berlin. ?
Ich bin eigentlich, wenn überhaupt, zu René Block und habe da zum Beispiel KP Brehmer getroffen. Der hat mich interessiert. Aber viel war ich nicht in Berlin. Es gab auch zur Edition Staeck, das heißt zu Klaus Staeck ![]() Klaus Staeck (* 1938 Pulsnitz) ist gelernter Grafikdesigner und Jurist. In seinen künstlerischen Arbeiten beschäftigt er sich insbesondere mit der politischen Karikatur. 1965 gründete er den Verlag Edition Tangente, aus dem 1972 die Edition Staeck hervorging. Neben eigenen Arbeiten verlegt Staeck dort auch Editionen anderer Künstler, unter anderem von Thomas Bayrle, Joseph Beuys, Marcel Broodthaers, Hanne Darboven, A.R. Penck und Sigmar Polke. Von 2006 bis 2015 war Staeck Präsident der Akademie der Künste in Berlin. nach Heidelberg, Verbindungen. Also, es gab schon bestimmte Stellen, aber eigentlich war die Hauptorientierung das Rheinland.
Klaus Staeck (* 1938 Pulsnitz) ist gelernter Grafikdesigner und Jurist. In seinen künstlerischen Arbeiten beschäftigt er sich insbesondere mit der politischen Karikatur. 1965 gründete er den Verlag Edition Tangente, aus dem 1972 die Edition Staeck hervorging. Neben eigenen Arbeiten verlegt Staeck dort auch Editionen anderer Künstler, unter anderem von Thomas Bayrle, Joseph Beuys, Marcel Broodthaers, Hanne Darboven, A.R. Penck und Sigmar Polke. Von 2006 bis 2015 war Staeck Präsident der Akademie der Künste in Berlin. nach Heidelberg, Verbindungen. Also, es gab schon bestimmte Stellen, aber eigentlich war die Hauptorientierung das Rheinland.
Editionen entstanden in den 60er-, 70er-Jahren nicht nur bei Block und Staeck, sondern auch viele Galerien begannen Editionen aufzulegen. Gehörte diese Entwicklung zum kulturpolitischen Programm „Kunst für alle“?
Ich habe das ja richtig forciert, auch über die Preise. Ich habe versucht, Massenauflagen so billig zu machen, dass es Studenten kaufen konnten. Meine „Mäntel“ ![]() Thomas Bayrle, „Mantel“, Multiple in verschiedenen Farben, 1968.
Thomas Bayrle, „Mantel“, Multiple in verschiedenen Farben, 1968. 
![]() Im Januar 1968 eröffneten Paul Maenz und Peter Roehr im Frankfurter Holzgraben 9 das Ladengeschäft Pudding-Explosion, das mit einem Sortiment von Comics, Haschpfeifen, Postern und Zeitungen als erster Head-Shop in Frankfurt am Main gilt. bei Maenz war das drin. Das waren Sachen, die demokratisch verkauft werden konnten oder sollten. Was natürlich im Kunsthandel ganz schlecht ankam, weil man da viel zu billig war und überall Editionen mitgemacht hat, die erst jetzt nach 50 Jahren was sind, damals war das fast Wegwerfzeug.
Im Januar 1968 eröffneten Paul Maenz und Peter Roehr im Frankfurter Holzgraben 9 das Ladengeschäft Pudding-Explosion, das mit einem Sortiment von Comics, Haschpfeifen, Postern und Zeitungen als erster Head-Shop in Frankfurt am Main gilt. bei Maenz war das drin. Das waren Sachen, die demokratisch verkauft werden konnten oder sollten. Was natürlich im Kunsthandel ganz schlecht ankam, weil man da viel zu billig war und überall Editionen mitgemacht hat, die erst jetzt nach 50 Jahren was sind, damals war das fast Wegwerfzeug.
Wenn man „Kunst für alle“ macht und ein „Mantel“ im Kaufhaus 27 D-Mark kostet, braucht man ja eigentlich keine limitierte Auflage, oder?
Das war ja eigentlich auch nur eine Not. Die Produktionskosten waren so hoch – die Mäntel wurden in Aschaffenburg in einer Fabrik gemacht –, dass man das gerade zahlen konnte. Das war eigentlich auch nur als Beispiel gedacht und nicht als echte Massenproduktion, die mir natürlich am liebsten gewesen wäre. Aber als künstlerischer Beitrag war es eben nur ein Beispiel. Eine Setzung.
Auch nicht signiert?
Doch, später in den Galerien waren sie signiert. Da gab es dann schon eine Spaltung, weil die Galerie gesagt hat: „Könntest du mir die nicht signieren, die bei mir verkauft werden?“ Aber es ist eigentlich eine Mischform gewesen, in die Breite und ins Elitäre. In beiden Teilen war man drin und natürlich dementsprechend auch inkonsequent.
Über Peter Iden ![]() Peter Iden (* 1938 Meseritz, Posen, heute Polen) ist ein deutscher Kunst- und Theaterkritiker. Nach seinem Studium der Philosophie, Geschichte und Theaterwissenschaften war er als Redakteur für die „Frankfurter Rundschau“ tätig. Von 1993 bis 2000 leitete er das Feuilleton der Zeitung. 1966 gehörte Iden zu den Mitbegründern des internationalen Theaterfestivals Experimenta in Frankfurt am Main, das er 1972 als Teil des Organisationskomitees in die „documenta 5“ einbrachte. Zwischen 1978 und 1987 leitete er als Gründungsdirektor den Aufbau des Museums für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt am Main. Iden setzte sich besonders für den Erwerb eines Teilkonvoluts der Sammlung Ströher ein, was im Jahr 1981 gelang; dieses Konvolut bildet bis heute den Grundstock der Sammlung des MMK. Als Professor lehrte Iden von 1982 bis 2006 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Publikationen, darunter „Gesellschaft – was ist das? Szenen aus dem zeitgenössischen Leben“ (1985), „Bilder für Frankfurt. Bestandskatalog des Museums für Moderne Kunst“ (1985) und „Peter Palitzsch. Theater muss die Welt verändern“ (2005). haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie wichtig war seine Rolle hier in Frankfurt?
Peter Iden (* 1938 Meseritz, Posen, heute Polen) ist ein deutscher Kunst- und Theaterkritiker. Nach seinem Studium der Philosophie, Geschichte und Theaterwissenschaften war er als Redakteur für die „Frankfurter Rundschau“ tätig. Von 1993 bis 2000 leitete er das Feuilleton der Zeitung. 1966 gehörte Iden zu den Mitbegründern des internationalen Theaterfestivals Experimenta in Frankfurt am Main, das er 1972 als Teil des Organisationskomitees in die „documenta 5“ einbrachte. Zwischen 1978 und 1987 leitete er als Gründungsdirektor den Aufbau des Museums für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt am Main. Iden setzte sich besonders für den Erwerb eines Teilkonvoluts der Sammlung Ströher ein, was im Jahr 1981 gelang; dieses Konvolut bildet bis heute den Grundstock der Sammlung des MMK. Als Professor lehrte Iden von 1982 bis 2006 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Publikationen, darunter „Gesellschaft – was ist das? Szenen aus dem zeitgenössischen Leben“ (1985), „Bilder für Frankfurt. Bestandskatalog des Museums für Moderne Kunst“ (1985) und „Peter Palitzsch. Theater muss die Welt verändern“ (2005). haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie wichtig war seine Rolle hier in Frankfurt?
Der ist für mich eigentlich sehr wichtig gewesen. Peter Iden und Hanno Reuther ![]() Hanno Reuther (* 1934) ist ein deutscher Kunstkritiker und Rundfunkautor, der bis 1967 für die „Frankfurter Rundschau“ tätig war und anschließend die Sendung „Kritisches Tagebuch“ im WDR mitbegründete. waren zwei gute Kritiker. Beide schrieben für die „Frankfurter Rundschau“ und mit denen konnte man, vor allem auch mit Iden, vernünftig reden. Der war auch mit Bazon Brock befreundet. Ich habe öfter für die „Rundschau“ gearbeitet, auch Briefe aus Amerika
Hanno Reuther (* 1934) ist ein deutscher Kunstkritiker und Rundfunkautor, der bis 1967 für die „Frankfurter Rundschau“ tätig war und anschließend die Sendung „Kritisches Tagebuch“ im WDR mitbegründete. waren zwei gute Kritiker. Beide schrieben für die „Frankfurter Rundschau“ und mit denen konnte man, vor allem auch mit Iden, vernünftig reden. Der war auch mit Bazon Brock befreundet. Ich habe öfter für die „Rundschau“ gearbeitet, auch Briefe aus Amerika ![]() Siehe u. a.: Thomas Bayrle, „Lebenszeichen aus San Francisco“, in: „Frankfurter Rundschau“, 15.11.1980, S. 3; Thomas Bayrle, „Weitere Lebenszeichen aus Amerika“, in: „Frankfurter Rundschau“, 21.02.1981, S. 3. geschickt und so weiter, das haben die dann veröffentlicht. Iden ist auf jeden Fall eine integre Figur gewesen.
Siehe u. a.: Thomas Bayrle, „Lebenszeichen aus San Francisco“, in: „Frankfurter Rundschau“, 15.11.1980, S. 3; Thomas Bayrle, „Weitere Lebenszeichen aus Amerika“, in: „Frankfurter Rundschau“, 21.02.1981, S. 3. geschickt und so weiter, das haben die dann veröffentlicht. Iden ist auf jeden Fall eine integre Figur gewesen.
Mir ist aufgefallen, dass Ihre Reisen in Ihrem sogenannten „Lebenslauf“ gar keine Erwähnung finden.
Die Reisen? Die waren sehr wichtig und die waren ja auch lang: 1980 ein Jahr San Francisco. 1978 Japan. Da habe ich in mehreren Universitäten unterrichtet. Das Letzte war ein halbes Jahr in Yamagata. Da hatte ich in Kōriyama im Museum die Ausstellung, die der Florian Waldvogel eingerichtet hat. ![]() „Retrospektive – Thomas Bayrle“, Kōriyama City Museum of Art, 1997. Das Material habe ich spätestens ab 1965 gesammelt. Auf jeden Fall ist das für mich nach wie vor wichtig, diese Vorstellung von Welt: Die Chinesen sind ja die Einzigen, die ohne Gott auskommen. Konfuzius, ihre Philosophie, ist ihr Gott. Das ist doch interessant, dass die einfach mit Laotse und Konfuzius und so weiter klarkommen. Sie haben eigentlich keine Gottesvorstellung, auch wenn dort mal der Buddhismus war. Aber der Buddhismus ist aus Indien gekommen und hat wenig mit der chinesischen Philosophie zu tun. Die Gottesvorstellungen haben sehr viele Kriege nach sich gezogen. Das erleben wir ja jetzt wieder. Und wenn das so läuft, ist es ja besser, man hat keinen Gott. Der Konfuzianismus ist eine Ordnungslehre im Gegensatz zu Laotse, was eine Naturlehre ist. Und die haben die Kombination aus beidem. Das ist das Tolle, dass der Naturbegriff und der Ordnungsbegriff in einem organischen Muster, eben in diesem Yin und Yang, prima über Tausende Jahre leben konnten. Das ist eigentlich bis heute der Fall. Heute kommt noch die Technik dazu. Das ist Weltkultur, das ist ganz klar, und es ist Weltproblem, das ist auch ganz klar. Das kann nicht nur ein Kontinent lösen. Von daher spielen wir schon eine große Rolle, auch unsere deutsche Philosophie, weil sie einfach auch von der Mechanik her unheimlich toll ist. Das sind nicht nur unsere mechanischen Betriebe, sondern auch die Denke, die in Deutschland entwickelt worden ist. Es ist schon fantastisch. Das Ganze muss in einem größeren Zusammenhang und Gebäude zusammenfließen, wenn es kein Chaos geben soll.
„Retrospektive – Thomas Bayrle“, Kōriyama City Museum of Art, 1997. Das Material habe ich spätestens ab 1965 gesammelt. Auf jeden Fall ist das für mich nach wie vor wichtig, diese Vorstellung von Welt: Die Chinesen sind ja die Einzigen, die ohne Gott auskommen. Konfuzius, ihre Philosophie, ist ihr Gott. Das ist doch interessant, dass die einfach mit Laotse und Konfuzius und so weiter klarkommen. Sie haben eigentlich keine Gottesvorstellung, auch wenn dort mal der Buddhismus war. Aber der Buddhismus ist aus Indien gekommen und hat wenig mit der chinesischen Philosophie zu tun. Die Gottesvorstellungen haben sehr viele Kriege nach sich gezogen. Das erleben wir ja jetzt wieder. Und wenn das so läuft, ist es ja besser, man hat keinen Gott. Der Konfuzianismus ist eine Ordnungslehre im Gegensatz zu Laotse, was eine Naturlehre ist. Und die haben die Kombination aus beidem. Das ist das Tolle, dass der Naturbegriff und der Ordnungsbegriff in einem organischen Muster, eben in diesem Yin und Yang, prima über Tausende Jahre leben konnten. Das ist eigentlich bis heute der Fall. Heute kommt noch die Technik dazu. Das ist Weltkultur, das ist ganz klar, und es ist Weltproblem, das ist auch ganz klar. Das kann nicht nur ein Kontinent lösen. Von daher spielen wir schon eine große Rolle, auch unsere deutsche Philosophie, weil sie einfach auch von der Mechanik her unheimlich toll ist. Das sind nicht nur unsere mechanischen Betriebe, sondern auch die Denke, die in Deutschland entwickelt worden ist. Es ist schon fantastisch. Das Ganze muss in einem größeren Zusammenhang und Gebäude zusammenfließen, wenn es kein Chaos geben soll.
Wir müssen in der Zeit noch einmal etwas zurück: 1969 wird in der Zeitschrift „Egoist“ ![]() Vgl. „Egoist 16“, Heft 1, 1969, S. 18. aufgeführt, dass Werke von Ihnen in der Sammlung des MoMA und des Stedelijk Museum sind.
Vgl. „Egoist 16“, Heft 1, 1969, S. 18. aufgeführt, dass Werke von Ihnen in der Sammlung des MoMA und des Stedelijk Museum sind.
Da gibt es ein paar Grafiken, ja.
Wie sind die dort 1969 hingekommen?
Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall nicht durch mein Zutun! Das lief irgendwie durchs Stedelijk und die Ausstellung „Schrift und Bild“ ![]() „Schrift und Bild“, unter anderem Stedelijk Museum, Amsterdam, 03. Mai – 10. Juni 1963. , die der damalige Direktor Willem Sandberg gemacht hat. Das sind ein paar Bücher und Grafiken, die alle mit Schrift zu tun haben. Ich habe damals viel Grafik gemacht und habe das an Verlage gegeben und die Verlage haben sie weiterverkauft. Das sind einfach ein paar Blätter, die hat das MoMA schon frühzeitig gehabt und sie haben auch immer ein bisschen weitergesammelt. Aber etwas Richtiges ist da immer noch nicht passiert. Ich mache nächstes Jahr eine Ausstellung im ICA Miami,
„Schrift und Bild“, unter anderem Stedelijk Museum, Amsterdam, 03. Mai – 10. Juni 1963. , die der damalige Direktor Willem Sandberg gemacht hat. Das sind ein paar Bücher und Grafiken, die alle mit Schrift zu tun haben. Ich habe damals viel Grafik gemacht und habe das an Verlage gegeben und die Verlage haben sie weiterverkauft. Das sind einfach ein paar Blätter, die hat das MoMA schon frühzeitig gehabt und sie haben auch immer ein bisschen weitergesammelt. Aber etwas Richtiges ist da immer noch nicht passiert. Ich mache nächstes Jahr eine Ausstellung im ICA Miami, ![]() „Thomas Bayrle“, Institute of Contemporary Art, Miami, 29. November 2016 – 15. Februar 2017. vielleicht passiert dann mal etwas. Auf jeden Fall habe ich auf der Sammlerebene keine großen Sprünge in Amerika gemacht.
„Thomas Bayrle“, Institute of Contemporary Art, Miami, 29. November 2016 – 15. Februar 2017. vielleicht passiert dann mal etwas. Auf jeden Fall habe ich auf der Sammlerebene keine großen Sprünge in Amerika gemacht.
Glauben Sie, das hat etwas mit der amerikanischen Pop-Art zu tun? Dass man für Ihr Werk dort vielleicht weniger sensibel ist? Wird das verwechselt?
Es ist schon ein komisches Zeug, mein Werk, was nicht so richtig in die Muster reinpasst. Erst war es der Expressionismus in Amerika, dann hatten die lange ein konservatives Bild von Deutschland und dann kamen Richter und Polke und eine große Welle von deutschen Künstlern. In dieser Welle war ich nie drin. Ich habe ja auch schon lange die Galerie Gavin Brown dort, mit dem arbeite ich seit über 15 Jahren zusammen. Ich glaube, es ist im Kommen, aber es ist jetzt nicht die große Nummer. Das kann man nicht sagen.
Es ist vielleicht ein bisschen wie mit Blinky Palermo …
Palermo ist einmalig. Der ist eigentlich ein total amerikanischer Künstler gewesen, auch von seiner Mentalität her. Ich habe ihn ganz gut gekannt. In der Zeit, als hier die Ausstellung über „Beuys und seine Schüler“ ![]() „Mit, neben, gegen … Joseph Beuys und seine Schüler“, Frankfurter Kunstverein, Steinernes Haus am Römerberg, Frankfurt am Main, 05. November 1976 – 01. Februar 1977. war und die sechs Wochen lang probiert und gestritten haben, sodass Beuys die Auseinandersetzungen um das Gesicht der Ausstellung am Ende als produktiven Prozess ausgestellt hat, war ich öfter mit Palermo am Frankfurter Hauptbahnhof. Der saß dann still in seinem roten Blazer in einer Bar, in der nur Schwarze verkehrten. Wir haben Bier getrunken und kaum ein Wort gesprochen. Das war ähnlich wie mit Cage auf der Treppe. So etwas hatte ich öfter.
„Mit, neben, gegen … Joseph Beuys und seine Schüler“, Frankfurter Kunstverein, Steinernes Haus am Römerberg, Frankfurt am Main, 05. November 1976 – 01. Februar 1977. war und die sechs Wochen lang probiert und gestritten haben, sodass Beuys die Auseinandersetzungen um das Gesicht der Ausstellung am Ende als produktiven Prozess ausgestellt hat, war ich öfter mit Palermo am Frankfurter Hauptbahnhof. Der saß dann still in seinem roten Blazer in einer Bar, in der nur Schwarze verkehrten. Wir haben Bier getrunken und kaum ein Wort gesprochen. Das war ähnlich wie mit Cage auf der Treppe. So etwas hatte ich öfter.
Menschen, mit denen Sie …
… ja, mit denen man irgendwie zusammen gesessen hat oder zusammen geredet hat oder nur zusammen geschwiegen hat und das über Stunden und Tage. Das war mit Palermo auch so. Der hat sich nämlich so geödet hier mit dem Streit, den die dauernd hatten: aufhängen, abhängen, abhängen, aufhängen. Das hat er nicht mitgemacht und ist einfach verschwunden. Das war ein paar Jahre vor seinem Tod. Er war eigentlich ein sehr Schweigsamer.
Inwiefern beziehen Sie sich mit Ihren „Glücksklee-Dosen“ ![]() Thomas Bayrle, „Glücksklee-Dose“, 1969.
Thomas Bayrle, „Glücksklee-Dose“, 1969. 
Die beziehen sich auf Warhol! Ja! Die „Glücksklee-Dose“ gab es ja vorher in doppelter Größe, das war 1969. Die war auch noch auf dem ersten Kunstmarkt in Basel und auf der Rückfahrt habe ich sie auf den Müll gefahren. Ich hatte sie im Auto und die war so lang, dass sie vorne und hinten überhing. In der Nähe von Karlsruhe habe ich einfach Kurzschluss gemacht und habe sie auf den Müll gefahren. Aber die Dosen waren auf jeden Fall ein Bezug zu Warhol.
Was war Ihr Anliegen? Inhaltlich sind es ganz unterschiedliche Dimensionen.
Es war eigentlich so: Die Werbeagentur Thompson hat mich 69 gefragt, ob ich nicht was für Glücksklee machen wollte. Dann habe ich denen eine Grafik gemacht: Glückskleedosen aus Glückskleedosen, davon gab es acht Abzüge. Und dann habe ich mir gesagt: „Ich würde die gerne plastisch haben.“ Einfach für mich als Arbeit. Das hatte mit Warhol wiederum nichts zu tun, ich habe die Grafik einfach zum Anlass genommen, eine Skulptur zu machen. Das war die große Milchdose, dunkelrot, die gibt es schon lange nicht mehr. Es war Wahnsinn, da bin ich durchgedreht, dass ich die weggeschmissen habe. Gut, dass Sie jetzt nachgefragt haben. Es hat noch keiner gefragt. Die war zweimal ausgestellt. Ich glaube in Heidelberg und in Göttingen. ![]() „intermedia ’69“, Heidelberger Kunstverein, 19. Mai – 22. Juni 1969; „Konzepte einer neuen Kunst“, Göttinger Kunstverein, Januar/Februar 1970. An der Ausstellung beteiligt waren unter anderen Joseph Beuys, Thomas Bayrle, Hans Haacke, Jörg Immendorff und Daniel Spoerri. Da waren jedenfalls Beuys und Immendorff und die alle dabei, und da hatte ich diese Riesendose ausgestellt. Das war eine tolle Sache.
„intermedia ’69“, Heidelberger Kunstverein, 19. Mai – 22. Juni 1969; „Konzepte einer neuen Kunst“, Göttinger Kunstverein, Januar/Februar 1970. An der Ausstellung beteiligt waren unter anderen Joseph Beuys, Thomas Bayrle, Hans Haacke, Jörg Immendorff und Daniel Spoerri. Da waren jedenfalls Beuys und Immendorff und die alle dabei, und da hatte ich diese Riesendose ausgestellt. Das war eine tolle Sache.
Haben Sie direkte Reaktionen auf diese Arbeit erhalten?
Ja, die Arbeit ist total verrückt angekommen. Das war eine wahnsinnige Arbeit. Aber es hat mir trotzdem den Weg nach Düsseldorf nicht geöffnet.
Das wussten Sie wahrscheinlich auch vorher schon, dass Sie das nicht mit einer einzigen Arbeit schaffen?
Nö, das hätte ich eigentlich gedacht.
Mit der Dose?
Sie war ja in Köln in der Galerie Ingo Kümmel. Aber der Typ war ein totaler Chaot. Es war eben nicht Schmela …
1966 haben Sie in Wiesbaden in der „EXTRA“-Ausstellung ![]() „EXTRA“, Städtisches Museum Wiesbaden, 25. Juni – 21. August 1966. An der Ausstellung beteiligt waren H.P. Alvermann, Thomas Bayrle, Gotthard Graubner, Konrad Lueg, Sigmar Polke, Gerhard Richter und Rissa. unter anderen mit Polke, Richter und Konrad Lueg ausgestellt. Wie kam es dazu?
„EXTRA“, Städtisches Museum Wiesbaden, 25. Juni – 21. August 1966. An der Ausstellung beteiligt waren H.P. Alvermann, Thomas Bayrle, Gotthard Graubner, Konrad Lueg, Sigmar Polke, Gerhard Richter und Rissa. unter anderen mit Polke, Richter und Konrad Lueg ausgestellt. Wie kam es dazu?
Clemens Weiler hat mich gefragt. Er wollte mich dabeihaben.
Da waren Sie doch schon sehr nah an den Rheinländern dran?
Ja, das war nah dran.
Es hätte klappen können …
Ja richtig, das ist gut ausgedrückt.
Die „Seriellen Formationen“ ![]() Serielle Formationen“, Studiogalerie im Studentenhaus der Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 22. Mai – 30. Juni 1967. in Frankfurt am Main war auch so eine Gruppenausstellung mit internationaler Beteiligung …
Serielle Formationen“, Studiogalerie im Studentenhaus der Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 22. Mai – 30. Juni 1967. in Frankfurt am Main war auch so eine Gruppenausstellung mit internationaler Beteiligung …
Da hat sich dann auch etwas getan, eine der Arbeiten ist verkauft worden. Ich hatte zwei Arbeiten in der Ausstellung und eine ist verkauft worden. Aber es hat lange gedauert.
Wer kaufte damals in Frankfurt Kunst?
Keiner.
Ich habe jetzt in der Ausstellung in der Tate Ihre Ochsentapete ![]() Thomas Bayrle, „Ochsen“, 1967.
Thomas Bayrle, „Ochsen“, 1967.  gesehen. War das Aufkommen von Massenproduktionen damals eine Entwicklung, die einem Angst gemacht hat?
gesehen. War das Aufkommen von Massenproduktionen damals eine Entwicklung, die einem Angst gemacht hat?
Nein, das hat mich eigentlich eher begeistert. Ich habe dieses Allover mehr von Scharlach und Masern her, also von Hautkrankheiten. Dass die ganze Gesellschaft, sozusagen, überzogen wird mit Mustern. Das war vielleicht auch schon so ein gewisser Irrsinn. Ich habe das tatsächlich gesehen wie den Grießbreiberg in diesem Märchen, ![]() Jacob und Wilhelm Grimm, „Der süße Brei“, in: dies./Heinz Rölleke (Hg.), „Kinder- und Hausmärchen“, Bd. 3, Stuttgart 1980, S. 195–196. wo der Grießbrei überläuft und dann in die Straße läuft, die Wände hoch, über die Kleider und über alles. Sagen wir mal ein bisschen klaustrophobisch. Damals war es so, dass die Produktion noch auf Halde arbeitete. Heute wird es ja erst produziert, wenn es auch bestellt ist, wie bei Amazon. Das war schon eine wichtige Sache, die Überproduktion als Mentalität. Und diese Mentalität ist wie eine Hautkrankheit gewachsen.
Jacob und Wilhelm Grimm, „Der süße Brei“, in: dies./Heinz Rölleke (Hg.), „Kinder- und Hausmärchen“, Bd. 3, Stuttgart 1980, S. 195–196. wo der Grießbrei überläuft und dann in die Straße läuft, die Wände hoch, über die Kleider und über alles. Sagen wir mal ein bisschen klaustrophobisch. Damals war es so, dass die Produktion noch auf Halde arbeitete. Heute wird es ja erst produziert, wenn es auch bestellt ist, wie bei Amazon. Das war schon eine wichtige Sache, die Überproduktion als Mentalität. Und diese Mentalität ist wie eine Hautkrankheit gewachsen.

